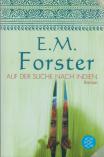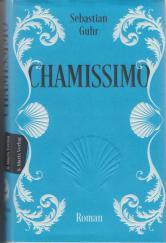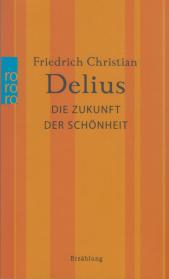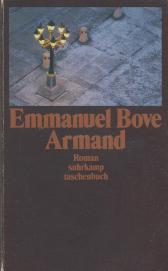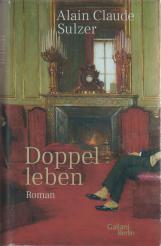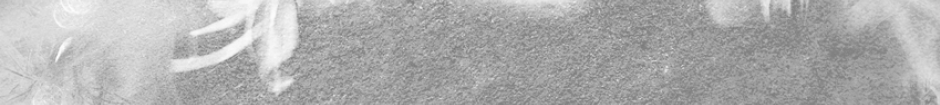
Paradise Garden
Von Elena Fischer
Erschienen im Verlag Diogenes 2023
Elena Fischer schrieb ein Roadmovie und einen Coming of Age Roman, dramaturgisch stark an
seinen berühmten Vorläufer „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf orientiert. Jetzt ist Herrndorfs Tschick nicht nur das Original, sondern auch flotter und witziger geschrieben. Es ist von Claudia
Armbruster eine Beleidigung meiner Intelligenz, diesen Roman als „eine große Überraschung“ zu bezeichnen. Leidet das deutsche Feuilleton an einer fortgeschrittenen Demenz? Es spricht ja nichts
gegen einen weiteren Coming of Age Roman als Debüt einer Autorin, und es spricht auch nichts gegen den Roman von Elena Fischer. Nur ist es weder eine Überraschung, noch ein Wunder. Eher trifft schon
Alina Bronskys Aussage zu, dass es ein liebevoller Roman über Traurigkeit ist. Elena Fischer schreibt empathisch über eine Mutter-Tochter-Beziehung. Auch wird das Thema Heimat und Verwurzelung
angesprochen, das nun wieder an die Tschick-Thematik erinnert. Die 14jährige Ich-Erzählerin Billie lebt alleine mit ihrer Mutter in einer Wohnhaussiedlung in eher prekären Verhältnissen. Billies
junge Mutter hat zwei Jobs und schafft es dennoch, ihrer Tochter viel Liebe zukommen zu lassen. Die beiden gewinnen ein Preisrätsel in einer Radioshow und beschließen, dieses Geld für einen Urlaub in
Frankreich zu nutzen. Doch dann kommt die Großmutter aus Ungarn zu Besuch. Angeblich ist sie krank. In einem Handgemenge bei einem Streit stürzt Billies Mutter unglücklich und stirbt. Plötzlich ist
Billie allein, ganz allein, weil sie auch noch von ihrer besten Freundin Lea verraten wird. Lea kommt aus gut situierten Verhältnissen, aus der Oberschicht und Billie überrascht Lea dabei, wie sie
sich bei Leas Mutter über Billies Familie lustig macht. Billie hasst ihre Großmutter und beschließt, mit dem Nissan ihrer Mutter abzuhauen. Sie hat ein Ziel. Auf einem Foto in einer Kiste sieht sie
einen Arm. Den Arm ihres vermutlich leiblichen Vaters. Ihre Mutter hat Billie nie viel erzählt. Eigentlich fast gar nichts. Billie entdeckt nun eigenständig ihre Wurzeln. Ihr Vater entpuppt sich als
sympathischer, aber etwas eigenbrötlerischer Stiefvater und der leibliche Vater bleibt ein Unbekannter. Am Ende kommt es auch zur Versöhnung mit der Großmutter. Soweit die Story. Elena Fischer
schreibt klar und schnörkellos. Sie nutzt einfache Sätze und erzählt uns die Geschichte von Billie in einer gut strukturierten Dramaturgie.
Der Roman liest sich leicht. Abgesehen von der Großmutter sind alle Figuren freundlich und hilfsbereit. Am Ende ist auch die Großmutter eine liebenswerte Person, die sich um Billie Sorgen macht.
Billie, das Meermädchen, wie Frau Krause sie tauft, sucht nach dem Verlust der Mutter nach einer neuen Heimat und entdeckt dabei ihre eigenen Wurzeln. Bedenkt man die Brutalität und Plötzlichkeit mit
der Billie zur Waise wird, erschien mir das manchmal zu harmonisch. Aber kann man einem Roman vorwerfen, dass er uns eine Welt zeigt, die brüchig und trotzdem gut ist? Der Referenzroman von Wolfgang
Herrndorf zeigte uns den Verfall und die Sinnleere einer Konsumwelt. Es ging dort schmutziger zu. Vielleicht liegt das daran, dass Jungs lieber im Dreck spielen, als Mädchen? Ist Billie zu süß? Zu
sehr als Mädchen gezeichnet, zu sehr als verletzlich gemalt, verträumt und etwas verloren. Möchte man Billie nicht sofort in den Arm nehmen und trösten?
Doch so einfach ist es dann doch nicht. Die Grenzen und Störungen in Billies Leben werden zwar nur zart angedeutet und etwas weich gezeichnet. Aber da sind sie dennoch. So wirkt der Roman
unterschwellig durchaus nach. Es ist schon so, dass man jetzt wissen will, was aus Billie wird. Wird sie mit der Großmutter zusammenleben können, wird sie ihren Stiefvater weiter besuchen, wird
sie ihren leiblichen Vater Laszlo doch noch kennen lernen?
Die prekären Verhältnisse aus denen Billie kommt, werden im Wesentlichen über die
Sparmaßnahmen beim Essen gezeigt. Das Haus von Ludger, dem Stiefvater, erscheint Billie unglaublich groß. Die frische Nahrung die ihr Ludger serviert, dargestellt am Kartoffelbrei mit echten
Kartoffeln und Butter, ist köstlich. Die ganze autofreie Insel auf der Ludger lebt ist ein Versprechen, das nicht gehalten wurde.
Der Roman hat allerdings diesen Bruch nicht völlig aufgelöst. Zwar gibt es die eine Stelle, wo Billie ihre Mutter hasst. Aber nur kurz und nur bedingt glaubhaft. Denn spannend ist ja an dem Roman,
dass zwei Idyllen gegenübergestellt wurden. Die eher kommunistische Idylle in der prekären Wohnsiedlung, in der die Gemeinschaft eine zentrale Rolle spielt. Mit dem Tod der Mutter zerbricht der Anker
dieser Gemeinschaft und mit dem Verrat Leas bekommt die vermeintliche Idylle sozialkritische Risse. Die andere Idylle ist der Garten, die Insel, das Haus von Ludger. Dort gibt es kaum Menschen, nur
Natur, Pferde, Vögel, Seehunde, Wind. Diese Idylle zerbricht, weil sie ein Fake ist. Ludger ist nicht ihr Vater, nur eine vorübergehende Parkstation.
Was bedeutet es, erwachsen zu werden? Dass man die Idylle aufgibt? Sich seinen angemessenen Platz in der Hölle sucht? Doch dazu ist die Hölle in diesem Roman zu zart. Die Großmutter – die Hölle – ist am Ende vielleicht gar nicht so schlimm? Da war ich etwas enttäuscht. Denn auch ich habe die Großmutter von Anfang an gehasst. Ohne die Großmutter funktioniert der ganze Roman nicht. Es ist daher eine Art Swift der Generationen. Die Heimat Ungarn, die böse Großmutter, das Arschloch von leiblichem Vater. Das ist die Gegenidylle, das ist die Hölle. Oder nein, halt. Ist es nicht eher so, dass die Idylle mit der jungen, tanzenden Mutter eine perfide Hölle war, weil sie auf einer Lüge und einer Illusion ruhte. Eine Illusion, die durch den Tod der Mutter aufgedeckt wurde und so ist die Großmutter eine Aufklärerin. Und der Garten, die Insel von Ludger, ebenfalls nur eine Illusion, ein Gaukelwerk des Teufels. Machen wir uns also nichts vor, akzeptieren wir die Realität. Wir sind alle Waisen und heimatlos. Die Realität ist eine Erziehungsanstalt, die uns zur Pünktlichkeit ermahnt, uns Mores lehrt und im Schweiße unseres Angesichts das mühselig erworbene Brot essen, aber kaum genießen lässt. Dieses Brot, das Ludger mit Butter und Lachs belegt, ist in den meisten Fällen trocken, alt und statt mit Lachs und Butter mit Margarine und Klebeschinken belegt. Doch Billie weiß nun über ihr Leben Bescheid. Wir sind aufgeklärt, abgeklärt und nicht mehr verklärt. Der Paradiesgarten wurde entlarvt. Billie kann nun erwachsen werden, legt ihre Träume zur Seite und beginnt ein bürgerliches Leben mit zwei Jobs, Steuererklärung und regelmäßigen Fortbildungen. Das ist eigentlich schade. Es wäre jedem, auch Billie, vergönnt, weiter zu träumen, in Illusionen zu schwelgen und am Ende nicht aufgeklärt, sondern verklärt in den Himmel empor zu steigen. So war das noch vor 300 Jahren. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber es erklärt den sanften und angenehmen Sound von Billies schöner Welt. Eben die Idylle, die das Kind sein, leider nur das Kind sein ermöglicht.
Eigentum
Von Wolf Haas
Erschienen 2023 im Verlag Hanser
Jetzt ist schon wieder was passiert, flüstert uns der Erzähler in den bekannten und verfilmten Brenner-Krimis von Wolf Haas immer gleich zu Beginn zu. Der im Salzburger Land aufgewachsene, in dem 3000 Seelen Dorf Maria Alm geborene Autor war neun Jahre lang Schüler eines erzbischöflichen Privatgymnasiums. Diese erzbischöfliche Umarmung bearbeitete Haas in seinem Roman „Silentium“ von 1999. Mich hätte schon sehr interessiert, ob seine Mutter diese Romane von ihrem Sohn gelesen hat. Doch Wolf Haas erzählt uns von den letzten drei Lebenstagen seiner Mutter anders, als wir es gewohnt sind und doch erfahren wir viel mehr, als der erste Satz (sie war fast fünfundneunzig Jahre alt und nicht mehr ganz da, erkundigte sich meine Mutter bei mir nach ihren Eltern) ankündigt. Wir erleben im gewohnt oralen Sound des Autors das Leben einer durchaus besonderen Frau. Jahrgang 1923 als Tochter eines Wagnermeisters in die Dorfwelt Österreichs hineingeboren, war von Anfang an Arbeit, Arbeit, Arbeit und Sparen, Sparen, Sparen angesagt. Keine Heizung und dafür nichts zu essen, und La Gente, die Leute, bezahlten beim Vater nie ihre Rechnungen. Arbeit, Arbeit, Arbeit, Sorgen, Sorgen, Sorgen. Der Vater, ihre Brüder, ihr Mann und ihre beiden Söhne. Die Geschichte ihres Großvaters, der immer größeres Land kauft bis der letzte Deal platzt, weil kurz vor der Übergabe die Inflation sein Geld wertlos machte und er daher plötzlich ohne Hof dastand, weil er den eigenen grade verkauft hatte, ist besonders bitter. Das Geld war hin. Arbeit, Arbeit, Arbeit, aber auf nichts ist Verlass. Diese Frau musste früh lernen, dass sie sich nur auf sich selbst verlassen kann. Und ganz sicher nicht auf La Gente, die Leute. Schon daher fühlte ich eine gewisse Verwandtschaft mit dieser tapferen Frau, auch wegen ihrer selbst gewählten Eremitage nach dem Tod ihres Mannes. Zwischen dem ersten Tag ihres Servierkurses, den sie besuchen durfte, weil sie so „gescheit“ war, und dem zweiten Tag ihres Servierkurses liegt der Zweite Weltkrieg. Schon das ist ein Verweis auf die Art und Weise, wie in Österreich die Nazi-Geschichte bearbeitet wurde. Aus dem Servierkurs war eine Hotelfachschule geworden. Aber es gab nach dem Krieg nichts. Sie lernte Servieren mit aufgezeichneten Tellern. „Rotweinglas“ stand auf einem Zettel. Die Lehrer waren Professoren, ein Mathematikprofessor in der Hotelfachschule! Wenn man die alte Kahlschlagliteratur liest (Schnurre, Borchert) dann blitzt schon mal die surreale Nachkriegszeit auf. Aber Wolf Haas schafft es durch die 75 Jahre Distanz seines Erzählers, eines in einer massenindustrialisierten Hightech-Welt lebenden Erzählers, dieses Surreale wie ein ganz verdrehtes Rokoko-Märchen klingen zu lassen. Ein Mathematik-Professor in einem Servierkurs mit aufgezeichneten Rotweingläsern! Dieses Schweizer Grandhotel, die Geschichte von der verlorenen Geldbörse, ihre Arbeit in der amerikanischen Zensurbehörde, im Arbeitsdienst der Nazis, ihre Arbeit bei der Flugabwehr, ihr dreitägiger Rückmarsch nach Hause. Und dazwischen dieses Dorf, das Altenheim, in dem Wolf Haas geboren wurde, weil es zuvor eine Gebärstation war zu der seine Mutter hochschwanger fünf Kilometer durch tiefen Schnee zu Fuß zum Gebären gestapft ist. Und das alles erzählt Haas mit einem leicht grantigen Unterton, gestresst, weil er eine Poetikvorlesung verfassen muss und sich versehentlich „Lass weg Haas“ als Nachricht auf sein Handy schickt.
Sparen, Sparen, Sparen. Kaum hat sie die 10.000 Schilling für die Anzahlung der Immobilie beisammen, ist der Preis auf 20.000 Schilling gestiegen. Wieder sparen, sparen, sparen. Aber die Immobilie läuft seiner Mutter immer davon. Das Geld ist hin. Es ist eine kapitalistisch-archaische Urerfahrung, die ich gut nachvollziehen kann. Kaum hat man ein bisserl angespart, kommt was daher, passiert was, kriegt man eine blöde Rechnung, mit der man nicht gerechnet hat, und das Geld ist hin. Und die existenzielle Bedrohung, ein Leben zu leben, wo einem jederzeit das Dach vom Kopf gezogen werden kann, das kenne ich nur zu gut. Am Ende wird die 89jährige Frau von der Raika aus ihrer Wohnung geworfen und daraus wird dann ein Hotel. Dass Wolf Haas als Kind mit Ausblick groß wurde, auf eine Friedhofsmauer, dass sein Lieblingsmensch ein behinderter Totengräber war, das lässt tief blicken und erklärt durchaus den düsteren Humor, den seine Brenner-Romane aufweisen und für die er zu Recht Berühmtheit erlangte. Filmisch bekamen diese Romane natürlich mit Joseph Hader einen kongenialen Ermittler, der an düsterem Humor der literarischen Vorlage in Nichts nachsteht. Woraus wird der Leberkäs gemacht? Aus den Resten der Knackwurst. Woraus wird die Knackwurst gemacht? Aus den Resten des Leberkäs. Alles ein Kreislauf. Und am Ende fährst mit dem Lift noblesse in die Gruft. Die beste Immobilie ihres Lebens. Endlich ein eigenes Zuhause. Für immer. Und all das im Kolorit des Salzburger Landes zwischen Ex-Nazis und Jägern, Totengräbern und La Gente.
Der Humor von Haas täuscht uns, führt uns einen Spaß vor, der bitterer ist, als dieser Humor uns vordergründig fühlen lässt. Eigentlich ist es blankes Entsetzen über diese Welt, über diese vergessliche Welt, über diese ignorante Welt. El Mundo. La Gente in dieser El Mundo. Wolf Haas wandert zwischen Friedhof und Altenheim drei Tage hin und her und erzählt uns ein ganzes Leben. Der Wert dieses Leben, der Mut dieser Frau, ihre Verbitterung aber auch ihre Herzlichkeit (wie sie die Wirts-Kinder durch die Schule bringt, die alle zur Beerdigung kommen), dieses reiche Leben von dem vielleicht nur ein blaufarbiger Durchschlag übrig bleibt, eines Briefes an die Gemeindeverwaltung und die Raika, in der sie mutig eine Wohnung einfordert und bekommt. Wolf Haas hätte seiner Mutter auf Kosten seines eigenen Daseins einen reichen Amerikaner gegönnt und keinen Hilfsarbeiter.
Die Sprache, die Haas anwendet ist der orale Sound. Haas promovierte über konkrete Poesie und das macht auch seine Sprache in der Prosa konkret. Das Telefonat mit der
Musikerin, die ihm erklärt, wie eine traurige Musik zu erklären ist, ist eine subtile Nuance. Es erklärt nämlich gar nichts, wenn man weiß, dass moll traurig und dur fröhlich ist. Trauer ist eine
kulturelle Einhegung, die Natur trauert nicht, kennt das gar nicht.
Das Handy der Mutter, das auf den Namen des Autors läuft ist Synonym der Sprachlosigkeit zwischen den Generationen. Wetter, Essen, bist krank, bist wirklich nicht krank, da wären wir wieder.
Es ist ein traurig-süßes Ende des Buches, dass Haas das verloren gegangene Handy nicht kündigt, sondern insgeheim auf einen Anruf seiner Mutter wartet, von wo auch immer, und sie ihn fragt, bist auch
wirklich nicht krank. Dass man das vermissen kann, ja, das kann ich so gut nachvollziehen.
Ein Mädchen mit Prokura
Von Christa Anita Brück
Reprint im Rowohlt-Verlag, 2023
Erstmals erschienen 1932
Hohe Mieten, unsichere Arbeitsplätze, ökonomischer Krisenmodus. Aus dieser Stimmung berichtet der inzwischen historische Roman von Christa Anita Brück, 1899 in Liegnitz in Niederschlesien (heute Polen) geborene Autorin. Sie starb 1958 im Taunus und hat nach dem Krieg nichts mehr veröffentlicht. So sind die Jahre nach der Katastrophe für die Autorin nur durch Vergessen gekennzeichnet. Fast 100 Jahre später entdeckt der Rowohlt-Verlag diesen Roman wieder. Und es ist der Roman der Stunde. Ein Staatshaushalt der vor dem Verfassungsgericht nicht standhält, weil er sich aus fragwürdigem Sondervermögen zusammensetzt, eine Regierung im Dauerkrisenmodus, eine rechtspopulistische Partei die in Teilen Deutschlands sogar stärkste Kraft ist, in einer Welt die von Rechtspopulisten vor sich her gejagt wird, eine Welt die zunehmend Gewalt als erweitertes politisches Mittel akzeptiert, kurz eine Welt die ein paar Analogien aufweist zur Welt der Christa Anita Brück. Der Roman „Ein Mädchen mit Prokura“ wurde 1932 veröffentlicht und 1934 verfilmt. Buch und Film waren komplett aus dem Bewusstsein verschwunden. Heute würde man diese Vorgehensweise als Cancel culture klassifizieren.
Sieht man sich die Bankenkrise von 1930 an, dann wird einem heute schummrig. Denn ein Teil der
Krise bestand darin, dass die NSDAP im September 1930 die zweitstärkste Partei wurde und es in der Folge zu Kreditabzügen von einer Milliarde Reichsmark kam. Vorangegangen war ohnehin schon der
schwarze Donnerstag am 24. Oktober 1929 in den USA auf der Grundlage zu risiko-reicher hoher Kredite. Der Deflationsdruck wurde immer höher. Die folgende Pleitewelle führte zu einer Kapitalflucht und
es drohte ein Staatsbankrott. Der Tributaufruf (Nazi-Jargon) des Kabinett Brüning bestätigte diese Angst nur. Das Hoover-Moratorium (Aussetzung der Kriegsschuld für ein Jahr), Bankenverstaatlichung
halfen nicht. Der Leitzins wurde auf 15 Prozent erhöht und verschärfte nur die Kreditklemme. Und heute haben wir wieder einen aufgeblähten Markt. In den ersten beiden Jahrzehnten unseres Jahrtausends
hat sich das Kursvolumen verzehnfacht. Das sind Spekulationen. Denn das wurde alles noch gar nicht erwirtschaftet. Krieg verbrennt das und ist eine gewisse Notwendigkeit, wie später ab 1939 gar nicht
anders möglich. Auch jetzt ist der Krieg eine Tatsache die mit der Ökonomie korreliert.
Brück schrieb den Roman in einer für die damaligen Zeit üblichen, gehetzt wirkenden Sprache, einer Mischung aus Expressionismus und Neuer Sachlichkeit, die seit den 1920er Jahren zum Sprachsound
zählte. Vergleichsromane wie „Kleiner Mann was nun“ oder auch „Bauern, Bonzen und Bomben“ von Hans Fallada wurden im gleichen Zeitraum (1932, 1931) veröffentlicht und gehören heute zu den
Standardwerken der Neuen Sachlichkeit. Auch Joseph Roths Roman „Das Spinnennetz“ (1923) gehört zu diesem Genre, dessen Merkmale die kühle, distanzierte Beobachtung der äußeren Wirklichkeit war,
realistische Themen im Reportage-Stil, sachlich und kühl wirkende Figuren. Die knappe, pointierte Sprache, die teilweise gehetzt wirkt und für den vorliegenden Roman sehr geeignet war, weil sie die
Fieberkurve der Börsen imitierte, diese Sprache gehört zum Expressionismus, deren bevorzugten Themen die Großstadt, der Untergang, der Rausch waren. Autoren wie Alfred Döblin, Fritz von Unruh, Rene
Schickele gehörten dem Expressionismus der ersten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts an. So liefert uns die Art der Erzählung von Christa Anita Brück einen stilistischen Eindruck der Weimarer
Epoche. Dass dieser Roman es in die nationalsozialistische Bibliothek schaffte, liegt wohl nicht am Inhalt selbst und auch nicht an der gewählten Sprache. Denn das wäre eigentlich ein typischer Roman
für den von den Nazis als „Asphalt-Literatur“ bezeichneten Stil. Der Roman bediente eher eine Sichtweise der Nationalsozialisten, wenn man erkennt, dass hier von einer Welt die Rede ist, die abstrakt
mit Zahlen operiert, die international agiert und in diverse Finanzverschwörungen verstrickt ist. Die Heldin Thea Iken lässt sich so zu einer Ikone der Aufrichtigkeit, der Treue (ihr Schweigen für
den Sohn des Bankdirektors ist beeindruckend selbstlos), und der Verlorenheit von Frauen ohne Mann stilisieren. Der Inhalt des Romans, die massive Sozialkritik, lässt sich umdeuten in Dekadenz.
Das macht den Roman heute zu einem Roman der Stunde. Kaum ein aktuell erscheinender Roman ist aktueller als dieser vor 90 Jahren geschriebene Text. Schon damals herrschten ähnliche gesellschaftliche
Abgründe und Befindlichkeiten wie sie heute wieder herrschen. Der Arbeitsalltag ist das zentrale Thema des Textes. Der juristische Anteil ist eher Bühne, um Spannung zu erzeugen.
„Hat sie Glück, ist die Wohnung leer. Dann darf sie allein in der kahlen Küche sich etwas Wasser heiß machen für ihren Tee. Ein paar Schnitten, die Zeitung, eine Zigarette. Schluss der Vorstellung.“
Diese auf Seite 75 geschilderte Sinnleere liefert das retardierende Element des Textes. Es
macht die tagtäglichen Kämpfe und Konflikte zu absurd wirkenden Bemühungen für was? Für ein paar Schnitten, die Zeitung, eine Zigarette. Zu wenig für ein sinnerfülltes Leben. „Nur Ideale sind Luxus,
Gesinnung ist Luxus, Kollegialität, alles Luxus.“
Joachim, der verzweifelte Sohn des Bankdirektors Brüggemann ist ein Stellvertreter für die Sehnsucht nach dem Abenteuer. Er möchte ein Flieger werden und kein Bankmensch, der in einem nach Papier
riechenden Büro abstrakte Zahlen hin und her schiebt. In der Industrialisierungswelle in den 1920ern wurde das Leben, das Berufsleben noch abstrakter. Die „Angestellten“ lösten die Arbeiter zunehmend
ab. Das bedeutete, dass das Handwerk, die konkrete Arbeit gerade in den Großstädten kaum noch Relevanz hatte. Man darf allerdings nicht unterschätzen, dass die Verteilung von Stadt und Land noch
nahezu andersherum war, als heute. Fast 80 Prozent der Menschen lebten auf dem Land. Es war einer der wichtigsten Kontroversen der damaligen Zeit. Die Stadt galt als Moloch, als Sumpf, als Brutstätte
der Amoral, als widernatürlich. Die literarische Welt war dahingehend gespalten und als die NSDAP das Ruder übernahm, wurden vor allem die Schriftsteller in Verruf gebracht, die das städtische Leben
beschrieben. Die Schriftsteller auf dem Land, die den Landadel, die Natur zu Thema hatten, wurden von den herrschenden Nazis hofiert. Der Roman von Christa Anita Brück konnte wohl nur deshalb der
Bücherverbrennung entgehen, weil er die Stadt eben als amoralisch und dekadent schilderte, beziehungsweise diese Lesart möglich machte. Aber man kann den Roman eben auch ganz anders lesen, als
Sozialkritik und auch als Hommage an das großstädtische Leben mit seinen Facetten, den Großstadtdschungel als Abenteuer. Der Roman ist wie eine Kippfigur und ermöglicht – was ein guter Roman sollte –
verschiedene Lese-Perspektiven.
Der Diener des Philosophen
Von Felix Heidenreich
Erschienen 2023 im Verlag Wallstein
Einer der berühmtesten Sätze der letzten Jahrhunderte (aus dem Jahr 1784) stammt von dem 1724 geborenen Immanuel Kant, der ihn
in einer kleinen Nebenschrift mit dem Titel „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ aufschrieb. Das ist ein Text mit neun längeren Sätzen – also kein allzu langer Text – in
dem sich der preußische Sohn eines Sattlers mit der Vorstellung beschäftigt, dass die menschlichen Naturanlagen einem bestimmten Zweck dienten und diesem Zweck gemäß entwickelt werden sollten. Nach
Immanuel Kant ist Der Mensch ein Tier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn nötig hat. Doch Kant war zugleich überzeugter Republikaner. Es besteht also ein Widerspruch
darin, dass wir Menschen nicht ohne Führung leben können, aber der Anführer auch nur ein Mensch ist, der eigentlich geführt werden müsste. Diesen Widerspruch kann Kant nicht auflösen und daraus
folgt jetzt dieser berühmte und gern zitierte Satz Kants: „Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts Gerades gezimmert werden.“
Kant hatte also keine sehr hohe Meinung vom einzelnen Menschen, vom Individuum. Aus diesem krummen Holz schnitzte der Philosoph und Politologe Felix Heidenreich (der sich vor allem für
mehr demokratisches Bürgerengagement stark macht) in seinem zweiten Roman den Diener des Philosophen, Martin Lampe.
Heidenreich bringt uns den sperrigen Super-Philosophen Kant menschlich näher. Verstrickt in den Begehrlichkeiten seiner Freunde wird Kant greifbar. Einerseits sein englischer Freund Joseph Green
(Preußen war ja mit Großbritannien verbündet beim Siebenjährigen Krieg von 1756-1763), der tatsächlich der Stifter von Kants sprichwörtlich gewordene Pünktlichkeit war, dem Kantor der Tragheimer
Kirche in Königsberg Ehregott Wasianski und seinem langjährigen Diener, dem ausgedienten Soldaten Martin Lampe. Die Hassliebe zwischen dem Diener und dem Philosophen stehen im Vordergrund des
informierten Romans, der phasenweise echte Literatur ist. Zum Beispiel als Lampe dem Philosophen seine Kriegserlebnisse schildert, erreicht Heidenreich sprachlich ein hohes Niveau, das bei solchen
Biographical-Romanen eher selten der Fall ist. Hin und wieder betreibt der Autor unnötige Geheimniskrämerei, vielleicht zum Zweck den Leser zur Recherche aufzufordern. Zum Beispiel als sich die
Freunde mit der Charlotte von Knobloch zum literarischen Gespräch treffen. Warum verschweigt Heidenreich, dass das besprochene Buch der Roman „Das Schloss von Otranto“ von Horace Walpole ist? Man
findet es ja doch leicht heraus. Damals stieß diese Gespenstergeschichte aus dem Mittelalter (in Italien spielend) die Diskussion auf zwischen Natur- und Kunstpoesie, also zwischen Naturalismus (so
erzählen wie es geschah) oder eben künstlich zu erzählen, um eine aktuelle Aussage zu machen. Walpole eröffnete mit diesem Roman das Genre der Gothic Novel, das bis heute seinen Fan-Kreis hat. Und
warum verschweigt Heidenreich, dass das von Joseph Green an besagtem Abend zitierte Sonett von Shakespeare ist, das Sonett Nr. 18. Auch das war jetzt nicht schwer zu recherchieren. Oder warum
verschweigt der Autor in dem Kapitel „Zufall und Notwendigkeit“, dass der erwähnte Freund, der sich dem Christentum zu und von der Aufklärung abgewendet hat, sein Freund und Philosoph Johann Georg
Hamann war, einer der wichtigsten deutschen Philosophen dieser Zeit und ein spezieller Freund Goethes? Man muss das natürlich nicht wissen. Aber wenn man es denn weiß, dann erfreut man sich an dem
Bescheid-Wissen des Autors. Ein wenig eitel ist natürlich auch. Aber gut. Das darf man ja auch sein, wenn es nicht zu schlimm wird.
Dass Charlotte von Knobloch eine Freundin von Kant war wusste ich zwar. Es gibt dazu einen berühmten Briefwechsel. Aber das Ereignis an dem Literaturabend – das war mir neu und es hat mich
amüsiert, dass möglicherweise sein eifersüchtiger Freund Ehregott Wasianski die arme Frau die Treppe runter stieß, um die Ehe zu verhindern.
Aufzuklären wäre hier noch, dass der vom Autor dann Kant in den Mund gelegte Ausspruch „Talitha kumi“ aus dem Hebräischen stammt und ein Bibelzitat aus dem Markus-Evangelium ist. Dort erweckt Jesus
ein wohl totes Mädchen des Pharisäers Jaines wieder zum Leben mit dem Satz: Mädchen, ich sage dir stehe auf (Talitha kumi).
Der Roman von Heidenreich ist amüsant, verarbeitet die Fragen der Aufklärung geschickt in den Freundschafts- Feindschaftsbeziehungen. So fing Martin Lampe selbst zu denken an (sapere aude, habe Mut
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen – Kant), verfolgt also Kants Agenda aus dessen Schrift „Was ist Aufklärung“, aber das geht Kant dann doch zu weit. Wie oben schon zitiert: Der Mensch
ein Tier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn nötig hat. Und Kant ist der Herr.
Sehr traurig und empathisch schildert Heidenreich die zunehmende Demenz des großen Philosophen. Und es ist tragisch, dass der Denker, der erst Ordnung brachte in unserer verworrenen und versponnenen Wahrnehmungen von der Welt, am Ende verwirrt war und seine eigene Philosophie nicht mehr verstehen konnte.
Gut macht es Heidenreich auch, zwischen dem Philosophen und dem lehrenden Professor zu unterscheiden. Das hat Kant schon in
seiner Schrift „Was ist Aufklärung“ (1784 erschienen) dargestellt. Dort sagt Kant klar, dass man als Lehrer dem Schulsystem verpflichtet ist und dagegen nichts sagen darf. Aber als Privatmensch ist
man sogar verpflichtet Kritik zu üben und selbst zu denken. Kant unterscheidet also ganz deutlich zwischen beruflicher Rolle und Privatleben.
Ist Kant ein Aufschneider? Einer der nur viel gelesen hat und all das Gelesene dann geschickt ordnet und verarbeitet, wie das Wasianski einmal vermutet? Der verschraubte und exemplarische
Schulphilosoph Kant machte es uns nicht immer leicht, ihn zu verstehen. Und wäre es nicht hilfreich, dem geneigten Leser entgegen zu kommen? Kann man doch alles auch verständlicher ausdrücken. Doch
vielleicht ist es mit ganz neuen Denkgebäuden anders, da stieß Kant ja wirklich in ein Neuland und wir Nachgeborenen können nun entspannter diese Gedanken einkleiden.
Zusatz – synthetisches Urteil a priori
Was ja im Roman Wasianski anzweifelt:
Bei Kant – der Ursache vieler Kopfgeschwüre – ist ein analytisches Urteil a priori zum Beispiel der Satz: Der Schimmel ist weiß. Da die Qualität „weiß“ eben schon im Wort „Schimmel“ enthalten ist.
Dem Schimmel wird so nichts hinzugefügt und es ist pure Anschauung – also a priori - da ich – so meine Augen funktionieren – dieses weiß unmittelbar sehe. Ein synthetisches Urteil ist dagegen
was anderes. Der Schimmel ist drei Jahre alt. Dies setzt eine Bekanntschaft mit einem bestimmten Schimmel voraus und damit ist es nicht mehr a priori, sondern a posteriori, also im Nachhinein (nach
der besonderen Bekanntschaft mit dem Schimmel) als zusätzliches Prädikat erkannt worden. Kant ist der Meinung, dass nur solche Urteile den Namen Wissenschaft verdienen. Was ist nun ein synthetisches
Urteil a priori? Also eine unmittelbare Erkenntnis von einem zusätzlichen Prädikat? Die Rechenoperation 5+7= 12. Sowohl die 5, als auch die 7 sind analytisch in der Anschauung der Zeit. Also ich sehe
unmittelbar 5 Äpfel in der Schale liegen. Das ist bei klarem Verstand nicht zu bezweifeln und aus der unmittelbaren Anschauung gewonnen. Ebenso bei 7 Äpfeln. Aber wenn ich nun 5 Äpfel aus der Schale
nehme und sie in die Schale mit den 7 Äpfeln lege, werden daraus 12 Äpfel. Diese 12 Äpfel sehe ich nun und damit ist das ein analytisches Urteil. Aber da ich zuvor eine Operation durchführte und die
5 zur 7 hinzuaddierte, wird die 12 eben synthetisch und das aufgrund meiner Anschauung. Damit habe ich Wissen geschafft. Das ist das Experiment mit dessen Hilfe ich reine Anschauung hervorgerufen
habe, durch Synthese. Zucker ist süß. Kaffee ist bitter. Das sind analytische Erkenntnisse a priori. Wenn ich nun den Zucker mit dem Kaffee verrühre, wird der Kaffee süß und das ist eine analytische
Erkenntnis a priori. Aber da ich Zucker und Kaffee durch eine Operation zusammenfügte, ist es ein synthetisches Urteil a priori. Die gewonnene Erkenntnis ist nun qua Vernunft die, dass der Zucker den
Kaffee süß macht. Kant stellt die Bedingung auf, dass die Metaphysik nur dann zu sicheren neuen Erkenntnissen gelangen könne, wenn sich auch hier synthetische Urteile a priori fänden. Erst dann habe
sie den Status einer Wissenschaft. Heute wird immer noch darüber diskutiert, was den Status von Wissenschaftlichkeit konkret ausmacht. Insofern ist dies durchaus des Nachdenkens wert und Kant bleibt
auch heute noch aktuell.
Auf der Suche nach Indien
Von E. M. Forster
Aus dem Englischen von Wolfgang von Einsiedel
Erschien im Original 19024 unter dem Titel:
„A Passage to India“
Unsterbliche Fabeltürme, geformt aus sterblichen Träumen (Walt Whitman aus dem Gedicht A Passage to India)
Vor hundert Jahren erschien der Roman „A Passage to India“ im Edward Arnold Publisher Ltd., dem Haus- und Hofverlag der Bloomsbury-Group, einer Gruppe britischer Intellektueller, denen unter anderem Virginia Woolf, Roger Fry, John Maynard Keynes und auch der Autor des vorliegenden Buch Edward Morgan Forster angehörten. Verlagsgründer war Edward Augustus Arnold, der Enkel von Thomas Arnold, dem Urgroßvater von Aldous Huxley und Gründer der englischen Rugby-Schule. Ob alle Briten miteinander verwandt sind, lässt sich schwer belegen, aber es wird anhand dieses Beispiels der Inselcharakter schon ein wenig deutlich. Diese Insulaner und ihr Empire beherrschten fast 100 Jahre lang einen Subkontinent von drei Millionen Quadratkilometer Fläche. Englands aktueller Premierminister Rishi Sunak ist der Sohn eines 1960 aus dem indischen Punjab emigrierten Arztes. 1858 ging durch einen indischen Aufstand (im Roman mehrfach erwähnt) aus einer Handelsgesellschaft (English East India Company, EIC) Britisch-Indien hervor und prägte den Subkontinent bis zu dessen Unabhängigkeit 1947 und sicher darüber hinaus. Heute wird Indien gerne als größte Demokratie der Welt bezeichnet. Seit 1950 werden die 29 Bundesstaaten, sieben Unionsterritorien und ein Hauptstadtterritorium von einer demokratischen Verfassung regiert. Derzeit von dem hindunationalistischen Politiker Narendra Modi, dessen fanatische Parteianhänger (BJP) Moscheen niederbrennen und Moslems unterdrücken. Inzwischen verfügt Indien über die fünftgrößte Wirtschaft der Welt, knapp hinter Deutschland. Das ändert sich bald. Prognosen nach schon 2025 wird Indien Deutschland hinter sich lassen. Die Zeit in der dieser Roman spielt ist die von Britisch-Indien bestimmte Zwischenkriegszeit (Forster war mehrere Jahre ab 1921 in Indien tätig). Forster erörtert anhand einer Freundschaft zwischen einem englischen Schullehrer und einem indischen Arzt muslimischen Glaubens die Frage, die Walt Whitman in einem Gedicht (gleichlautend wie der Buchtitel) von 1870 einmal stellte, ob es eine gleichberechtigte Beziehung geben könne, in einem rassistisch geprägten Umfeld mit kolonialer Unterdrückung.
Der muslimische Arzt Aziz lädt eine Gruppe Engländer zu einem Ausflug zu den Barabar-Höhlen
ein (im Roman Marabar-Höhlen bezeichnet, da die zentrale Handlung im eher westlich gelegenen Tschandrapur spielt und die Höhlen im viel weiter nördlichen Bihar liegen). Dort kommt es zu einem Eklat.
Aziz wird verhaftet und beschuldigt, die Engländerin Adele Quested unsittlich berührt zu haben. In der darauf folgenden Gerichtsverhandlung tritt auch Adele Quested in den Zeugenstand. Doch sie kann
die Vorwürfe nicht erneuern, widerruft. Der vergleichsweise einfache Plot wird vor allem durch die verwickelten Beziehungen getragen. So leben die Anglo-Inder isoliert in ihren Clubs und lassen kaum
eine echte Beziehung zur indigenen Bevölkerung zu. Diese wiederum spalten sich vor allem in Hindus und Moslems. Die Parsen und die Sikhs spielen in dem Roman keine Rolle. Die Rolle der Parsen als
Vermittler zwischen Einheimischen und Briten schildert uns Mark Twain in seiner Reise durch Indien (1896-97). Durch den Prozess gegen einen Inder zeigt sich der Rassismus sehr offen und die
Anglo-Inder beschwören nationale Einheit, die durch Cyril Fielding, den mit Aziz befreundeten Schullehrer durchbrochen wird. Dieser äußert sich kritisch in einem Clubtreffen, meinte, er halte Aziz
für unschuldig und wird von den anderen Clubbesitzern als Landesverräter stigmatisiert. Als schließlich das vermeintliche Opfer Adele Quested ihre ursprüngliche Aussage vor Gericht widerruft, ist die
britische Vorherrschaft in Indien zerbrochen. In der Zeit in der dieser Roman spielt, war Mohandas Gandhi bereits Mitglied des indischen Nationalkongresses und arbeitete an der Unabhängigkeit
Indiens. Diese Unabhängigkeit ist auch immer wieder ein Thema das Forster in den Diskursen der Romanprotagonisten aufgreift. In jener Zeit verrichtete auch George Orwell (1922-1927) seinen
Polizeidienst in Burma (heute Myanmar). In der Kurzgeschichte „Einen Elefanten schießen“ erläutert Orwell das Verhältnis des Anglo-Inders zur indigenen Bevölkerung sehr eindringlich. Dort schildert
Orwell, wie er einen Elefanten wieder einfangen soll, der seinem Mahut entlaufen ist und dabei Verwüstungen anrichtet. Er wird von der einheimischen Bevölkerung mit Argus-Augen beobachtet und
schließlich von diesen mehr oder weniger genötigt, den Elefanten zu erschießen. Die Geschichte erläutert als eine Art Parabel das zerrüttete Verhältnis zwischen dem Empire und Indien.
Gegen Ende des 19. Kapitels erörtert Fielding den Fall Aziz mit dem Hindugelehrten Goodbole. Und dies ist eine schöne Darstellung zweier ganz unterschiedlicher Rechtsauffassungen. Laut dem Brahmanen
Goodbole gibt es im Grunde keine Einzelhandlungen. „Wenn etwas Böses auf der Welt geschieht, dann drückt sich stets das Ganze des Universums darin aus. Nicht anders auch, wenn Gutes geschieht.“
Forsters Roman gehört laut BBC zu den 100 bedeutendsten englischen Romanen. Als er erschien war das sicher nicht so, da wurde Forster angefeindet als unbritisch.
Folgt man den postkolonialen Theoretikern (wie z. B. Edward Said oder Homi K. Babha), dann gibt es weder einen einheitlichen Islam, noch einen einheitlichen Hinduismus. Beides sind koloniale Erfindungen der kolonisierenden Herren. In der Zeit als Forster in Indien war, herrschte unter den Briten die Ansicht, dass die Hindus zu verweiblicht seien, keine richtigen Männer wie eben die Briten es wären. Postkoloniale Theorien zitieren zahlreiche Textbeispiele (unter anderem auch Rudyard Kipling und sein Gedicht: Take up the White Man’s burden) die dieses rassistische Vorurteil als weit verbreitet bei den Anglo-Indern zeigt. Dagegen fürchtete man schon damals von den Moslems, dass diese besonders fruchtbar seien und sich leichter vermehrten. Die Briten hegten auch das Vorurteil, das die Schwarzen sich von weißen Frauen besonders angezogen fühlten.
Nach dem Roman A passage to India legte Forster die Feder aus der Hand mit dem Argument, er sei aus der Zeit gefallen und habe nun keine originellen Themen mehr. Es gab schon damals kritische Stimmen, die hinter dem Schweigen Forsters Homosexualität vermuteten und dann liest sich die Freundschaft von Aziz und Fielding wieder anders. Zur gleichen Zeit erschien 1924 der Roman „Der Zauberberg“ von Thomas Mann, was irgendwie passend scheint.
Aktuell bleibt Forsters Roman, weil der Rassismus leider weiter Thema ist und nach wie vor ewig Gestrige aus Hinterwelt sich selbst für besser halten, nur weil sie aus Hinterwelt stammen.
Gebranntes Kind sucht das Feuer
Von Cordelia Edvardson
Aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein
Erschien 1984 unter dem schwedischen Titel
Bränt barn söker sig till elden
Ich war gerade mit der ohnehin erschütternden Erzählung von Cordelia Edvardson fertig. Der Kreislauf unseres Todes und unserer Auferstehung in verschiedenen Formen und Gestalten, noch noch können wir sagen: Am Israel Chai. Jerusalem im November 1983.
40 Jahre später! Am 07. Oktober 2023 ermordeten Hamas-Terroristen über 1200 Menschen, darunter
auch Kinder und Babys an der Grenze zum Gazastreifen auf israelischem Gebiet, verschleppten zusätzlich über 150 Geiseln und drohen seitdem mit der Tötung der Geiseln, falls die israelische Regierung
eine Bodenoffensive startet.
„Gebranntes Kind sucht das Feuer“! Dieser Buchtitel ist fürchterlich passend. Israel sucht das Feuer. Es geht gar nicht anders.
Das Mädchen hatte schon immer gewusst, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Ausgesondert, ausgegrenzt, auserwählt trägt Israel die Krone des Leids, hinabgestiegen in das Reich des
Todes. Die Worte der israelischen Journalistin Cordelia Edvardson dringen mit tagespolitischer Absurdität tief ins Mark. Und in Deutschland? Dem Land der Täter? Erträgt man einen Schweine
schlachtenden Antisemiten (Hubert-Helmut Aiwangers Flugblatt-Jugendsünden), einen langhaarigen und verbal entgleisenden Fernsehphilosophen (Richard David Prechts Stereotype, orthodoxen Juden sei das
Arbeiten verboten, außer Diamantenhandel und Finanzgeschäfte) und muss sich auch noch um wirr twitternde Fußballprofis (Naussair Mazraoui, der den Palästinensern gegen Israel den Sieg wünscht)
kümmern.
Nicht erst seit der ersten Intifada im Krieg der Steine (1987-1993) kämpft Israel gegen den
Terror. In so einem Überlebenskampf verliert jedes Gesicht seine Arschglätte (Verzeihung, aber das trifft es einfach). Und als Cordelia an einem wunderschönen Herbsttag im schönen, deutschen Wald
gewesen war, beginn ihr Krieg der Steine mit einer offiziellen Einladung ins Gestapo-Hauptquartier. Um das gerade 14 Jahre alte jüdische Mädchen zu schützen, hatte ihre Mutter sie zur Adoption
freigegeben an eine spanische Familie. So konnte sie als Spanierin den deutschen Rassegesetzen entgehen. Doch die Gestapo lud sie ins Hauptquartier ein und die echte Mutter begleitete das Mädchen.
Hatte das Mädchen eine Wahl? Hätte sie die Doppelstaatsbürgerschaft (und damit die Rassengesetze) nicht anerkannt, was hätten die Nazis mit ihrer Mutter gemacht. Andeutung, versteckte Drohung. Ein
probates Mittel der Nazi-Justiz. So wusste man nie ganz genau, wie schlimm es werden könnte, aber man kannte ja zur Genüge die Geschichten, wie es wurde. Der Weg ins Lager ging über das Ghetto. Der
Schutzhäftling A 3709 meldete sich in Ausschwitz zur Stelle. Es war das größte Lager der Nazis. Via Bahn kamen 90 Prozent der Juden dort hin. Befreit wurden sie am 27. Januar 1945 von der roten
Armee. Noch zwei Wochen davor wurden - zwischen dem 17. Januar und dem 23. Januar 1945 - noch etwa 56.000 Häftlinge von der SS aus dem Gebiet „evakuiert“ und größtenteils in Todesmärschen nach
Westen getrieben.
Heute unterstützt der erbärmliche Schatten Russlands mit einem Mafia-Boss an seiner Spitze, die Hamas angeblich mit humanitären Hilfen.
Cordelia Edvardson erlebte die Befreiung im Januar 1945 und wurde im März 1945 mit dem so genannten „weißen Bus“ nach Schweden gebracht. Durch Weiße Busse, weiß gestrichene und mit Rot-Kreuz-Zeichen markierte Fahrzeuge unter schwedischer Flagge, wurden ab März 1945 rund 15.000 überwiegend norwegische und dänische Häftlinge aus deutschen Konzentrationslagern nach Skandinavien in Sicherheit gebracht. Der Vize-Präsident des Schwedischen Roten Kreuzes, Folke Bernadotte, hatte diese humanitären Rettungsaktionen ab März 1945 mit Walter Schellenberg und Heinrich Himmler persönlich vereinbart.
Ausgegrenzt, ausgesondert, auserwählt. Das hört nicht einfach auf. Das kann man nicht einfach
an- oder abschalten. Und die Zwangslage Israels, das sich von einem moralisch zweifelhaften Triumvirat in eine fünfte Intifada führen, führen lassen muss, ist spürbar damit zu vergleichen. Es ist
also keine Übertreibung oder eine Art Entgleisung, wenn israelische Politiker aktuell die Nazi-Vergleiche betonen und aufbringen. Die Warnungen, das Völkerrecht einzuhalten, kann man als Jude nur für
ein absurdes Gestapo-Manöver halten. Natürlich ist das Völkerrecht nicht nur zur „Bekämpfung der Blattlaus“ geeignet. Der Historiker Michael Wolffsohn äußerte sich bei der Fernsehtalkshow Anne
Will am 15. Oktober so. Das war von ihm ein Zitat. Er nannte nicht den Namen dessen, von dem er das Zitat hat. Und ich konnte es nicht recherchieren.
Wer den grandios dicht und tiefgründig erzählten Text von Cordelia Edvardson aufmerksam gelesen hat, und wer dies mit der aktuellen Stimmungslage vergleicht, zum Beispiel mit der digitalen Uhr in
Iran die das Ableben Israels ankündigt, wird verstummen, verstummen müssen. Einzig ein Kniefall ist noch denkbar. Edvardson erzählt zwar ihre Geschichte. Aber weit, weit mehr. Der magere Mann mit
gequälten Augen, der ihnen zu trinken gibt und kleine Zuckertütchen verteilt, schlägt vor Schreck, aus Enttäuschung und Hilflosigkeit, schlägt direkt hinein in dieses Meer von wütenden
Leidenden, das ihn zu überschwemmen droht. Man kann diese Passage in Kapitel 9 paradigmatisch ansehen. Während der restlichen Fahrt sitzt der Mann in sich versunken da, aller Gefühle
entleert, auf seinem Posten neben der Tür. Manchmal murmelt er abwesend vor sich hin: „Du lieber Gott, ach du lieber Gott!“ Sieht so Mitleid aus, überlegt das Mädchen.
Mitzuleiden.
Das gebrannte Kind sucht das Feuer. Ist es ein Makel? Im folgenden Kapitel 10 erzählt Edvardson, wie sie eine neue Berufung gefunden hat und freudestrahlend nach Hause eilt um den Eltern seinen Beschluss mitzuteilen in den BDM einzutreten. Das wird ihr von der Mutter rigoros verboten. Das Mädchen fühlte sich hoffnungslos verwirrt, alle Auswege waren verschlossen. Wenn sie anbot, sich einzureihen und taktfest und diszipliniert in Richtung Ziel zu marschieren (links, zwei, drei, vier, links, links) wurde es ihr verweigert, und wenn sie wie immer danebenstand, beobachtend, distanziert, hieß es: „Warum kannst du nicht bei den anderen Kindern sein, wie sie sein!“ immer war alles falsch, weil sie falsch war, unheilbar falsch.
Wie kann man aus diesem Dilemma heraus. Ausgegrenzt, ausgesondert, ausgewählt. Wäre eine historische Zäsur hilfreich? Ein radikaler Schnitt? Um so einen Neuanfang zu starten. Das war die Hoffnung nach 1945. Aber wir sehen jetzt und schon zuvor immer wieder. Das war nur Hoffnung. Das liegt auch daran, dass wir Menschen sind und keine Rechenmaschinen. Wir sind nicht rational.
Am Israel Chai.
Le chaim. Eine der sieben Pflichten zu Purim ist es, (viel) Wein zu trinken und noch mehr Le Chaims (jüdischer Trinkspruch: Auf das Leben) zu wünschen.
Purim ist ein fröhliches Fest, an dem die Erhaltung des Lebens im Mittelpunkt steht.
Gefährten
Von Ali Smith
Aus dem Englischen von Silvia Morawetz
Erschienen 2023 im Luchterhand Verlag
Die Künstlerin Sandy lebt in einer Mietwohnung und beschäftigt sich mit dem Malen von
Gedichten, dem Übersetzen von Worten in Farben. Ihr Vater hatte eine Herzattacke und liegt derzeit im Krankenhaus. Es ist die Zeit der Pandemie, weshalb Sandy ihren kranken Vater nicht besuchen kann.
Da bekommt sie einen Anruf von einer alten Mitstudentin, Martina Inglis, die ihr eine seltsame Geschichte von einem alten Renaissance-Schloß aus Metall, das Bothby-Schloss erzählt. Bei der
Überführung wird sie vom Zoll verhaftet und in einen leeren Raum gesperrt, wo sie eine Stimme hört, die sagt5 „Curlew oder curfew, entscheide dich“.
Danach taucht die beiden Zwillingstöchter der alten Mitstudentin Martina Inglis, Eden und Lea bei Sandy auf, vertreiben sie regelrecht aus ihrer Wohnung. Schließlich flüchtet Sandy in die leer
stehende Wohnung ihres kranken Vaters. Mit dabei hat sie Shep, den alten Hund ihres Vaters auf den sie aufpasst. Allerdings versorgt sie ihn nicht sehr gut.
Das ist im Großen und Ganzen die Rahmenhandlung, in der aus den Highlands stammende Autorin Ali Smith phantastische Binnenräume eingeflochten hat. Die Erzählung über eine vagabundierende Schmiedin
und Pferdeflüsterin bildet dabei das Hauptstück. Denn sie hat vor 500 Jahren in einer Pest-Epidemie das Boothby-Schloss geschmiedet, von dem Martina Inglis sprach. Sie wird vergewaltigt und findet
sich im Moor wieder. Dort entdeckt sie einen frisch ausgeschlüpften Vogel, einen Brachvogel (curlew), den sie groß zieht und der ihr dann auf Schritt und Tritt folgt.
Der Brachvogel brütet in Mooren, Dünen, Feuchtwiesen und auf störungsarmen Weiden. Er rastet
an Küsten, in der Nähe von überfluteten Äckern, Wiesen und an Flachwasserzonen von Seen. Seine Stimme ist ein lauter, sehr melodisch klingender, wehmütiger Ruf, der wie „kuri li“ klingt. Dieser Ruf
hat ihm im englischsprachigen Raum vermutlich den Namen „Curlew“ eingebracht. Das Gegenwort dazu ist curfew, das nur einen Buchstaben anders hat und sich als Ausgangssperre übersetzt und natürlich
eine Anspielung auf den Lockdown ist. Die Autorin hat neben diesem phantastischen Binnenraum auch moderne politische Kritik an den Herrschenden eingeflochten, die mit ihren Sachzwang-Entscheidungen
über Menschen und deren Leben entscheiden, ohne auch nur schamhaft darüber zu reflektieren, was ihre politischen Ränkespiele für die Menschen bedeuten. In einem viel älteren Roman las ich folgende
Schlussworte: Die wirkliche Hölle liegt darin, dass sich dies widersprechende Doppelspiel in uns fortsetzt. Wenn also ein einziger Buchstabe so viel ändern kann!
Wie passt das alles in einem Roman zusammen? Freiheit innerhalb der Knechtschaft wird umgedeutet zu einer positiven Freiheit? Bei allem Lesevergnügen den der Roman zweifelsfrei bietet, von spritzigen
und aberwitzigen Dialogen mit typisch englischem Humor, bis hin zu wunderbaren Naturbeschreibungen, oder auch das Portrait des alten Shep, bei all dem gut lesbaren und kurzweiligen Stoff, bei einer
großartigen Gedichtanalyse eines Cumming-Gedichtes, bis hin zu der ambivalenten Verzweiflung während des pandemischen Lockdowns, der Text ließ mich am Ende doch etwas ratlos zurück. Die
Titelübersetzung fand ich ganz passabel. Das Original als Begleitstück zu übersetzen, wäre auch kaum als guter Titel durchgegangen, zumal es auch mehr ist, ein Kunstwerk, das ein anderes Kunstwerk
begleitet. Insofern verschachtelt sich in dem Roman von Ali Smith einiges, das Begleitstück der Bilder von Sandy, die Worte malt, das Begleitstück der vagabundierenden Pferdeflüsterin, das
Begleitstück der äußeren Umstände durch die Regeln der Pandemie, das Begleitstück eines erkrankten Vaters, das Begleitstück einer entrückten Mutter.
Gefährten ist die bessere Übersetzung des Buchtitels, zweifelsfrei. Wie es auf Seite 35 von Sandy dargestellt wird: Ich hatte von Menschen gehört, die, als sie isoliert oder inhaftiert oder einsam oder dergleichen waren, an den verschiedensten unerwarteten Orten, oder in Gestalt seltsamster Dinge Gesellschaft gefunden hatten. In einem kleinen Stein in der Tasche. In einem Stück Knochen, eingenäht in einen kleinen Lederbeutel…
So ist Shep ein Gefährte, aber auch der Brachvogel, bei den Zwillingskindern sind es Laptop
und Handy, aber auch die liebevolle, vermummte Krankenschwester, die sich um Sandys Vater kümmert. Gefährten sind auch die Bücher in Sandys Wohnung. Oder Ann Shatlock, die Ausbilderin der
vagabundierenden Pferdeflüsterin. Oder das Boothby-Schloß. Oder das Radio. Begleitstücke wiederum sind die verstörenden Nachrichten von Menschen die im Mittelmeer ertrinken, oder von Bomben zerfetzt
werden oder an einer Seuche sterben.
Begleitstücke sind dann auch Booster, Dinge verändern uns. Worte deuten sich um, da auch Worte Begleitstücke und Gefährten sind, wie das Wort „Hallo“, das Sandy weitläufig dekliniert in all seinen
Bedeutungen.
Alles ist nur ausgedacht, von Treibsandy hineingedacht und hinausgedacht. Etwas wurde aufgesperrt mitten im Eingesperrt sein. Der Schlüssel, den man zum Roman gerne hätte, findet sich nicht,
oder nur in den Worten wieder. „Anfangen, zögern; innehalten“ (to start, to hesitate; to stop), freiheitlich gewählte Bewegungen, denen das Mäandern des Romans durchaus entspricht, auch in der
Pferdeflüsterin, die sich am Schluss der Binnengeschichte gegen den sicheren neuen Job beim Schmied entscheidet und lieber weiterzieht, unsicher aber frei. Im Bezug zur Pandemie habe ich mir in
dieser verstörenden Zeit öfter gedacht, soll ich raus gehen und ein Risiko eingehen, oder auf Nummer sicher gehen und zu Hause, allein und unter toten Dingen bleiben. Ähnlich geht es der
Protagonistin Sandy in dem Roman, die sogar die eigene Wohnung verlässt, um Menschen aus dem Weg zu gehen, die sie anstecken könnten. Lieber bleibt man für sich und denkt sich weiter was aus. Am Ende
sieht Sandy das Gesicht ihres Vaters auf der digitalen Leinwand.
Ein Wort noch zum „The Observer“, einer britischen Sonntagszeitung die immerhin seit 1791 erscheint und in der Ali Smith mit Virginia Woolf verglichen wird. Das ist – wie immer – zu viel und zu dick aufgetragen. Es ist auch nicht „Ein Roman für unsere Zeit“ wie es in FR heißt. Es ist ein Roman aus unserer Zeit und sprachlich verzückend, aber noch lange keine Virginia Woolf.
Des Lebens Überfluß
Von Ludwig Tieck
Erstmals erschienen im Musenalmanach Urania 1839
Vor 250 Jahren kam Ludwig Tieck als Sohn eines Seilermeisters in Berlin zur Welt. Er gehörte zum Kreis der Jenaer Frühromantiker (Schlegel, Schelling, Fichte), einem Kreis aus Dichtern und Philosophen die getragen waren vom Gedanken einer Universalpoesie und einer Weltseele. In seiner Spätnovelle „Des Lebens Überfluß“ wird daher ein Traum von Heinrich Brand geschildert, der in merkwürdiger Analogie zu dem märchenhaften, glücklichen Ende der Novelle steht. Traum und Wirklichkeit stehen in der Universalpoesie von Schelling in einer wechselseitigen Partnerschaft eines ewigen Werdens. Der Gedanke der Anima Mundi mag im Ende der Novelle anklingen, dass von einem kleinen, dunklen Zimmerchen in einer Vorstadt ein Protagonist den Weltbrand auslösen könnte, dass ein einziger Schuss ausreicht, um Europa in die Revolution zu stürzen. (1914 war es dann so weit). Vordergründig handelt die Novelle von einem Liebespaar, das von zu Hause ausbüxte, um ihre unerlaubte Liebe heimlich weiter auskosten zu können. Doch die Heimlichkeit hat ihren Preis. Clara und Heinrich leben in Armut, werden sogar von Claras treuer Haushälterin unterstützt, ja ausgehalten. Der harte Winter nötigt Heinrich, die hölzerne Treppe zum Erdgeschoß abzutragen und zu verheizen. Als der Vermieter Emmerich vorzeitig von seiner Kur zurückkehrt, stellt er verwundert fest, dass die Treppe in seinem eigenen Haus fehlt. Die Szenen sind skurril und paraphrasieren zusätzlich dieses komische von Luft und Liebe lebende romantische Paar. Kurz bevor die herbeigerufene Polizei und die vielen Gaffer in der Gasse einen größeren Aufruhr um das delinquente Liebespaar anzetteln können, eilt der Märchenprinz Andreas Vandelmeer herbei, Heinrichs Jugendfreund. Dieser hat für Heinrich ein Vermögen erwirtschaftet und bringt auch den verloren geglaubten Chaucer wieder mit. Durch diese berühmten englischen Pilgererzählungen (Canterbury Tales) von Geoffrey Chaucer und einem eingelegten Brief Heinrichs konnte Andreas ihn überhaupt wieder wiederfinden. Mehrfaches wird hier verzahnt. Einmal sind die Canterbury Tales ein Ideal durch den novellistischen Stil. Weiter erinnern die Erzählungen als Mischung von Prosa und Vers an die Universalpoesie Schellings. Gleichzeitig sind die Erzählungen und Fabeln ähnlich angelegt wie Tiecks Novelle auch, mit Erzählungen von kultureller Relevanz. So erwähnt Tieck eine Reihe Literaturen, vom Don Quijote bis zu Shakespeare, vom Götz von Berlichingen bis zu Jean Paul (Siebenkäs). Das Liebespaar erweist sich so als einerseits hoch modern und andererseits als völlig abgedreht naiv und märchenhaft zugleich. Die Grundideen der Romantik, Hinwendung zur Mystik, Abkehr von der Klassik, zeigt sich in dieser Novelle als paradigmatisches Spannungsfeld. Keineswegs unpolitisch, wie man der Romantik gerne unterstellt, verweist Tieck auf Grundprobleme, die heutiger kaum sein könnten.
Pflichtlos sein ist eigentlich der Zustand, zu welchem die sogenannten Gebildeten in allen Richtungen stürzen wollen; sie nennen es Unabhängigkeit, Selbständigkeit, Freiheit. Sie bedenken nicht, dass, sowie sie sich diesem Ziele nähern wollen, die Pflichten wachsen, die bis dahin der Staat oder die große, unsäglich komplizierte, ungeheure Maschine der geselligen Verfassung in ihrem Namen, wenn auch oft blindlings, übernahm. Alles schilt die Tyrannei, und jeder strebt, Tyrann zu werden. Der Reiche will keine Pflichten gegen den Armen, der Gutsbesitzer gegen den Untertan, der Fürst gegen das Volk haben, und jeder von ihnen zürnt, wenn jene Untergebenen die Pflichten gegen sie verletzen. Darum nennen auch die Niederen diese Forderung eine altertümliche, der Zeit nicht mehr anpassende und möchten nun mit Redekunst und Sophisterei alle jene Bande ableugnen und vernichten, durch welche die Staaten und die Ausbildung der Menschheit nur möglich sind.
So (Seite 20 in der Reclam-Ausgabe) heißt es einmal im Text. Eine tiefe Erkenntnis, die auch unseren degenerierten Freiheitsbegriff auf den Punkt bringt. Danach folgt die romantische Verklärung des Herrn-Knecht-Verhältnisses:
Aber Treue, echte Treue – wie so ganz anders ist sie, wie ein viel Höheres als ein anerkannter Kontrakt, ein eingegangenes Verhältnis von Verpflichtungen. Und wie schön erscheint diese Treue in alten Dienern und ihrer Aufopferung, wenn sie in ungefälschter Liebe, wie in alten poetischen Zeiten, einzig und allein ihren Herren leben.
Beispielhaft zeigt sich die alte Haushälterin Christine, die dem Paar uneigennützig folgte und schwerste Arbeit verrichtet, um das glückliche Paar am Leben zu halten. Prinzessin und Prinz, beide schöner als schön, sind für die im Hintergrund bleibende Christine ein Ideal. Und natürlich wird sie nicht vergessen, nach der fabelhaften Rettung der glücklich Liebenden. Auch die Schlusszene mit dem Buchbinder, der in ihr altes Liebesnest als Nachmieter eingezogen war, verweist auf die Belohnung für Kaisertreue. Noch einen letzten Blick wirft das glückselige Paar Clara und Heinrich auf die alten Feuermauern, auf das süßtraurige Liebesnest in dem sie Armut und Seligkeit zugleich erfuhren.
All dies wird von Ludwig Tieck durchgehend in einem ironischen Ton erzählt. Man weiß, das ist nie wirklich ernst gemeint. Die Treppe zu verheizen ist schon so skurril, aber auch die Besitzlosigkeit, die Wassersuppe, das eigene Tagebuch als Lektüreersatz, die Eisblumen am Fenster als Schmuckersatz, all das sind Kuriositäten, ironische Verweise. Denn das rationale Ende durch das Auftauchen des Vermieters, der nur die Polizei verständigt und der Heinrich Brand für einen Betrüger hält, zeigt, dass die Realität nicht verschwunden ist.
„Ist es, wie so viele Weltweise behaupten, edel, seine Bedürfnisse einzuschränken, sich selbst zu genügen, so hat dieser für mich völlig unnütze Anbau mich vor dem Erfrieren gerettet. Haben Sie niemals gelesen, wie Diogenes seinen hölzernen Becher wegwarf, als er gesehen, wie ein Bauer Wasser mit der hohlen Hand schöpfte und so trank?“
„Sie führen aberwitzige Reden, Mann“, erwiderte Emmerich; „ich sah einen Kerl, der hielt die Schnauze gleich an das Rohr und trank so Wasser; somit hätte sich Ihr Mosje Diogenes auch noch die Hand abhauen können. – Aber, Ulrich, lauf mal gleich zur Polizei; das Ding muss einen andern Haken kriegen.“
Dieser Dialog zum Ende der Novelle bringt es auf amüsante Weise auf den Punkt. Der Hausbesitzer Emmerich ist sogar bildungstechnisch gewitzt. Sein rationales Denken wischt den ganzen Diogenes auf herrliche Weise weg.
Die Idealisierung von Armut führt am Ende auch noch zur Verstümmelung.
Mich hat immer schon etwas irritiert, wie holzschnittartig die Romantik betrachtet wurde und weiter betrachtet wird. Auch die Vorromantik (Empfindsamkeit) ist alles andere als Ironie frei. Im Gegenteil. Die Aufklärung vermisst viel häufiger diese Mehrdeutigkeit. Während die Romantik das gute Teil des Barock mitgenommen hat, den Sinn für Humor, die Akrobatik und Witzkultur, die im Barock so sehr zur Blüte kam und so sehr weggewischt wurde, dass man sie nun erst wieder ausgraben muss. In meinen Barock-Vorlesungen habe ich immer wieder auf diese Witzkultur, auf diese grandiose Raffinesse des Erzählens verwiesen, auf die Fähigkeit Mehrdeutigkeiten und Paradoxien hervorzuheben und spielerisch einzusetzen. So machte es auch Tieck, ganz im Sinne der Frühromantiker, die nicht nur barocke Mystik, sondern auch barocke Stilakrobatik vor dem teilweise plumpen Klassizismus retteten.
27. Juni 23
Der Hungerpastor
Von Wilhelm Raabe
Erschien ab November 1863 in Vorabdrucken der „Deutschen Roman-Zeitung“ herausgegeben von Friedrich Spielhagen
Wilhelm Raabe wurde 1831 in der niedersächsischen Kleinstadt Eschershausen als Sohn des
dortigen Amtsgerichtsschreibers geboren. Er verfasste weit über 60 Romane, hatte vier Töchter und war über Jahre Mitglied des Stammtisches der „ehrlichen Kleiderseller zu Braunschweig“, einem
Stammtisch der bis heute fortexistiert, sich von einer Interessensgemeinschaft zur Gründung eines Heimatmuseums in eine Gemeinschaft zu Ehren Wilhelm Raabes wandelte. Der bei Abdruck des
Hungerpastors 32jährige Autor hatte zu dieser Zeit bereits ein halbes Dutzend Romane veröffentlicht, darunter auch seinen erfolgreichen Debütroman „Die Chronik der Sperlingsgasse“, einer dem
Hungerpastor in manchem nicht unähnlichen Liebesgeschichte, die aus dem Elend in die Idylle führt. Doch im Gegensatz zum Hungerpastor war der Erzählstil Raabes in der Sperlingsgasse verwickelter und
keineswegs so chronologisch, wie es der Titel suggeriert. Der Hungerpastor dagegen beginnt ab ovo, also ab Geburt des Helden Hans Unwirrsch, was ja eigentlich ein Adjektiv für mürrisch und
unfreundlich ist. Dabei ist dieser grüblerische Hans eine wahrhaft gute Seele. Seine Vorfahren sind Hans Sachs, Jakob Böhme und sein Schustervater von dem er die stets ihn begleitende Schusterkugel
erbte, dieses Licht, das ihm stets voran leuchtet bei allem Zwielicht, dem der gute Märchenhans ausgesetzt ist. Ihm beigestellt ist sein Jugendfreund Moses Freudenstein, der sich später vom
Freudenstein zum bloßen Stein verwandelt, zu Theophile Stein. Moses ist der Vatermörder, der im Gegensatz zum vom Licht immer wieder gesegneten Hans, die Dunkelheit ertragen muss und am Ende dieser
Dunkelheit erliegt. Die Rezeptionshistorie lobte einerseits den gradlinigen Erzählstil und andererseits wurde es auch als Rückschritt gegenüber der Chronik der Sperlingsgasse gesehen. Dabei hat auch
der Hungerpastor seine modernen Einschübe. Der auktoriale Erzähler entpuppt sich einerseits als unmittelbarer Zeitzeuge, der wohl mit Hans und Moses auf das Abitur hin schwitzte (Wir schwitzten
zu allem andern Schweiß dicke Angsttropfen über der zerlesenen Grammatik), andererseits gibt es viele Auslassungen, weil der Erzähler weder zugegen war, noch Einzelheiten aus anderer Quelle
kennt. Der moderne Charakter der Erzählung zeigt daher einen unsicheren und auch durchaus ironischen Erzähler, wie wir ihn dann später bei Thomas Mann in Überfülle vorfinden werden. Der
naturalistische Stil überwiegt natürlich. Es ist eine realistische Erzählung des Lebens eines Schustersohnes, der sich als Hauslehrer verdingen muss und schließlich zum Pfarrer einer kleinen
Gemeinde aufsteigt, und es ist die gebrochene Lebensgeschichte eines Trödler-Sohnes, der sich in Paris (Belle Epoque) zu einem Dandy entwickelt, sich in zerstörerische Machenschaften verwickelt und
zum Geheimen Rat in Paris aufsteigt. Die Darstellungen des zum Christentum konvertierten Juden Moses Freudenstein alias Theophile Stein kontrastiert insofern, weil es das brave und um Moral bemühte
Leben des schlichten Hans, des Hungerpastors auf diese Weise noch hervorhebt. Dass gerade die Nationalsozialisten von diesem Buch schwärmten und den Roman als beispielhaften Beleg ihres
Antisemitismus instrumentalisierten, liegt sicher an der von Ruth Klüger nachgewiesenen stereotypen Darstellung der Familie Freudenstein. Der Erzähler distanziert sich bereits im ersten Kapitel vom
Antisemitismus und auch Wilhelm Raabe ist vom Verdacht darauf eindeutig frei. Raabe war kein Antisemit. Doch die Stereotypen sind im Buch. Doch liest man zwischen den Zeilen, dann ist Moses/Theophile
nicht stringent böse, sondern getrieben. Sein Streben ist exemplarisch in einer hierarchischen Welt, die den bürgerlichen Aufstiegsbemühungen Schlösser und Burgen vor die Nase setzte und gleichzeitig
mit einem geheuchelten bürgerlichen Moralkodex ein nicht erreichbares Ideal aufstellte. Davon abgesehen – und liest man den Hungerpastor im positiven Sinne naiv – ist der Roman gute Unterhaltung. Am
Kaminfeuer sitzend, und ich meine das nicht abfällig, bei einem Glas Rotwein liest sich der Roman butterweich, schön. Die Kritik an den Lebensumständen dieser Zeit, der Hunger, bezieht sich nicht nur
auf die leiblichen Nöte, sondern auch auf die geistigen Nöte der Menschen. Das Herr-Knecht-Verhältnis in dem der Hauslehrer Hans eingepfercht ist, bis er sich endlich als „eigener Herr“ bezeichnen
kann, ist erdrückend. Das Haus der Götz in der Parkstraße in der großen Stadt (Berlin wird mit keinem Wort erwähnt vom Autor, doch in den Rezeptionen wird automatisch von Berlin gesprochen) ist ein
Gespensterschloss in dem die Base Schlotterbeck so manche Tote hätte wandeln sehen. Und Fränzchens Onkel Theodor ist ein vom Aktenpapier und von seiner Göttergattin unterdrückter, wahrlich
geheimer Rat. Die Motive der Befreiung werden auch immer wieder mit den Neuntötern (geheime Bruderschaft, weil bei allen Lügengeschichten, die man sich dort zum besten gibt, nie von mehr als
neun Toten die Rede sein darf) und den napoleonischen Befreiungskriegen konnotiert, Leipzig und Waterloo sind noch frisch. Das Hambacher Fest liegt gerade mal 30 Jahre zurück, als der Roman erschien,
die Karlsbader Beschlüsse sind in Kraft und 1848 blieb ein Trümmerwerk. Die politischen Anspielungen lesen sich in heutiger Lesart verschlüsselter, als sie wohl damals den Lesern erschienen sind. So
war der Roman ein großer Publikumserfolg, weil der Roman auch „schön“ geschrieben ist, chronologisch, weitestgehend chronologisch erzählt und mit dem guten Ende des füreinander bestimmten Paares Hans
und Franziska erfüllt sich der bürgerliche Traum. In einem kleinen Fischerdorf in der Ostsee. Das kann man eigentlich nur ironisch lesen. Während in der Ferne in Nordamerika der Bürgerkrieg tobt,
kündigt sich Ähnliches auch in Europa an. Der Bruderkrieg zwischen den Preußen und Österreich wird die Zukunft entscheiden. Das Deutsche Reich wird gegründet und die österreichische Doppelmonarchie
entsteht.
Der Hunger ist auch einer nach nationaler Identität. Ubi bene, ibi patria. So ist man als Seelsorger und Schustersohn in Grunzenow gut aufgehoben. Dass zum Ende Henriette und Kleophea von ihrem
Qualfreund Theophile Stein hinweg gespült an genau der Stelle der Ostsee havarieren, gehört wohl mit zur stilistischen Kuriositäten- und Wundersammlung dieses vor über 150 Jahren erschaffenen
Kunstwerks. Literaturwissenschaftlich betrachtet ist die Erzählweise des ab ovo eigentlich den Schelmenromanen eigen (Simpliccisimus, Blechtrommel). Die im heroischen Gestus erzählten Helden- und
Ritterromane beginnen in medias res. Es kommt nicht von ganz ungefähr, wenn Wilhelm Raabe die berühmte Satire über Ritterromane (Don Quijote) erwähnt, als sich sein Held Hans hinsetzt, um seine
heldenhafte Hungergeschichte aufzuschreiben. Dieser autoreferenzielle Bezug zur Geschichte Raabes selbst, die sich in dem Vorhaben des Kandidaten der Gottgelehrtheit spiegelt, ein Buch über seine
Lebensgeschichte zu schreiben ist ein weiterer Beleg für die Modernität dieses Romans. Immer wieder verweist der Erzähler auf die Authentizität des Geschehenen. So werden die Briefe zitiert, aber mit
dem ironischen Vermerk des Erzählers, dass sie keineswegs so leicht zu lesen gewesen wären, wie sie hier im Buche gedruckt vorgefunden werden. Das suggeriert dem Leser, dass es tatsächlich diese mit
der unsicheren Hand geschriebenen, geklecksten Briefe gäbe. Damit spielt der Autor öfter und entwickelt so einen Sog in die Geschichte, steigert die Glaubwürdigkeit zusätzlich dadurch, dass der
Erzähler nicht alles weiß und zu den Lücken seine Vermutungen anstellen muss. Auch Verweise auf andere Texte des Autors Raabe (die Polizeistation habe er bereits an anderer Stelle beschrieben)
erhöhen den literarischen Spaß. So wie im Kapitel 6 des Don Quijote, wo der Pfarrer die Ritterromane sortiert und dabei auf einen Roman des Autors Cervantes (La Galatea) selbst stößt, mit dem der
Pfarrer – so behauptet er im Text – gut bekannt sei.
Also mein Fazit lautet kurz und knapp: Ich habs mit Freude und gern gelesen.
21. Juni 23
Das Glück in glücksfernen Zeiten
Von Wilhelm Genazino
Erschienen 2009 im Verlag Hanser
Gerhard Warlich, studierter Philosoph, beruflich Geschäftsführer einer Wäscherei und dabei eher Faktotum für seinen Chef, der ihn auch noch dazu auffordert seine Kollegen auszuspionieren, ob diese auch ordentlich arbeiten und nicht lieber in einem überfüllten Straßencafe bei einem Glas Bier sitzen. Am Ende wird er selbst Opfer dieser Betriebsspionage und gekündigt. Sein einziges Glück ist seine Freundin Traudel. Die Zweisamkeit und die Freiheit dieser Zweisamkeit sind sein Lebenskitt. Doch dann wünscht sich Traudel mehr, sie will eine Familie, ein Kind, einen Trauschein. Im Grunde eine legitime Forderung, bzw. ein legitimer Wunsch in einer schon länger gut eingespielten Partnerschaft. Aber dann werden spontane gemeinsame Kinobesuche nicht mehr durchführbar. Das Privatleben wird auch organisiert und gleicht sich dem Arbeitsleben an. Das stürzt den oft seinen Tagträumen nachhängenden Protagonisten endgültig in die Krise und am Ende erscheint er der Außenwelt vollends verwirrt, als er einer alten Freundin die er zufällig trifft, ein Stück trockenes Brot in die Hand drückt und danach in Tränen ausbricht. Soweit die Story. Auf 150 Seiten in elf Kapiteln erleben wir dann etwas, was nicht wirklich das Label Roman verdient. Auch wenn sich der Begriff Roman (aus dem Französischen einfach eine Erzählung in Vers- oder Prosaform) sich einer klaren Definition entzieht, historisch erst einmal nur den geläufigen Begriff Historie ablöste, würde ich hier dennoch eher von einer Erzählung, einer Novelle sprechen. Novelle, weil der Bericht des Ich-Erzählers ein Stimmungsbericht ist. Der impressionistische Habitus zeigt sich in der anekdotischen Sprache. Der Mensch kann Katastrophen immer nur betrachten, nicht verstehen. So auf Seite 18 unten. Zwei Absätze weiter: Ich komme nur nicht damit zurecht, daß ich mich fortlaufend zu ihr verhalten muss. Und am Ende des ersten Kapitels heißt es: Und während wir uns küssen, werden wir wieder beeindruckt sein von unserer Dauerhaftigkeit als Paar. So geht es immer weiter: Ich kann trotzdem nicht verhindern, daß ich jetzt stiller und stiller werde, bis ich vollständig in meinem Innenraum angekommen bin. Dort bedauert mich niemand so kenntnisreich wie ich selbst.
Der Icherzähler gibt also weniger einen genauen Bericht der Außenwelt, sondern einen immerzu schwankenden Bericht über seine Innenwelt. Einsamkeit ist normal; nur ihr plötzliches Eintreten ist so widerlich. Im Großen und Ganzen geschieht nicht viel. Es gibt keinen Mord, keine Tragödie, kein übergroßes gesellschaftliches Ereignis, sieht man mal von einer Demonstration ab, in die Gerhard Warlich mehr zufällig gerät. Überhaupt strömt der Icherzähler mit seinen Stimmungen und inneren Gedanken wie in einem Aquarium dahin.
Der Reiz den die Texte des Büchner-Preis-Trägers von 2004 Wilhelm Genazino ausmachen, ist das Flanieren. Der Flaneur trat mit der Erzählung „The Man of The Crowd“ von Edgar Allan Poe in die literarische Welt. In dieser Erzählung folgt der Icherzähler einem älteren eher zerlumpt aussehendem, aber unruhig wirkenden Mann, der eine Gaslaterne bei sich trägt und der Icherzähler kann einen Diamanten und einen Dolch erkennen. Der Icherzähler in dieser Geschichte von Poe bezeichnet sich erstmals in der Literatur als Flaneur. Und in der Art ist auch Genazino ein Flaneur. Das Beobachten ist nicht das Ziel, sondern die Botschaft. Damit meine ich, dass es in den Erzählungen von Genazino um das Beobachten selbst geht. Die impressionistische Faktur verweist auf die verwischten Grenzen zwischen Innen und Außen. Ganz wie in der Observership-Theorie in der Physik kann der Beobachter sich nicht aus dem beobachteten Geschehen herausnehmen. Die Illusion des klassisch naturalistischen Romans, die Ereignisse seien neutral wiederzugeben, das ist ja eh schon Schnee von gestern. Daher neigt Genazinos Sprache auch immer in die Poesie hinein, wie die häufigen Katachresen (Zeithose, Glücksfeldzug, Schmerzwaage) und der Anekdotenreichtum offenbaren. Der Leser braucht so eine gewisse Portion extra Sympathie für die zentrale Figur, für den Point of View, der bei Genazino leicht melancholisch (Etwas von der Feinheit, die ich zum Leben brauche, finde ich nur in meiner Melancholie, Seite 63), etwas pessimistisch und doch auch idealistisch ist (Es sollte nicht nötig sein, daß um des Glückes willen ein solcher Kampf stattfindet Seite 135). Und auch dieser idealistische Zug ist typisch für die impressionistische Faktur. Gerne würden wir noch erfahren wollen (also mir geht es so), ob der letzte Satz der Prosa dieser Erzählung die Veränderung nur als Möglichkeit andeutet, oder ob Gerhard Warlich wirklich aus der Krise herausgefunden hat, und er so seine Entscheidung findet, wie er in Zukunft leben will. Unwahrscheinlich ist, dass das mit Traudel sein wird. Gibt es überhaupt eine Partnerschaft für den Flaneur? Ist seine Einsamkeit und Melancholie partnerschaftsuntauglich? Ist die Innenwelt des Gerhard Warlich nicht permanent von der Außenwelt bedroht und somit von jeder Partnerschaft, die ja in der Außenwelt angesiedelt ist?
Die Freiheit der modernen Liebespartnerschaft, darauf konzipiert die eigenen Innenwelten parallel zu erleben und ohne Organisation dieses Lebens partnerschaftlich durch Raum und Zeit zu schlendern: das ist nicht auf Dauer angelegt. Der so klingende Begriff Alltag, den wir uns mit kleinen Höhepunkten zu versüßen suchen, ist oft nur der melancholische Versuch, die Zeit totzuschlagen, bevor man selbst von der Zeit totgeschlagen wird. Den Halt in dieser Welt zu finden ist inmitten unseres vollständig organisierten Chaos (Alltag eben) Schwerstarbeit. So mancher erkennt, dass die Verrücktheit ebenso die Weisheit sein kann, die um die Schändlichkeiten der Welt weiß und fasst aus Ärger den weisen Entschluss, verrückt zu werden, wie uns dies Heinrich Heine in seinen Reisebildern (1826) einst so schön erläuterte.
Genazinos Helden verwechseln zwar noch keine Windmühlen mit Riesen, aber intensive Leser sind seine Flaneure immer. So ist eine weitere wichtige Faktur seiner Erzählungen die Autoreferenzialität. Auch Gerhard Warlich nimmt immer wieder auf sich selbst und damit auf die von ihm selbst erzählte Geschichte Bezug. Dies Mise en abyme, dies Spiel im Spiel lockt Paradoxien geradezu an. Und Paradoxien sind eben Verrücktheiten und keine Wahrheiten. So entrückt sieht man mehr, und Genazino ist darin ein Meister dieses Mehr (Meer) der Verrücktheiten die unser Dasein bei genauerem Beobachten tatsächlich prägen, in Darstellung zu bringen.
Wilhelm Genazino kam 1943 in Mannheim zur Welt, von 1977 bis 1979 erschien die Abschaffel-Trilogie in der Genazino das Leben eines Büroangestellten porträtierte, der nicht so recht funktionierte. Erst nach diesem Bucherfolg legte Genazino das Abitur 1982 ab und studierte von 1984 bis 1989 Germanistik in Frankfurt. Er starb im Alter von 75 Jahren 2018 in Frankfurt.
23. Mai 23
Das Glück der anderen
Von Stuart O‘ Nan
Deutsch von Thomas Gunkel
Erstmals erschienen 1999 im Original unter dem Titel A Prayer for the
Dying
deutsche Ausgabe 2001 im Verlag Rowohlt
Der gelernte Ingenieur Stuart O’ Nan befasst sich von jeher in seinen Romanen mit der
amerikanischen Mittel- und Unterschicht. Dabei schildert er seine Figuren präzise und legt Wert auf Details.
Das Glück der anderen spielt nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Jacob Hansen hat es in die „sterbende alte Bergarbeiterstadt“ Friendship in Wisconsin verschlagen. Die Erinnerung an entsetzliche
Kriegserlebnisse wird er nie mehr los. Statt zu reiten, fährt er lieber mit dem Fahrrad oder mit der Draisine, denn beim Geruch eines Pferdes muss er daran denken, wie er sich im aufgerissenen Leib
eines gerade getöteten Pferdes wärmte. In Friendship fungiert Hansen als Sheriff, Prediger und Leichenbestatter zugleich. Doch eines Tages bricht eine Diphterie aus, eine Seuche biblischen Ausmaßes,
das den Vergleich mit Hiob mehrfach im Roman anklingen lässt. Jacob Hansen verliert erst sein kleines Kind, dann seine Frau, und am Ende alle Bewohner des Dorfes. Am Ende ist er der einzige
Überlebende dieser Apokalypse.
Der gottesfürchtige und stille, eher in sich gekehrte Held hadert stets mit sich und den
seinen. Freund und Feind werden sich mit zunehmender Dramaturgie der Seuche gleich. Am Ende ist der Tod der große Gleichmacher. Die medizinischen Möglichkeiten sind eingeschränkt. Dr. Guterson – der
einzige Arzt des Dorfes fällt der Seuche ebenfalls zum Opfer.
Obwohl ihn der Arzt anleitete, die Leichen nicht zu berühren, hält sich Jacob nicht daran, erfüllt seine Pflicht als Leichenbestatter solange es geht mit größter Sorgfalt. Vermutlich brachte er so
die Erreger in sein eigenes Haus. Warum er nicht daran starb, welche Abwehrkräfte ihn schützten, bleibt unklar. Der 1999 in den USA erschienene Roman nimmt so ein globales Ereignis vorweg, das 20
Jahre später erschien. Ich frage mich, was der Autor (Jahrgang 1961) dazu zu sagen hätte.
Der Epidemiologe Dr. Georg Schiller von der TU Düsseldorf erklärt es uns so:
„Der Roman zeigt, dass es nicht allein darauf ankommt, welche Regeln und Gesetze man gegen die Ausbreitung der Epidemie erlässt: man muss die Menschen auch emotional erreichen, ihre Sprache sprechen. Ihnen vor Augen führen, warum Kontaktverbot Leben rettet! All das ist Jacob nicht gegeben. Seine Kirche ist leer. Er spricht mehr mit sich selbst als mit den anderen.“
Die Regeln, die Jacob erlässt, sind alle durchaus sinnvoll. Aber sie werden von der Gemeinschaft nicht getragen und sind deshalb das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Friendship hin Friendship her.
Dr. Schiller erläutert weiter: „Als Sheriff handelt er im Namen des Gesetzes, als Prediger im Namen der Moral und als Leichenbestatter im Namen der Tradition. Aber das Unheil, das heraufzieht, zeigt uns Lesern, was Jacob nicht erkennt: die drei Ämter orientieren sich an ganz unterschiedlichen Vorgaben und bilden keinen gemeinsamen Nenner. So verstrickt sich Jacob immer mehr in Widersprüchen und wird ein Täter wider Willen.“
Die Parallelen zur vergangenen Corona-Pandemie sind offensichtlich: medizinische, ökonomische
und soziale Notwendigkeiten im Widerstreit. Wie lange gilt ein Kontaktverbot, das Menschen in den wirtschaftlichen Ruin treibt? Was verlieren wir, wenn wir schwer Erkrankte alleine sterben lassen? Wo
sind die ökonomischen und humanitären Grenzen der Risikominimierung? Oder gibt es keine?
Du durchforscht dein Gedächtnis nach einer Parabel über Stärke und Gottvertrauen. Abraham und Isaak fallen dir ein, doch darüber hast du erst letzte Woche gesprochen. Hiob ist bereits
überstrapaziert. Lot. Du schüttelst den Kopf und gehst weiter (Seite 83). Jacob findet keine passende Geschichte, weiß nicht, was er seinen Schäfchen sagen soll. Am Ende kommt nur noch der
Totenglöckner zu seiner Predigt. Irgendwann kann Jakob die Toten kaum noch beerdigen. Am Beispiel des Todes der Kuh Cynthia wird der ganze Horror offensichtlich. Erst als er ihr in den Kopf schießt
kann er ihr Leben beenden. Am Ende heißt es lakonisch: Du tust, was getan werden muss. Ein Westernzitat, das in jedem zweiten Western einer der Helden einmal sagt.
Die Perspektive des Romans war zunächst gewöhnungsbedürftig. Doch irgendwann war diese merkwürdige Distanz zum Helden (warum erzählt er es nicht in der Ich-Form?) durch das „Du“ sogar intimer als das Ich. Zumindest ging es mir so beim Lesen. Denn ich war mit diesem Du irgendwann ein Begleiter von Jacob, fast ein Kommentator seiner Handlungen. Das Präsens wirkte dabei natürlich mit und machte die Erzählung unmittelbarer. Die Vergleiche mit Albert Camus Die Pest oder mit Nemesis von Philipp Roth liegen nahe. Drei unterschiedliche Helden, die aber eines gemeinsam haben, einen Willen es gut zu machen, zu helfen, ihren Job zu machen. Ohne Aussicht auf Erfolg. Man tut, was man tun muss. Das muss ich auch der eine oder andere Arzt oder Ärztin gedacht haben, als er oder sie eine Triage-Entscheidung zu fällen hatte. Wer darf leben? Wer muss sterben. Man tut, was man tun muss. Das männliche Generikum dabei ist insofern interessant, da die Aussichtslosigkeit des Kampfes (irgendwer stirbt so oder so) ein Kriegstopos ist.
Wie auch immer. Ich habe diesen Roman im positiven Sinn erlitten, konnte mich mit dem Helden durchaus identifizieren. Die Rezensionen waren allerdings sehr gemischt. Und auch das kann ich zum Teil nachvollziehen.
In seinem Roman „Das Glück der anderen“ schilderte Stewart O’ Nan in einer kargen Sprache ohne jede Sentimentalität ein Horrorszenario. Dabei verwendet er für seine Erzählerfigur die unübliche zweite Person Singular und ließ uns gewissermaßen an den Selbstgesprächen des Protagonisten teilhaben. Angeregt zu diesem Buch wurde Stewart O’Nan durch einen Tatsachenbericht über eine Epidemie in Wisconsin (Michael Lesy: Wisconsin Death Trip, 1973). Witziges Detail dazu: Es gab auch 1973 Hamsterkäufe und das Toilettenpapier ging aus. Das lag aber vor allem an einem Scherz des Talkmasters John Carson, der 1973 als einen Scherz verkündete, jetzt ginge in den USA auch noch das Toilettenpapier aus. Kurz darauf kam es zu Hamsterkäufen und es ging wirklich aus. Zuvor gab es noch reichlich Toilettenpapier.
Stewart O’Nan wurde 1961 in Pittsburgh geboren und wuchs in Boston auf. Er arbeitete als
Flugzeugingenieur und studierte Literatur. Für seinen Debütroman „Engel im Schnee“ wurde er 1993 mit dem William-Faulkner-Preis ausgezeichnet.
24. Mai 23
Bevor der letzte Zug fährt
Von Penelope Mortimer
Original Daddy’s Gone A-Hunting
Aus dem Englischen von Kristine Kress, 2023 im Verlag Dörlemann
Wie kleine Eisberge halten alle ein helles, strahlendes Gesicht über Wasser, doch unter
der Oberfläche, viele Faden tief getaucht in Müßiggang, verbirgt jede ihre eigene, vereinsamte Persönlichkeit... Zusammengeschlossen könnte ihre Energie eine Revolution auslosen, halb Südengland mit
Strom versorgen, ... und eine Kaffeetasse könnte explodieren - ohne jeden Grund, beschreibt die
walisische Tochter eines anglikanischen Klerikers den unterschwelligen Horror eines britischen, typisch-britischen Hobbit-Dorfes, genannt Common. Die gebürtige Penelope Fletcher war verheiratet mit
dem Barrister John Mortimer, der den berühmten Anwalt Horace Rampole erschuf, ließ sich aber nach zahlreichen außerehelichen Affären 1971 wieder von ihm scheiden. Der Verlag Dörlemann hat nun
einen 1958 erschienenen Roman von ihr wieder aufgelegt. In der gelungenen Übersetzung von Kristine Kress schildert Mortimer eine Mutter, die um ihre Tochter kämpft und zugleich gewinnt und verliert.
Ihre Tochter Angela wird mit grade 18 Jahren schwanger, ähnlich wie ihre Mutter Ruth. Um ihr das Schicksal einer tristen Ehe mit einem exorbitanten Langweiler zu ersparen (wie sie es erlebt)
arrangieren sie gemeinsam eine Abtreibung in einer zutiefst bigotten Gesellschaft. Selten habe ich den Horror der Langeweile so brillant geschildert bekommen. Es ist diese Langeweile ja eines der
letzten Tabus unserer Gesellschaft. Daher ist es gar keine Überraschung, dass diese Buch inmitten unserer roboterhaften Leistungsgesellschaft erscheint. All die jungen Frauen, die zwischen Karriere
und Workout ein zutiefst unmenschliches Leben führen müssen, werden diesen Roman nicht lesen. Was schade ist. Die junge Mutter Ruth führt ein ebenso sinnentleertes Leben, wird dominiert von einem
immer fetter werdenden Zahnarzt, der die ganze Woche in fremden Mäulern herumstochert. Ihre beiden Jungs sind im Internat – wie sich später herausstellt auf Bestreben ihres Göttergatten, der wohl
eifersüchtig war.
Während Ruth um die Zukunft ihrer Tochter kämpft, unterhält ihr Göttergatte eine Affäre mit der pausbäckigen Schauspielerin Maxine.
Flotte Dialoge werden mit den Gedanken von Ruth unterfüttert. Ruth ist tief depressiv, kommt kaum noch aus dem Bett, als der Brief ihrer Tochter sie aufweckt. Die Nachricht von Angelas Schwangerschaft ist ein Weckruf. Der Spießrutenlauf bis zur Abtreibung bei dem jüdischen Arzt, der auch noch Dr. Fickstein heißt, wird minutiös und quälerisch beschrieben. Es ist unmenschlich. Angelas Samenspender Tony schreibt einen Brief an Ruth, da tut er sich auch noch selber leid.
Endlich, nach quälendem medizinischem Spießroutenlaufen, ist es so weit. Dr. Fickstein erklärt
sich bereit, den Schwangerschaftsabbruch bei Angela vorzunehmen. Doch es am Weihnachtstag. Warum? Weil Dr. Fickstein in den Urlaub will, und Angela es doch langsam eilig hat.
Ruth ist vollkommen ambivalent. Es kommt ihr auch wie eine Hinrichtung vor. Aber es ist andererseits auch eine Rettungsaktion.
Erst zehn Jahre nach Erscheinen des Romans wurde in England der Schwangerschaftsabbruch legalisiert.
Der Originaltitel bezieht sich auf die Melodie einer Spieluhr, die Ruth kauft, um sie Baby (die nie mit Namen genannt wird von ihrer Mutter Jane) zu schenken. Allerdings ist Baby noch zu klein dafür, würde die Spieluhr nur kaputt machen. Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Protagonisten mit der die Spieluhr im Laufe des Romans rezensiert wird, lassen dabei auch Rückschlüsse auf die Figuren zu. Das Schlaflied der Spieluhr schildert Daddy auf der Jagd nach einem Kanninchenfell, in das das Baby schön eingewickelt wird. In einer früheren Version von 1736 schildert das Lullaby die Mutter, die zum Melken gegangen ist, die Schwester ist verrückt geworden, der Bruder ist gegangen, um Haut zu kaufen um das Baby Bunting einzuwickeln.
Wie auch immer. Der deutsche Titel bezieht sich dann eher auf qualvollen Zugfahrten in die Stadt. Montags früh fahren die Männer in ihren Kanninchenbau (genannt Arbeitsplatz) und am Freitagabend wieder nach Hause um der häuslichen Langeweile mit vielen Gin-Tonics zu entkommen.
Sollte dieses öde Leben auch das Schicksal von Ruths Tochter werden? Das reißt die depressive
Mutter aus ihrer Lethargie.
Und am Ende ist sie älter geworden. Die Tochter geht ihrem freien Leben nach.
Die Autorin Penelope Fletcher wurde ebenfalls früh mit 18 Jahren schwanger, hatte bald sechs Kinder zu versorgen und eine unglückliche von Affären gezeichnete Ehe zu durchstehen. Ihr durchaus feministischer Roman nimmt einiges vorweg und dürfte Ende der 1950er durchaus ungewöhnlich, ja skandalös gewesen sein. Auch die Darstellung der Depression und vor allem der Umgang mit ihr (mit Ruth in der Depression), diese Bevormundung durch eine Aufpasserin und einem von seiner eigenen Arbeit eher angewiderten Arzt, das erinnerte mich auch an die Glasglocke von Sylvia Plath.
Wer aus der Reihe tanzt, wer das allgemeine Glück so nicht empfindet, wer andere Perspektiven sucht (einer perspektivlosen Eigenheimidylle), der wird entweder depressiv und eine Heldin.
So habe ich den Roman überraschend gerne gelesen. Vor allem auch, weil die Autorin einen wunderbaren Humor hat und dieser Kontrapunkt zur öden Idylle ist sicher eine besondere englische Note. Denn das ist schon noch ein anderer Horror, als irgendwo am Münchner Stadtrand vor sich hin zu gammeln. Denn die Münchner Vororte haben keinen Humor. Mortimers Figuren sind heute durchaus Topos des 1950er Jahre Charmes. Von den Teddy Boys bis zu den Schnöseln die große Partys feiern und auch das Personal einladen. Dagegen ist der kleinbürgerliche Hamsterreichtum aus Knausrigkeit und verbissener Arbeitsmoral, den die Münchner Vororte kennzeichnen keinen Topos wert. Der Ausbau des Schienennetzes in diese Gegend verschwendetes Steuergeld und ein S-Bahn Streik wirkt geradezu lächerlich und ist der beste Witz, den man sich hierzulande noch vorstellen kann. Was soll das bewirken? Wenn hier der letzte Zug fährt, ist er leer.
05. Mai 23
Der erste Zug nach Berlin
Von Gabriele Tergit
Erschienen 2023 im Verlag Schöffling & Co.
Im 18. Kapitel der düsteren Satire von Gabriele Tergit (Klarname: Elise Reifenberg, geb.
Hirschmann) treffen der Brite Morton und die junge Amerikanerin Moud in einem heruntergekommenen Haus auf einen ehemaligen Journalisten, der von den Nazis fast zu Tode gefoltert worden war und der
dann vor ihren Augen verstirbt. Möglicherweise war die Vorlage für den im Roman Reinhold genannten Figur der Rechtsanwalt Hans Litten, der erst nach langen Jahren der Demütigung auf tragische
Weise endgültig der Barbarei entfliehen konnte. Am 5. Februar 1938 erhängte er sich im Alter von nur 35 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war Litten schon fast zu Tode gemartert, hatte ein steifes Bein,
eingeschlagene Zähne und war auf einem Auge blind. Ähnlich wie Reinhold. Nur dass Reinhold in Tergits Roman noch einmal nach der Katastrophe auflebt, nur um weiter und für immer zu schweigen. Im Jahr
1924 erlebte Tergit als Gerichtsreporterin im Kriminalgericht Moabit ihren ersten Prozess. Und da waren Hitler und Goebbels Angeklagte und der Staatsanwalt hieß eben Hans Litten. Tergits
Berichterstattung über diesen Prozess führte dazu, dass sie auf die Gegnerliste der Nazis kam, ebenso wie Hans Litten. Tergit hatte – im Gegensatz zu Litten - Glück im Unglück. Als SA-Leute am 05.
März 1933 an ihre Tür klopften, hämmerten, schlugen, hielt die mit Eisenbeschlag verstärkte Tür stand und es gab noch eine kleine Schutzpolizei der Sozialdemokraten, die sie beschützte. Doch kurz
darauf floh sie mit ihrem Mann in die Tschechoslowakei und später nach England wo sie 1982 im Alter von 88 Jahren verstarb. Fünf Jahre vor ihrem Tod wurde ihr erster Roman Käsebier eroberte den
Kurfürstendamm (über Aufstieg und Fall eines vom Medienbetrieb missbrauchten Volkssänger) auf den Berliner Festwochen wiederentdeckt und neu aufgelegt. Doch offensichtlich wurde es dann wieder
für Jahre still um sie. Der Schöffling-Verlag hat sie nun erneut in einem größeren Rahmen wiederentdeckt (Die Effingers und So war es eben).
Der erste Zug nach Berlin schildert die Nachkriegssituation in Deutschland aus dem Blickwinkel einer jungen New Yorkerin, die zum ersten Mal überhaupt aus ihrem luxuriösen Umfeld in New York
herauskommt. „ich muss sagen, es war ein reiner Zufall, dass ich nach Deutschland kam“ beginnt sie den Roman. Die junge Maud schließt sich einer Gruppe Intellektueller des amerikanischen
Militärdienstes an. Deren Mission ist es, den Deutschen Demokratie zu vermitteln, einen Pressedienst zur reeducation aufzubauen. Im Gepäck hat Maud auch eine Schreibmaschine. „Als das
Flugzeug sich in Bewegung setzte und ich den guten alten friedlichen Kontinent verließ, um in das wilde, unkultivierte Europa zu fahren, da war mir doch sehr anders und ich ging in die Bar, um einen
Cocktail zu trinken.“
Kann es gelingen, eine so komplexe Situation wie die im Nachkriegsdeutschland mit einem derart naiven Point of View darzustellen?
Es gelingt. Tatsächlich, weil die naive Maud ihren Protagonisten einfach zuhört. Erst später im Roman beginnt Maud sich zu wandeln.
Im Stil einer geübten Reporterin baut Tergit eine beißende und düstere Satire auf. Der gesamte Pressedienst ist von Altnazis durchwandert, die Beteiligten sind zum Teil vom eigenen Nationalismus
getrieben und all die demokratischen Bemühungen wirken unglaubwürdig. „In Amerika und England hatte der public book trust das Veröffentlichen von Büchern unternommen. Er gab nur Bücher heraus,
bei denen man mit einer Million Leser rechnen konnte. Diese Bücher wurden dann dramatisiert, verfilmt und zu Hörspielen umgearbeitet, so dass jedes erfolgreiche Buch mindestens vierzig Millionen
Menschen erreichen konnte. Man hielt das allgemein für ein großes Glück, weil man nur auf diese Weise eine geeinigte Menschheit zu erreichen hoffen konnte.“ Eine alte Adlige entpuppt sich
als Kunsträuberin, die man leider nicht dafür belangen kann, weil sie die Rechnungen nicht aufgehoben hatte. „Wir werden nie erfahren, ob wir es mit Dieben zu tun hatten oder mit vornehmer
Aristokratie.“
An einer anderen Stelle heißt es: „Das war das Talent der Nazis, alle anständigen Menschen zu zwingen, sich ordinär zu benehmen, und sich selber als die Feinen hinzustellen.“
Die deutschen Protagonisten zeigen sich entweder als ehemaligen Nazi-Mitläufer, oder als
verprügelte und gefolterte Opfer, wenn sie nicht genügend wendehalsig waren. „Der Mensch will doch leben“ rechtfertigen sich die Mitläufer bis heute.
Die so genannten einfachen Leute waren entweder still vor lauter Angst oder vom pervertieren Heldenepos der Nazipropaganda verseucht.
"Wir wollten Frieden, wir wollten nur Ehre. Niemand wollte Krieg in Deutschland. Der Offizier ist nur ein Symbol des Opfers, zu dem wir immer bereit sein müssen.“ So erzählt es ein Berliner
Taxifahrer im Roman.
Die junge Maud macht im Laufe des Romans eine Entwicklung durch und erlebt in wenigen Monaten mehr und lernt mehr, als sie in den vergangenen 19 Jahren ihres Leben erfahren und gelernt hat. Und das
erzählt Tergit sehr glaubhaft, denn der anfangs eitle und selbstverliebte Tonfall der Icherzählerin verändert sich immer mehr und doch wird sie am Ende einen reichen jungen Amerikaner heiraten.
„Wir haben das modernste Flat in New York. Es hat nur künstliche Fenster, da es völlig air conditioned ist, von diesem Flat aus gesehen sieht es so aus, als ob alles in Ordnung ist, wenn nur alle
Knöpfe funktionieren.“
Gabriele Tergit schrieb diesen Roman in den 1950ern im englischen Exil unter ökonomisch schwierigen Bedingungen. Im Jahr 2000 war von Jens Brüning der Text in bereinigter Form herausgegeben worden. Im Nachwort der aktuellen Ausgabe verteidigt Nicole Henneberg sehr einleuchtend, warum diesmal das Originaltyposkript verwendet wurde, das mit vielen englischsprachigen Textpassagen vermischt ist (die im Glossar übersetzt wurden). So wirkt der sprachliche Sound besonders authentisch und wirkt nicht belehrend.
Ein beeindruckender Roman, den man dringend lesen sollte, auch weil er einiges auf den Punkt bringt, was auch heute noch nicht stimmt.
Im Impressum der Titelei steht noch der Zusatz „Der Roman enthält rassistische Sprache“.
In der Tat wirkt hier die Satire nur dadurch und würde man diese Sprache glätten, wäre der gesamte Roman völlig zerstört. Doch der Autorin Gabriele Tergit ist es absolut gelungen, diese satirische Tiefendimension des Textes zu transportieren, so dass der Leser es kritisch versteht.
Das etwas unglückliche Covermotiv von Getty Images zeigt eine typische junge Amerikanerin der 1950er Jahre. Auf der letzten Seite sehen wir über der Autorenvita noch ein Originalfoto der Autorin aus dem Archiv des 2011 verstorbenen Journalisten Jens Brüning der diesen Roman noch als Novelle betitelt im Jahr 2000 herausbrachte im Neues Berlin der Eulenspiegel-Verlagsgruppe.
17. April 23
Chamissimo
Von Sebastian Guhr
Erschienen 2022 im S. Marix Verlag
Nun war ich wirklich an der Schwelle der lichtreichsten Träume, die zu träumen ich kaum in
meinen Kinderjahren mich erkühnt, die mir im »Schlemihl« vorgeschwebt, die als Hoffnungen ins Auge zu fassen ich, zum Manne herangereift, mich nicht vermessen. Ich war wie die Braut, die, den
Myrtenkranz im Haare, dem Heißersehnten entgegensieht. Diese Zeit ist die des wahren Glückes; das Leben zahlt den ausgestellten Wechsel nur mit Abzug, und zu den hienieden Begünstigteren möchte der
zu rechnen sein, der da abgerufen wird, bevor die Welt die überschwengliche Poesie seiner Zukunft in die gemeine Prosa der Gegenwart übersetzt. So beschreibt Adalbert von Chamisso in seinem Buch „Reise um die Welt“ (1836, also zwei Jahre vor seinem Tod) seine Überfahrt von
Hamburg nach Kopenhagen, bevor er auf die Rurik ging und seine Weltreise antrat, die für ihn letztlich die Basis seines beruflichen Erfolges wurde. Wie es in Goethes Faust einmal so schön heißt:
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück / Genieß‘ ich jetzt den höchsten Augenblick. (Vers 11585 / fünfter Akt Faust II).
In den Revolutionswirren Frankreichs verlor Adelbert seine französische Heimat, das Schloss Boncourt wurde niedergebrannt und der verträumte Junge wurde Soldat in der preußischen Armee. Der 1983 in
Berlin geborene Autor Sebastian Guhr schildert das ganze Leben des Dichters und Naturforschers von seiner Kindheit auf Boncourt bis zu seinem beruflichen Erfolg in Berlin als Kurator und Mitglied der
Akademie der Wissenschaften. Guhr, der erstmals 2017 mit seiner Dystopie „Die Verbesserung unserer Träume“ (Luftschachtverlag) auf sich aufmerksam machte, erzählt mehr oder weniger konventionell,
chronologisch verlaufend und perspektivisch eng an der Person Adalberts. Einen kleinen Spaß erlaubt sich Guhr damit, dass er Schlemihls Grauen an entscheidenden Stellen immer wieder auftauchen lässt,
er damit Realität und Phantastisches miteinander verschmilzt. Aus einem verträumten aber auch neugierigen Kind wurde erst ein Dichter und dann ein Mykologe und Algenforscher. Sebastian Guhr schildert
den Weg dorthin sehr klar und entwirft ein lebendiges Bild dieser aufregenden Zeit des Vormärz. Zentrale Figuren deutscher Vorgeschichte tauchen auf, von einem Kurzauftritt Kleists, von einem sehr
lebendigen Bild E.T.A. Hoffmanns, dem besten Freund von Chamisso, fehlte mir eigentlich nur Fichte. Der Philosoph des Handelsstaates taucht zwar auf, aber (falls ich es nicht überlesen habe) nicht
seine Rolle als väterlicher Freund, wie ihn Chamisso selbst in seiner Reise um die Welt bezeichnete. Guhr arbeitet den warmherzigen Charakter von Chamisso sehr anschaulich heraus, seine
liberale Haltung, sein Antirassismus; gerade weil sein Charakter nicht ideologisch verbrämt ist, sondern authentisch und aufrichtig.
Es gibt eine Kurzgeschichte von Olga Tokarczuk (Peter Dieter), in der sie schildert, wie ein Mann noch einmal sein Herkunftsland in den Westkarpaten besucht, dort am Gipfel mit einem Bein
auf der tschechischen mit dem anderen Bein auf der polnischen Seite verstirbt. Die tschechischen Grenzer finden die Leiche und schieben sie (weil sie keine Arbeit haben wollen mit der Leiche) ganz
auf die polnische Seite, später finden die polnischen Grenzer die Leiche und schieben sie – aus dem gleichen Grund - auf die tschechische Seite. Zwei Paar hölzerne Soldaten tragen Peter Dieters
hölzernen Körper bis in die Unendlichkeit von einer Seite auf die andere. So ihr Schlusssatz in der beeindruckenden Kurzgeschichte. Das verweist auch in ihrer Parabel auf Chamisso, der zwei
Nationen in sich trug und so zum Europäer wurde, dennoch stets hin und her schwankte. Die Weltereignisse vom Jahre 1813 (Befreiungskriege, A. d. A.), an denen ich nicht tätigen Anteil
nehmen durfte – ich hatte ja kein Vaterland mehr oder noch kein Vaterland –, zerrissen mich wiederholt vielfältig, ohne mich von meiner Bahn abzulenken. Es ist daher auch das überzeitliche
Thema des Romans der Dichter als Brückenbauer. Als Chamisso beschließt, auf Hawaii zu bleiben verweist das schon früh auf spätere Aussteiger-Phantasien. Später im Trott seines beruflichen Aufstieges
mit viel bürokratischer Arbeit, bedauert Chamisso ein wenig, dass er sich hat überreden lassen, wieder auf die Rurik zu gehen und vermeintlich nach Hause zu segeln.
Weiter lässt Sebastian Guhr nicht aus, die industrielle Revolution zu schildern, die durch die Dampfmaschine letztlich den modernen Kapitalismus von England nach Europa brachte. Revolutionen prägten
das Leben von Adalbert von Chamisso. Und zwischen den sich bekämpfenden Nationen und Gesinnungen, prägten ihn vor allem die Freundschaften zu Hitzig, Varnhagen, Hoffmann. Seine Liebe zur Hitzigs
Pflegetochter Antonie Piaste. Chamisso folgte ihr nur ein Jahr später in den Tod.
Eine schöne Stelle aus seinem Buch Reise um die Welt möchte ich hier noch zitieren, weil sie auch ein Befund ist, der aufzeigt, wie wichtig migrierender Intellekt für eine Nation (egal welche) ist:
Ich finde in einem Briefe, den ich aus Brasilien nach Berlin schrieb, eine Entdeckung verzeichnet, die kaum in eine Reisebeschreibung gehören mag, die ich jedoch hier einbuchen will, weil es mir neckisch vorkommt, daß grade ein geborener Franzose um die Welt reisen mußte, um sie fernher den Deutschen zu verkünden. Ich habe nämlich auf der Fahrt nach Brasilien in der »Braut von Korinth«, einem der vollendetsten Gedichte Goethes, einem der Juwelen der deutschen und europäischen Literatur, entdeckt, daß der vierte Vers der vierten Strophe einen Fuß zuviel hat!
Daß er angekleidet sich aufs Bette legt.
Ich habe seither keinen Deutschen, weder Dichter noch Kritiker, angetroffen, der selbst die Entdeckung gemacht hätte; ich habe Kommentare über die »Braut von Korinth«, vergötternde und schimpfende, gelesen und darin keine Bemerkung über den angeführten überzähligen Fuß gefunden. – Die Deutschen geben sich oft so viel Mühe, von Dingen zu reden, die sie sich zu studieren so wenig Mühe geben! –
Insgesamt hat Sebastian Guhr einen unterhaltsamen, leicht und flüssig zu lesenden Roman geschrieben, der sehr nah an der Lebensgeschichte seines Protagonisten liegt und ein erhellendes Licht auf diese spannende Epoche wirft. Bedenkt man, dass E.T.A. Hoffmann in Königsberg Vorlesungen von Immanuel Kant anhörte, bedenkt man den herrlichen Auftritt von Jean Paul, der nicht nur mit seiner komplexen Literatur eine Bereicherung war, sondern als herausragender Psychologe den Beginn des 20. Jahrhunderts (Phänomenologie) vorwegnimmt. Bedenkt man, dass aus all diesen Geistesgrößen letztlich 1848 hervorging. Auch Turnvater Jahn und seine krude Ideologie wird von Guhr herrlich eingebaut und der in jeder Revolution und jeder Solidaritätsbekundung als Gefahr mitschwingende Nationalismus aufs Korn genommen. Der Humanismus von Chamisso ist daher so bemerkenswert, weil er kein aggressiver Humanismus ist, sondern Humanismus mit dem Herzen viel mehr, als mit dem Verstand.
Ein halbes Hundert mir entrauschter Jahre
Hat nicht mein Herz berührt, nur meine Haare.
(Adalbert von Chamisso 1831)
15. März 23
Die Zukunft der Schönheit
Von F.C. Delius
Erschienen 2018 im Verlag Rowohlt
Aufsteigend aus der Tiefe des Musiktraums, erinnerte sie sich, wie kindisch sie noch war, als sie Walter schon liebte. …Wie große Regentropfen klatschte sein Gefühl in die Tasten. Sie erriet sofort, woran er dachte: das Kind. Sie wußte, daß er sie mit einem Kind an sich anbinden wollte. Das war ihr Streit alle Tage. Und die Musik hielt keinen Augenblick still, die Musik kannte kein Nein. Wie ein Netz, dessen Umgarnung sie nicht bemerkt hatte, zog sich das rasend schnell zusammen. Da sprang Clarisse mitten im Spiel auf und schlug das Klavier zu, so daß Walter kaum die Finger retten konnte. (aus Kapitel 38 MoE, Band I, Robert Musil).
Im Gegensatz zu Clarisse in dem berühmten Roman von Musil hält Delius die Energie der Musik
aus (Die Wahrheit marschierte, es war unerträglich, die Töne marschierten, unerträglich, und doch öffnete ich alle meine Sinne für diese schräge Musik, der Wind wechselte). Walter in Musils
Roman spielte Wagner. Vor hundert Jahren war das der Donnerknall der Musik und aus der Literaturgeschichte ist die Wirkung Wagners kaum wegzudenken. Das Verhältnis von Jazz zur Literatur ist
mindestens so facettenreich. Inszenierung und Imitation von Musik hin zu einer Wortmusik kennen wir verstärkt aus der Lyrik, die ja intermedial viel stärker als die Prosa mit Musik verknüpft ist. In
der Prosa sind Rhythmen, Stimmungen und Polyphonien erst mit der berühmten Kopfkamera des inneren Monologs (Joyce) hervorgetreten. Hervorzuheben im deutschen Sprachraum ist sicher Wolfgang
Koeppen der die Evokation durch Musik in seiner Synkretismus-Poetik vielfach verarbeitete, Aus der Kirche, aus ihren noch nicht wieder eingesetzten Fenstern grollte unter den Händen des übenden
Organisten die Orgel, erhob sich das Stabatmater. Stormy-Weather: die Musik der Kinoorgel wehte, wogte, bebte und rasselte. Sie wehte, wogte, bebte und rasselte aus allen Lautsprecher.(Tauben im
Gras, wo Koeppen quasi das Great American Songbook durchzitiert).
Oder denken wir an Adornos Kritik an der modernen Musik als Warenhauskultur (Aufklärung als Massenbetrug). Laut und emotional rührt diese Musik an unseren niederen Instinkten. Doch damit
bricht der Free-Jazz. Schließlich sind seine Dissonanzen und strukturell eingewobenen formalen Zitate eher einer Scherzkultur entsprungen, als einer Warenhauskultur. Miles Davis sagte einmal über
seinen Konkurrenten Ornette Coleman, dass dessen Spiel respektlos sei gegenüber denen, die ihre Instrumente beherrschen. Und in der Tat! In Colemans letzter Scheibe Sound of Grammar spielt Coleman
Geige, er spielt viel Geige. Dabei so genial schlecht, dass man aufspringen und „Chapeau“ rufen will auf dass das Geigen nie enden möge. Auch in der Literatur ist die Geige manchmal ein disruptives
Instrument.
Der Stotterer und Meister des Understatements setzte sich in dieser Erzählung mit einem inzwischen berühmt gewordenen Konzert in NYC auseinander. In seinen improvisierten Absätzen entführt er uns in Slugs' Saloon, einen Jazzclub in der 242 East 3rd Street, zwischen Avenue B und C im East Village von Manhattan, der von Mitte der 1960er bis 1972 in Betrieb war. Die Location in einem damals heruntergekommenen Teil von New York City beherbergte zunächst ein ukrainisches Restaurant und eine Bar, später eine Bar, die als Treffpunkt für Drogendealer diente. 1964 eröffneten Robert Schoenholt und Jerry Schultz diesen Club und nannten es zunächst "Slugs' Saloon", wobei die "Slugs" (Schnecken) eine Anspielung war auf die "dreizentrierten Wesen" und "irdischen dreihirnigen Wesen" aus dem Buch Beelzebubs Geschichten an seinen Enkel von George Gurdjieff, einem russisch-armenischen Mystiker der darin einen vierten Weg der Erkenntnis beschrieb(1924 erschienen). Aufgrund der Vorschriften von New York City musste das Wort "Saloon" aus dem Namen gestrichen werden. Der Veranstaltungsort wurde aufgrund seiner östlichen Lage im East Village "Slugs 'in the Far East" genannt. Der Innenraum des Clubs war länger als breit und der Musikpavillon ganz hinten. Die Bar befand sich auf der linken Seite, wenn man den Veranstaltungsort betrat. Sun Ra, Ornette Coleman, Ronny Rollins und andere Berühmtheiten traten dort als Musiker auf. Am 19. Februar 1972 wurde der Musiker Lee Morgan im Slugs von seiner Ehefrau Helen Moore erschossen, dies und durch immer mehr städtische Unruhen führten schließlich zur Schließung der Bar. Albert Aylers Leiche fand man schon zwei Jahre früher im November 1970 am East River. Angeblich hatte er Suizid begannen, zuvor sein Saxophon in den Fernseher geworfen. Ein letzter disruptiver Befreiungsschlag. Nach einer anderen Theorie wurde er ganz simpel von Drogendealern ermordet, denen er noch Geld schuldete. Ayler wurde 34 Jahre alt.
Eingewoben in die Textimpros hat Delius dabei seine eigene Entwicklungsgeschichte als junger
Autor. Von seinem Vater, dem Kissenwerfer, in den Zustand des Schreibenden geworfen, von unerfüllter Liebessehnsucht und vom Glück der Erfüllung, von Dissonanzen und klaren Linien die irgendwie
gleichzeitig mit der Idee des Free-Jazz verknüpft sind, von Krieg in Vietnam, vom Vater als Kriegsheimkehrer, von alten Nazis in Kohrbach, von den Leiden des jungen D. im ältesten Gymnasium Hessens,
und wieder der Bogen zur Musik, zur Befreiung durch Zersetzung. Die Vergangenheit gehört ins Feuer… was war schon die Herkunft gegen die Zukunft – beschreibt es Delius. Das kehlige,
zupackende Saxophon, …mit seinen jagenden Läufen vermischt sich tonal mit den Erinnerungen an Choräle und Katechismen des damals noch jungen Autors. So ist die Anordnung eines erzählenden Ichs
von einem jungen Ich das sich wiederum erinnert an ein noch jüngeres Ich schon an sich raffiniert. Und trotz (oder gerade aufgrund) der strukturellen, assoziativen Anordnung des Textes lassen wir uns
beim Lesen tragen, sind mit Delius im Slugs und hören die quietschende Geige und das aufheulende, kratzende Saxophon wenn die Band der Aylers Initiation spielt oder When the Saints go marching
in zerstört und doch neu macht. Transmutationen, überall bricht das Alte ab und das Neue auf. Diese Zukunft, diese Affirmation spiegelt die 68-Generation weit mehr, als ein bekifft am Boden
liegender Allen Ginsberg, dessen Beats vom Free-Jazz längst zerlegt und dekonstruiert waren.
Der junge, werdende Autor der sich auf dem elektrischen Stuhl der Gruppe 47 präsentieren muss, wo gerade Die Glasglocke von Sylvia Plath (1963) erschienen war, der mit dem elektrischen
Stuhl beginnt, der dem Ehepaar Rosenberg wegen Spionage drohte. Elektrifizierung auch durch Handkes Startschuss der Pop-Literatur (I Am The Greatest Poet Of All People, damn), dessen unterirdischer
Gipfel zuletzt im Römer mit einem Haarschnitt vollendet wurde. Es gehört zum Understatement des Autors Delius, dass er sich nicht in die Reihe dieser Großen stellt, sich eher wundert und verstört auf
die astrologische Weissagung seiner Tante reagiert. Delius spricht vom Tabuwort Glück, das war verdächtig. Der Leidende ist wahrer und wahrhaft leidend entwurzelt uns der Aylersche
Free-Jazz, befreit uns von den traditionellen Klängen, den Harmonien, den Schlagern, den Kriege huldigenden Märschen.
Es ist eine Menge in dieser Erzählung, fast schon zu viel und doch erscheint es nicht pompös, nicht aufgeladen. Aufgeladen vielleicht nur im Sinne der Energie, die im Slugs pulst. Und die drei
Weißbrote in East Village hören das Hämmern, Klagen und Schreien sterbender Soldaten. Und gleichzeitig den Aufbruch der Freiheit.
28. Februar 2023
Armand
Von Emmanuel Bove
Übersetzt von Peter Handke
Emmanuel Bove kam 1898 in Paris zur Welt. Sein Vater Bobovnikoff floh aus Russland. Der
Legende nach soll er ein wichtiges Mitglied der anarchistischen Bewegung gewesen sein und vor der zaristischen Polizei geflohen; wahrscheinlicher ist, dass er aufgrund der zahlreichen Pogrome nach
dem Attentat auf Zar Alexander II, das man den Juden unterstellte, aus Russland floh. Er kam ein Jahr vor Emmanuels Geburt in Paris an und hatte während seiner Flucht Deutsch gelernt, da er
Deutschland zu Fuß durchquerte. So lernte er Henriette Michels kennen, Emmanuels Mutter, eine deutschsprachige Luxemburgerin. Emmanuel wuchs in großer Armut auf, immer wieder mussten sie die Wohnung
wechseln, weil sein Vater die Miete nicht bezahlen konnte. Doch dann lernt sein Vater Emily Overweg kennen, eine reiche Engländerin. Emmanuel lebt nun abwechselnd bei ihr und bei seiner Mutter. Emily
ist Kunstmalerin und hat ein Atelier in der Rue Campagne-Premiere, ein Domizil für Künstler und Schriftsteller. Emmanuel lernt nun Tennis und Golf spielen, wird vertraut mit den literarischen Größen
Frankreichs. Mit dem Kriegsausbruch verliert Emily ihr gesamtes Geld, ihre Konten werden gesperrt und sie kann sich nicht mehr um Emmanuel kümmern, muss ihren eigenen Sohn durchbringen. Emmanuel
schlägt sich nun als Tellerwäscher, Kellner, Straßenbahnschaffner und Hilfsarbeiter bei Renault durch. Seine ersten literarischen Arbeiten entstehen nach dem Militärdienst Anfang der 1920er in Tulln
in Österreich. Dort lebte er einige Jahre mit seiner ersten Frau Suzanne Vallois. Meine Freunde (ebenfalls von Peter Handke übersetzt) wurde ein überraschender Erfolg. Präziser Stil mit
größter Verknappung, kein überflüssiges Gramm Wort: „Wenn ich aufwache, steht mir der Mund offen. Meine Zähne sind belegt: es wäre besser, sie am Abend zu putzen, aber das bringe ich nicht über
mich. In meinen Augen eingetrocknete Tränen. Die Schultern tun mir nicht mehr weh. Ein Haarschwall bedeckt meine Stirn. Mit gespreizten Fingern streiche ich ihn zurück. Ohne Erfolg: wie die Seite
eines neuen Buches richtet er sich auf und fällt mir wieder über die Augen.“
Man verglich Bove mit Proust und Dotojewski. In einer Kritik hieß es: Der ganze Schmerz unseres Lebens, dieser Schmerz, den wir nicht immer wahrnehmen und den wir zu ersticken suchen, doch
der am Ende immer siegt, ist in diesem großartigen Buch enthalten.“ Der Roman Meine Freunde handelt von einem Kriegsinvaliden, der verzweifelt Freunde sucht und immer wieder scheitert,
dabei lernt er auf seinen Streifzügen Prostituierte, einen lebensmüden Matrosen etc. kennen.
Im Jahr 1922 kehrt er wieder zurück nach Paris. 1925 entstand Armand. Samuel Beckett zählte zu seinen größten Verehrern, Rilke ebenfalls. Bove war starker Raucher (100 Zigaretten
am Tag) In den 1930ern verschlechtert sich sein Gesundheitszustand immer mehr. Hinzu kommt die Weltwirtschaftskrise, der Kriegsausbruch. Im März 1940 wird Bove in eine Gießerei zur Kriegsproduktion
eingezogen. Die schwere Arbeit schwächt seinen Gesundheitszustand weiter. 1942 verläßt Bove mit seiner zweiten Frau Louise Ottensooser die erdrückenden Zustände in Paris und flieht nach Algier.
Danach gerät er in Vergessenheit. Als er wieder nach Frankreich zurückkehrt, ist er bereits schwer krank und als Autor nicht mehr angesagt.
Am 13. Juli 1945 stellt Docteur Louis Pictet in der Pariser Avenue des Ternes, Haus Nummer 59, einen Totenschein aus: „Monsieur Emmanuel Bove verstarb heute Morgen gegen 8 Uhr an Auszehrung und Herzversagen, das durch eine Serie äußerst heftiger Sumpffieberanfälle herbeigeführt wurde.“ Der Tote ist 47 Jahre alt und wird auf dem Friedhof Montparnasse beigesetzt.
Es war Mittag. In der Kälte erschien die Sonne kleiner. …Meine Aufmerksamkeit war wie jene
der Kinde: sie richtete sich auf alles, was sich bewegte.
So beginnt der Roman Armand, in dem der Titel gebende Held auf einen alten Kriegskameraden trifft (Lucien) und
dies verändert sein Leben zu seinem Nachteil. Die Wechselhaftigkeit des Schicksals spiegelt auch das Leben des Autors wider. Die Straßen waren leer. Das Sonnenlicht in ihnen verblaßte, ohne aber
zu verschwinden….Ich nahm dann die Straße, die abwärts führte. Kinder spielten da Ball, die kleineren weiter oben, die größeren weiter unten, damit beide die gleichen Chancen hätten. So
verschränken sich Anfang und Ende des Romans.
Die Klarheit der Sprache, die Genauigkeit und Präzession der Beobachtung. All das liegt auch Peter Handke. Ihm und Samuel Beckett ist es auch zu verdanken, dass er allmählich wieder entdeckt
wurde. Ein Schriftsteller ohne Ideologie, dessen literarische Hauptaufgabe es war, ohne große Töne auszukommen.
Ich habe oft bemerkt, dass man sehr schnell aus dem Auge verliert, was es an Armseligem birgt. Aber merkwürdig – man meint dann, die Leute würden nicht dieselbe Entwicklung durchmachen wie man
selbst, sie würden nicht auf die oberflächlichen, plötzlich auftauchenden Veränderungen hereinfallen. Das Gegenteil ist der Fall. Doch geht es nicht allein um die Leute. Es geht auch um den
Staatskörper, die Justiz, um alles. Man bemerkt dann, dass auf dieser Welt alles oberflächlich ist. Diese Sätze schrieb Bove kurze Zeit vor dem Ausbruch des Krieges. Er lebte zu dieser Zeit in
Cap-Ferret, einer Halbinsel im Südwesten Frankreichs. Und in Meine Freunde heißt es einmal: „Seltsam wie alles weiter geht, ohne einen selbst.“
Ich hatte den Roman Armand schon lange im Bücherregal stehen, hatte ihn irgendwann mal auf meinen Streifzügen durch moderne Antiquariate erstanden und das Lesen vertagt. Letztes Jahr musste ich dann für ein paar Monate meine Habseligkeiten in einem Selfstorage unterbringen. Das Durcheinander brachte mir dann den kleinen Roman wieder unter die Finger. Ich hatte ihn vergessen und nun las ich ihn ohne auch nur eine Pause einzulegen durch. In der Beschäftigung mit einem Autor, der ein Schattendasein führte (Ein Leben wie ein Schatten lautet der Titel der Bove-Biografie von Raymond Cousse und Jean-Luc Bitton) und dann diese vielen Anspielungen auf Licht und Schatten in dem Text selbst: Ein Taxi, beleuchtet wie ein Fiaker, fuhr an mir vorbei…Wir traten hinaus auf die Straße. Die Finsternis ließ mich mit den Augen zwinkern, wo wie zuvor das Licht…Die feuchten Gehsteige, schwarz wie neu, glänzten, mit weißen Steinchen dazwischen. Unauffällig, wie nebenbei erwähnt, überall auffindbar, in allen Beobachtungen finden sich diese Details einer wahren Farbenlehre.
Gegenüber den vielen sprachlichen Grobheiten die der Literaturmarkt heutzutage ausspuckt und anpreist, steht dieses schmale Buch wunderbar glänzend da, ohne zu blenden, ohne blenden zu wollen. Wenn Prosa und Poesie sich treffen in den Streifen von Sonnenlicht, das durch Rollos fällt und wie hinein geblasener Zigarettenrauch darin wieder abziehen.
Sorry, diese kleine Rauchermetapher war ich dem Kettenraucher Bove schuldig.
15. Februar 2023
Das glückliche Geheimnis
Von Arno Geiger
Erschienen 2023 im Verlag Hanser
Es ist nun das dritte Buch das ich von Arno Geiger gelesen habe. Der alte König in seinem
Exil und Unter der Drachenwand. Der Vorarlberger gelernte Philologe ist vier Jahre jünger als ich. In unserem Alter (über 50) sind vier Jahre ein Klacks, solange der Körper mitspielt.
Er schrieb eine Autobiografie. Und da sind dann vier Jahre wieder grundlegend für enorme Differenzen. Denn Arno Geiger gehört bereits zur Generation X, während ich noch in die Babyboomer-Generation
falle. Und die Generation X will gut verdienen und einen sicheren Arbeitsplatz, glaubt man der Wirtschaftswoche. Zentrales Thema von Geigers Leben scheint daher immer durch. Der Erfolg ist für ihn
ein Mittel zum Zweck für ein abgesichertes Leben. Dann kann er „hit the bottom“. Ohne Existenzangst. Diese Existenzangst durchzieht den ganzen Text. Dabei aber geht es nicht um Armut und Elend,
sondern um das Versagen. Die Grundlage von Geigers Autobiografie ist damit sein Gefühl, nicht versagt zu haben. Nun kann er sich im gesetzten Alter ein paar Lebensweisheiten leisten. Nicht, dass ich
dabei seine Erkenntnisse nicht auch genossen hätte. Ich habe einiges angestrichen und auch einiges wieder erkannt, was mich umtrieb oder sogar umtreibt. Daher war der Text für mich schon auch eine
willkommene Leichtigkeit. Und natürlich ist es legitim, seine Erfolge aufzuzählen in einer Autobiografie und es ist legitim, das eigene Weltbild darzustellen. Der Mehrwert von Autobiografien ist
immer die Zeitzeugenschaft. Und da waren es nur Andeutungen. Gegen Ende des Buches auf Seite 190 heißt es: „Früher hatten die Menschen, wenn sie besoffen waren, Karten gespielt und gesungen.
Heute saßen sie besoffen vor dem Fernseher.“
Also ich denke, Karten gespielt und gesungen wird immer noch, und der Fernseher läuft nicht immer. Wird mehr gesoffen? Tatsächlich ist der Alkoholkonsum seit den 1990ern wieder erheblich angestiegen.
Aber in den 1960ern und 1970ern war er so hoch, dass in dieser Zeit das Fernsehen regelrecht erfunden wurde. Heute läuft der Fernseher kaum noch. Streamingdienste haben ihn abgelöst. Nun. Ich
analysiere das nur mal so nebenbei, um damit klarzustellen, dass Arno Geiger auch ein wenig platt ist. Er zehrt von seinem guten Namen. Das ist auch nicht schlimm. Einiges war wirklich ein Genuss. So
auf Seite 177, als er über den Schlaganfall seiner Mutter und deren Verstummen schreibt: „Es war beklemmend, auf so brutale Art daran erinnert zu werden, dass wir nur ein Gelegenheitsbündnis mit der
Sprache eingehen und dass dieses ohnehin unzuverlässige Bündnis von heute auf morgen einseitig gekündigt werden kann.“
Wie fragil dieses Leben doch ist. „Das Leben ist eine Zumutung“, schreibt Geiger, als er über seinen Freund Werner nachdenkt, der auch schon tot ist. Es ist dieses Alter, wo man mit dem Tod zunehmend
konfrontiert wird, weil die Eltern sterben. Gerne hätte ich mehr über den Literaturbetrieb erfahren und weniger Statistik darüber, wie oft er mit K. geschlafen hat. Geigers Paranoia, seine Ängste
waren vielversprechend. Im Ansatz war dieser drohende Verlust der eigenen Persönlichkeit (Depersonalisation nennt es die Psychiatrie) spannend. Aber es lief ja dann alles wunderbar. Geigers
Streifzüge durch den Müll (der Aufhänger seiner Autobiografie) sind dann auch die besten Passagen. Ich bekam dabei selber Lust, mich auf den Weg zu machen, etwas zu entdecken, das andere wegwerfen.
Vor ein paar Monaten hatte ich selbst eine Reinigungsaktion und war oft auf dem Wertstoffhof. Ein skurriler Name für den Rest, den wir zurücklassen. Der Widerspruch sticht einen geradezu. Das
glückliche Geheimnis hatte damit auch einen für mich glücklichen Lesemoment. Aber Lebensbilanzen sind keine reale Zahl. Zu viele Stellen hinter dem Komma. Sie sind privat und die Ehrlichkeit, die
Geiger erwähnt (Aufrichtigkeit sei die Quelle aller Gedanken, Seite 132) ist eine Illusion. Was wir vielleicht hinbekommen, ist Fairness in den Fehlurteilen über uns und andere. Denn mit der
Ehrlichkeit ist das so eine Sache. Dazu braucht man auch das nötige Bewusstsein. Es reicht nicht, zu sagen, dass man hier und dort auch falsch lag. Es reicht nicht, wenn man seine Fehler einsieht. Es
ist viel entscheidender, dass man die Fehler die man immer noch macht und für richtig verkauft erkennt. Ehrlichkeit ist – wenn sie sich der Wahrheit wirklich stellt – unschön. Nicht wirklich
literarisch. Ehrlichkeit ist auch bigott, ambig. Sich zu bekennen ist ein altes Projekt. Schon Rosseau hat in seiner Autobiografie als zentrale Motivation das Bekenntnis vorangestellt
in Anlehnung an Augustinus. Goethe war insofern ehrlicher, als er seine Autobiografie Dichtung und Wahrheit nannte. Vor allem Schriftsteller – das immerhin hat Geiger ja auch selbst
eingeräumt – sind mimetisch unterwegs. Wirkung ist wichtig. Ehrlichkeit die auf Wirkung abzielt, ist bigott. Bekenntnis überlässt sich hier dem Urteil des Richters. Hier stehe ich, und konnte
offenbar nicht anders. Aber auch Luther hätte jederzeit anders gekonnt, wenn er gewollt hätte. Schön ist von Geiger die Zufälligkeit, dieses von Gelegenheiten geprägte Leben dargestellt.
Der unsichtbare Müll sammelnde Geiger wird hier sichtbar. Der sichtbare Romane schreibende Geiger verschwindet hinter seinen Buchtiteln. Seine sanfte Kritik an der Arbeitsteiligkeit und der
Werthaltigkeit von Berufsbezeichnungen hinter der die polyvoke Persönlichkeit von Menschen und all ihre sozialen Rollen reduziert werden – nun gut. Ja. Stimmt schon. Kratzt halt nur die
Oberfläche. Für jemanden, der so tief in Mülltonnen kriecht würde vermutlich die Zielgruppe zu klein werden, wenn er alle Geheimnisse verraten würde. Es bleibt auf charmante Art an der Oberfläche.
Wir werden als Leser nicht in den Müll mit hineingezogen. Für uns Leser bleibt es schön sauber. Geiger hat sich die Hände gewaschen, bevor er sich für diesen Text an die Schreibmaschine
setzte.
Wie auch immer. Habs gern gelesen. Sympathisch, manches erinnerte mich an mein eigenes Erleben als Autor. In meiner Autobiografie wird es allerdings dann erfolgloser zugehen. Insofern spendete es mir Trost wenn Geiger schreibt: „Außenseiter sein hat auch sein Gutes. Wenn man auf der Straße steht, kein Ansehen hat in einem tieferen Sinn, nicht beachtet, nicht gesehen wird, nicht anwesend ist: wie schön.“ (Seite 190)
Aufmerksamkeit ist die Ressource unserer Zeit. Es bedeutet in der Tat, dass Verzicht auf Aufmerksamkeit ein glückliches Diäterlebnis evoziert. Es gibt allerdings – leider? Gott sei Dank? – eine Menge Menschen, für die ist so eine Diät nicht freiwillig. Bene qui latuit, bene vixit. Allerdings: Als Horaz das schrieb, hatte ihn Kaiser Augustus schon auf eine entfernte Insel abgeschoben. Daher kann das nur ironisch gemeint gewesen sein.
27. Januar 2023
Doppelleben
Von Alain Claude Sulzer
Erschienen 2022 im Verlag Galiani Berlin
„Geschichte“, schrieben die Brüder einmal in ihrem Buch Ideen und Gefühle (einer
Sammlung von Maximen und Kunstauffassungen) „ist ein Roman der stattgefunden hat, der Roman ist Geschichte wie sie hätte sein können.“
Hätte es so sein können, wie der Schriftsteller und gelernte Bibliothekar Alain Claude Sulzer es schildert? Im Falle des Dienstmädchens Rose Malingre und deren tragischem Fall, hält sich Sulzer an
den Roman Germinie Lacerteux aus dem Jahr 1865. Der ältere Bruder Edmond hat diesen Roman dramatisiert und er wurde dann 1889 im Odeon im 6. Arrondissement am linken Seine-Ufer
uraufgeführt. Da die Brüder Verfechter des aufkommenden Naturalismus waren, einer Kunstrichtung die sich der exakten, ungeschönten Beobachtung von Mensch und Natur verschrieben hatte, kann man wohl
davon ausgehen, dass Sulzers Quelle ein realistisches Bild lieferte. Auch die Tagebücher der Brüder dienten dem Schweizer Autor als Grundlage. So ist die Schilderung der Neurolues, an der Jules
bereits mit 39 Jahren verstarb in all seinen schillernden Symptomen ernst zu nehmen. Die Quellen sind daher unstrittig. Die literarische Umsetzung in eine moderne Erzählsprache ist Sulzer aber auch
gelungen. Doch eines ist dabei schwierig. Bei den Quellen, den originalen Texten der Brüder Goncourt handelte es sich um eigenständige literarische Leistung. Insofern hat mich das kleine, kursiv
gedruckte Nachwort ein wenig geärgert. So, wie sich die Brüder Goncourt die Freiheit herausnahmen, das Leben ihrer Magd Rose Malingre in einem Roman nachzubilden… habe ich mir erlaubt, einige
Episoden aus dem Leben der beiden Unzertrennlichen zu einer Erzählung zu verdichen…
Das ist nicht korrekt. Denn die Brüder Edmond und Jules hatten keine literarischen Vorlagen.
Vielmehr mussten sie selbst alles recherchieren und die Freiheit die sich Sulzer dabei nahm, war es eher kreativ abzuschreiben. Ich will das gar nicht schmälern, denn es war mit viel Genuss zu lesen
und in jedem Fall steckt viel Fleiß und auch viel selbstständiges Formulieren in dem Buch von Sulzer. Aber es ist doch ein erheblicher Unterschied darin, sich an schriftlichen Quellen zu orientieren,
anstatt alles ohne existierende Vorlagen aufzuschreiben. Ein großes Glück, dass die beiden Brüder das so brillant taten. Und sicher ein Glück, dass Sulzer diese Arbeiten neu entdeckte und für uns
aufbereitet hat.
Nebenbei: Edmond stiftete keinen Literaturpreis, sondern gründete eine Akademie. Schon 1874 beschloss Edmond in einem zunächst geheimen Testament, mit seinem Vermögen eine zehnköpfige Akademie zu
stiften, deren Auftrag nicht zuletzt darin bestand, 20 Jahre nach seinem Tod das Journal ungekürzt herauszugeben. Mitglieder sollten nur Autoren sein dürfen, die nicht der Académie
Française angehörten. Erst viele Jahre später im Jahr 1903 haben die Mitglieder dieser Akademie dann beschlossen einen Literaturpreis zu vergeben, der jeden Herbst einen neu erschienenen
französischsprachigen Roman auszeichnen soll: der jetzige Prix Goncourt, der sich zum begehrtesten und werbewirksamsten der zahlreichen französischen Literaturpreise entwickelt hat.
Erschütternd war zu lesen, wie die langjährige Bedienstete der Brüder allmählich in einen Strudel des moralischen Verfalls geriet. Das Doppelleben bekommt hier eine homonyme Bedeutung, da Rose in
sich gedoppelt war. Denn trotz ihrer offensichtlich unmoralischen Handlungen, blieb sie bis zum Schluss auch eine Heilige. Sie tat es aus Liebe. Alles tat sie aus Liebe. Sie umsorgte die Brüder
aufrichtig bis zu ihrem Ende. Und dass sie sich an deren Kasse bediente, um ihren unerträglichen Geliebten Alexandre Colmant immer wieder mit Geld zu unterstützen, verzeiht man ihr. Denn der
eigentliche Bösewicht war ja Alexandre, der nicht liebte.
Die zentralen Fäden des Romans sind die Verfallsgeschichten von Rose und Jules. Hier ist der Roman auch am stärksten. Auch wenn die Schilderungen der exaltierten Mathilde Bonaparte oder den
dekadenten und beleibten Plon Plon (Sohn von Napoleon III.) herrlich zu lesen sind, fehlte ein wenig der Zusammenhang. Der Aufmacher mit der dramatischen Kutschfahrt war dann ein Faden der
nicht mehr weiter verfolgt wurde. So waren zwischen den zentralen Motiven des seelischen und körperlichen Verfalls von Rose und Jules einige Abschnitte wie Stuckaturen eingewebt. Sie hatten natürlich
den Zweck, die gesellschaftliche Diskrepanz zwischen dem Leben der Brüder Goncourt und ihrem Dienstmädchen zu illustrieren. Diese zeigte sich eklatant in der von den Brüdern nicht bemerkten
Schwangerschaft von Rose. Solche Geschichten heimlich ausgetragener Kinder wird es in dieser Zeit viele gegeben haben. Dieses Gretchen-Motiv dürfte wohl auch den besonderen Skandal befeuert haben,
den Germinie Lacerteux in den 1860ern ausgelöst hatte. Erinnern wir uns nur an die Geschichte des Gynäkologen und Don Juan Samuel Pozzi (1846 – 1918), die uns Julian Barnes in
seinem Mann im roten Rock lieferte.
Stéphan Mallarmé soll – laut dem Journal von Edmund Goncourt – verkündet haben, dass
man einen Satz nicht mit einem einsilbigen Wort beginnen dürfe. Goncourt kritisierte den Lyriker daraufhin heftig. Goncourt spottete über „diese Suche nach kleinen Schnitzern“, denn das würde
letztlich von allem „Wichtigen, Großen, Bewegenden, das einem Buch Leben verleiht“ nicht nur ablenken, sondern sogar abstumpfen. Die Differenz zwischen dem feinsinnigen, winzigen Satzmesserchen und
dem großen, monströsen Geschichtsfleischermesser ist selbst eine Anomalie. Denn beides zählt. Manchmal kann so ein „kleiner Schnitzer“ alles ruinieren, manchmal kann so ein „kleiner Schnitzer“ alles
retten.
Im Falle dieses Romans von Sulzer haben mich die vielen Froschschenkel erst gestört. Doch bald offenbart sich der Sinn dieser kulinarischen Exzesse, einmal in der mäßigen Kochkunst von Rose, die den
Brüdern dann regelrecht fehlt und zum Ende in dem Huhn Blanche, das Edmond köpft und das dann so zäh schmeckt, dass Edmond voll Trauer darüber ist, sein ihm lieb gewordenes Huhn getötet zu
haben.
Insgesamt habe ich das Buch also sehr genossen. Und so ist es mir auch gleichgültig, wie viel davon Sulzer ab- und wie viel um- und wie viel er dazugeschrieben hat. Aus den Präfixen zusammen wird dann ein Schuh. Denn es war einfach berührend und mir wird sowohl Ros Malingre, als auch Jules Goncourds tragisches Sterben in Erinnerung bleiben. So habe ich dank Sulzer einen ganz neuen, ganz sinnlichen Zugang zu den so vergangenen Brüdern gewonnen.
18. Januar 2023
Papierschiffchen in der Wüste
Von Ayşegül Çelik
aus dem Türkischen
und mit einem Nachwort von Sabine Adatepe
erschienen 2022 in der Edition Converso
Der persische Vogel Simurg ist der König der Vögel. Und er hat übernatürliche Kräfte. Er kam
nicht im Geburtsweg zur Welt. Der persische Dichter Ferdusi (940 – 1020) beschrieb in einem Gedicht detailliert einen Kaiserschnitt (Er spalte die Weiche der schlanken Zypress', / Empfinden wird
sie nicht schmerzlich es. / Heraus zieht' er die Leuenbrut, / Und setze des Mondes Seit' in Blut. / Dann näh' den Riß er wieder zu;). Salman Rushdies erster Roman „Grimus“ (Anagramm von Simurg)
beschreibt einen jungen Indianer, der von einem Magier ein Unsterblichkeitselexier bekommt, das er zunächst als Segen und immer mehr als Last empfindet.
Simurg wanderte in das Industal, dort nannten sie ihn Mayuri vina. Das bedeutet Pfauenkind. Noch heute spielen Sikh-Musiker auf dem gleichnamigen Bogeninstrument (mayuri vina) ihre Lieder.
Die zoroastrische Herkunft der jesidischen Religion wurzelt also tief. Der blaue Pfau Melek tau ist ein alter Gott, der sogar in die Antike verweist und dort als Greif erscheint. Auch in Goethes
Faust taucht er auf in den pharsischen Feldern, der klassischen Walpurgisnacht. Für die Ummah des Islam ist er jedoch gleichbedeutend mit dem Teufel und die Jesiden damit in den Augen der Moslems
Teufelsanbeter. Daher werden sie verfolgt, gejagt und getötet. Die türkischen Mythologie-Kennerin Ayşegül Çelik hat sich dieser Geschichte(n) angenommen und erzählt in einer Kette Mythologisches und
Reales. Dieser magische Realismus in zehn Geschichten verwoben ist allerdings kein Roman. Auch wenn Afsun Anfang und Ende des Buches beschwört, Personal und Atmosphäre in sich geschlossen scheint. Es
ist wie in mythologischen Geschichten auch eine lose Verwandtschaft in den Geschichten spürbar. Das macht den Reiz der Texte allerdings nicht aus. Denn die Geschichten können durchaus für sich
stehen. So ist das Wörtermärchen (meine Lieblingsgeschichte) als Beispiel ganz selbstständig lebensfähig. Egal. Wenn man Roman vorne drauf schreibt und damit den Verkauf fördert, könnte man
ja von einer Notlüge sprechen. Die Texte haben immer etwas Erhabenes an sich, beleben die Wüste, die kein einsamer Ort ist.
Auferstehung, Wiedergeburt und Unsterblichkeit sind zentrale Motive der Erzählungen, wie das in dem wiederkehrenden Leitmotiv der Schmetterlinge zum Ausdruck kommt. Schon in der Antike waren
Schmetterlinge Symbol der Psyche und der Metamorphose. So hat natürlich auch Goethe über dieses Tier gedichtet: In des Papillons Gestalt / Flattr' ich, nach den letzten Zügen, / Zu den
vielgeliebten Stellen, / Zeugen himmlischer Vergnügen, / Über Wiesen, an die Quellen, / Um den Hügel, durch den Wald.
Weiter hüpft Goethes Schmetterling der Angebeteten auf den Busen, auf den Mund, auf die Hände. Ganz so zart wie das in der vorletzten Geschichte im tollen Wald geschieht und das Wiedersehen
mit Samet Abi und Ceylan märchenhaft verklärt. Die Autorin verschweigt dabei nicht die Realität von Endogamie, Verfolgung und Isolation. Die Wüste selbst ist ein Tagtraum, voller Fata Morgana. Dabei
ist die Morgana eine Fee aus der Artussage. Soviel zu ‚cultural appropriation‘. Auch die jesidische Agglomeration aus Kulturen und Religionen macht hier keine Ausnahme. Jede Kultur, jede Religion hat
Anleihen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Religionen je nach der Reiserute ihrer Vorfahren. Sie mögen für sich eigenständig sein und sich behaupten wollen. Das kann man als Recht verbuchen,
so wie ein rationales Ich dies für sich in Anspruch nimmt. Aber wirklich jeder weiß, dass er das nicht kontrolliert und schon ein paar falsche Mahlzeiten sein Mikrobiom so in Aufregung versetzen,
dass das rationale Ich nur reagieren kann, aber nicht einmal weiß weshalb. Der Fehler liegt von Haus aus in den Schubladen, die immer falsch sind. Unter mir, der ich gerade hier sitze und schreibe
ist eine Schublade. Ordnung wäre wirklich ein weit übertriebenes Wort um diesen Ort unter mir zu kennzeichnen. Insofern können wir auch das Etikett Roman stehen lassen. Was ist schon ein Roman? Die
meisten Romane sind nur unnötig in die Länge gezogene Erzählungen, die eine wirklich gute Schriftsteller:in auch in fünf bis zehn Seiten bewältigt. So wie das Ayşegül Çelik zehnmal machte. Und
dass die Autoren auch für das Fernsehen schreibt, merkt man am Suspense einiger Geschichten ganz besonders bei der schwarzen Perle.
Insgesamt war die Lektüre ein poetischer Genuss. Wie immer ist die Wüste ein Ort wo man sich auf einen in einer Oase platzierten Diwan legt, den Sand durch die Finger rieseln lässt, in eine Orange
beißt, und als konsumverwüsteter Europäer den süßen Saft genießt. Es geht nicht um kulturelle Aneignung. Es geht um Demut. Um die Fähigkeit zu staunen. Karawanen die durch die Wüste ziehen wie vor
hunderten von Jahren schon. Es gab Karawanen, die umherzogen wie wir, Autos, deren Motorengeräusch hinter den Dünen in weiter Ferne zu hören war, und sie waren voller Menschen. Es war, als wären
wir die Sesshaften. Denn die anderen waren es, die von irgendwoher kamen, irgendwohin gingen und nicht wiederkehrten. Diese Erkenntnis meine ich. Es ist eine perspektivische Frage. Kulturen sind
immer perspektivische Erinnerungskonglomerate und mit der Fähigkeit zur Selbstdistanzierung lassen sich Perspektiven simulieren. Aneignung entsteht nur bei eigener Perspektivlosigkeit. Und dazu sind
Kulturen eingerichtet worden. Sie geben uns Richtungen, Möglichkeiten. Die Vernichtung einer Kultur ist immer die Vernichtung von weiteren Möglichkeiten. Regeln zählen mehr als Menschen? Die
erdhafte Poetik von Ayşegül Çelik richtet unseren Blick auf den Boden, den Wald, auf die Natur. Sie ist immer anwesend in diesen Geschichten. Die moderne Zivilisation erscheint dagegen immer als ein
Fremdkörper. Wie anders, als in Märchenform ließe sich das heute noch erzählen? Wer auf der dorischen Halbinsel lebt, nahe bei Knidos, der ist von uralter Geschichte geradezu umgeben und „Tage lang
machten wir nur wenig Fahrt und kamen mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos. Dann zwang uns der Wind, den Kurs zu ändern.“ (Evangelist Lukas)
Die Tierschützerin und Menschenrechtsaktivistin rückt die Ezidin ins Licht. Und der Engel des Todes verweigerte den Menschen den Kniefall. Der unglaubliche Kampf zwischen der Holzfällerfrau und dem Todesengel bringt unsere gemeinsame Geschichte als Menschen auf den Punkt. Dass darin auch die alte Geschichte von Philemon und Baucis eingewebt ist, verweist auf die gemeinsamen Wurzeln unserer Geschichten.
Auch daher bin ich der Überzeugung, dass wir Menschen einen uns allen gemeinsamen höheren Sinn entdecken können. Geschichten sind ein Weg zu diesem gemeinsamen Sinn, der über die Sinne hinausweist.
Rufen Sie einfach an unter
Arwed Vogel
++49 ( )8762 726121
oder
Bernhard Horwatitsch
017646130019
horwatitsch[at]gmx.at
...
oder
nutzen Sie unser