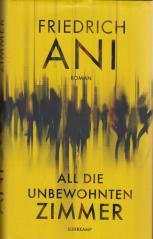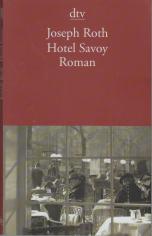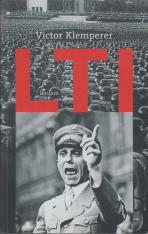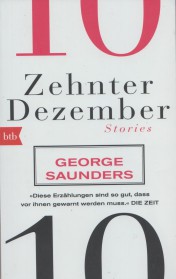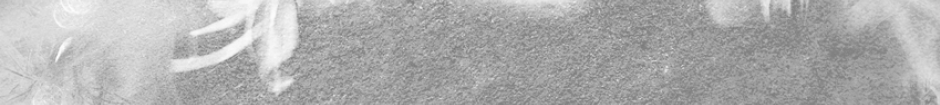
06. Dezember 2019
Legende vom Glück ohne Ende
Von Ulrich Plenzdorf
Erstmals erschienen 1979
Im Verlag Suhrkamp
Das Wort Legende leitet sich vom mittelalterlichen Latein ab. Legenda ist das, was zu
lesen ist, was vorgelesen wird. Es gibt Legenden von Heiligen, aber auch politische Legenden, auch ein Geheimagent hat seine Legende. Viele kennen das Wort vor allem im Zusammenhang mit einem
Märchen, einer Sage. Plenzdorf mischt beide Wortbedeutungen in seiner Geschichte über Paul und Paula, bzw. Paul und Laura. Erzählt wird uns die Hintergrund- Geschichte von der Legende von Paul und
Paula von einem Rentner oder eine Rentnerin der Singerstraße, in der sich die Ereignisse abspielen. Paul und Paula sind eine Sandkastenliebe, deren spätere Liebe unter keinem guten Stern steht. Erst
verhindern Zufälle, dass beide zusammenkommen, Paul studiert in Russland und Paula wird schon mit 16 Jahren in der Kaufhalle arbeiten. Paul heiratet dann eine Schaustellerin und Paula einen Trinker.
Danach kommen sie kurz zusammen, doch dann verunglückt Paulas Sohn. Dies betrachtet Paula als Zeichen und trennt sich von Paul, der sich ohnehin nicht traut zu Paula zu stehen, weil er noch
verheiratet ist und um seine Stellung in der Arbeit fürchtet. Paul ist angepasst, Er laviert sich durch. Seine Karriere ist aber ein Lügengebäude. Seine schöne aber dumme Frau versucht er zu
dressieren, aber er liebt sie nicht. Es ist Paula, die unkonventionell ist und Paul dazu bringt, endlich eine eigene Entscheidung zu treffen. Um Paula zurückzubekommen, kampiert er vor ihrer Wohnung
im Treppenhaus. Endlich gibt sie nach und ihr kurzes Glück wird erneut von einem Kind getrübt. Paula wird ein drittes Mal schwanger, obwohl der Professor ihr davon abgeraten hatte. Sie überlebt die
Geburt nicht.
Paul sieht in der Kaufhalle eine Frau, die Paula gleicht, spricht sie an. Doch jetzt ist Laura die Konventionelle und Paul – der seine Stelle verloren hat und in der Kaufhalle als Transportfahrer
arbeitet – ist der Unangepasste.
Inmitten dieser rationierten und von spitzfindigen Bürokratien gepeinigten Gesellschaft schildert Plenzdorf eine Stadtgemeinschaft, die dörflichen Charakter hat. Gleichzeitig erleben wir während der
Erzählung den ganzen Umbau der Stadt. Der Film Die Legende von Paul und Paula für den Plenzdorf das Drehbuch schrieb, wurde 1973 uraufgeführt und war ein so großer Erfolg, dass Plenzdorf
diesen Fortsetzungsroman anschloss.
Paul und Paula wurden geradezu Kult und waren auch zentral in der Ostalgie-Welle der 1990er Jahre zu sehen. So sieht man sie auch in dem Film Sonnenallee auf einem Wohnungsklingelschild. Auch die
Popmusik verarbeitete die Legende häufig.
Plenzdorf ist in seinem Roman nicht offen systemkritisch. Aber in einigen Episoden zeigt sich
das schon. In einer Dialog-Szene wird die Doppelmoral des real existierenden Kommunismus in Bezug auf die Beschaffung von Luxuswaren deutlich. „Kommunismus ist immer für alle“, sagt Paul an der
Stelle. Darauf antwortet ihm Paula, „dass an unseren Kassen jeder zehnte wie ein Kommunist einkauft. Geld spielt für die keine Rolle.“ Darauf meint Paul, dass es sich hier um eine „Übergangsphase“
handele. Darauf Paula schlagfertig „Verstehe. Das heißt, welche fangen schon mit dem Kommunismus an, und andere müssen eben noch warten.“ Darauf kann Paul nur noch sagen, dass Paula „der Überblick
fehlt“.
Paula hält sich lange den Reifenfabrikanten Saft warm. Dieser hat nichts studiert und sich alles selbst erarbeitet. Er ist im Grunde das Sinnbild des Westens, oder was man für den Westen hielt. Er
kann sich alles organisieren. Aber er muss aufpassen, er darf nicht angeben. Die Abwägung, soll man aus Liebe handeln oder an die eigene Sicherheit denken wird von Paula im Grunde nur vorgetäuscht.
Letztlich spielt sie mit der Situation, ist in drei Teile geteilt (Paula 1, 2 und 3) und damit eigentlich nicht handlungsfähig. Die beiden Männer handeln. Doch der Zufall bestimmt regelmäßig die
Zukunft. So sehr Paul ein Organisationsgenie ist, gegen den Zufall der Ereignisse hilft ihm kein Plan. Das ist im Grunde die schärfste Kritik an einer Regierung, die sich als Planwirtschaft versteht.
Unter dem Wort „organisieren“ kann man zwei unterschiedliche Bedeutungen wahrnehmen. Entweder das planmäßige Handeln oder die Fähigkeit, sich mit der nötigen kriminellen Energie Subsidien zu
beschaffen.
Am Ende der Geschichte verschwindet Paul und taucht nicht mehr wieder auf. Niemand weiß, was
geschehen ist.
Immer wieder erzählt der oder die ErzählerIn die diversen Legenden die sich um die Ereignisse ranken, um sie dann wieder zu verwerfen. Die Spielarten der Liebe, von Abhängigkeiten und Lust,
Verwirrung und Sehnsucht, Schutz und Gewohnheit sind nie isolierte Ereignisse. Daher hat die Erzählung den kollektiven Blick von Meiner Person, wie sich der Erzähler nennt. Wenn wir ganz
ehrlich sind, dann ist auch unsere eigene Geschichte eine Legende. Manches ist wahr, manches unsicher, manches schlicht falsch. Entscheidend ist nicht die Wahrheit der Ereignisse, sondern ihre
Kohärenz, die es möglich macht, die Geschichte zu verstehen und ihr Sinn abzugewinnen. Auch wenn die Figuren meist umsonst handeln, weil der Zufall sie lenkt, bleiben sie als Figuren kohärent, weil
sie handeln und dadurch machen sie Sinn.
Der Autor Ulrich Plenzdorf kam 1934 in Berlin zur Welt und wurde in Westdeutschland mit seinem staatskritischen Bühnenstück Die neuen Leiden des jungen W. bekannt, in der Zitate aus Goethes Werther, aber auch Salingers Fänger im Roggen und Defoes Robinson Crusoe gemischt werden. Die Geschichte eines Vorzeigeknaben, der früh von einem Stromschlag getötet wird, erzählt der Vater posthum und immer wieder unterbrochen von dem inneren Monolog des längst Verstorbenen. Ein paar Goethe-Zitate findet man ja auch in der Legende vom Glück ohne Ende. Dem Wortspiel im Titel gemäß könnte man schließen, dass sich die schwankenden Gestalten wieder nahen, vom Glück getäuscht und bangen Herzens von der Welt genarrt wird dies zur Wirklichkeit.
03. Dezember 2019
Hunger
Von Knut Hamsun
Aus dem Norwegischen von Siegfried Weibel
Erschienen 2017 im Verlag Ullstein
Das Original erschien 1890 unter dem Titel „Sult“
Das erste Mal las ich diesen kuriosen Roman im Alter von 18 Jahren. Ich hatte gerade meine erste Bleibe außerhalb meines Elternhauses gefunden, zur Untermiete in einem möblierten Zimmer. Der in dem Roman von Hamsun beschriebene Kampf um Obdach und Anerkennung traf mich wie ein Blitz, da ich selbst gerade angefangen hatte erste Verse zu schmieden und vom großen Ruhm zu träumen. Auch wenn man meinen damaligen Kampf nicht mit dem von Andreas Tangen vergleichen konnte, war die Identifikation groß. Denn der beschriebene Hunger wirkte auf mich wie eine Metapher für einen ganz anderen Hunger. Kurz darauf las ich Die Brüder Karamasow und erfuhr vom Kardinal Großinquisitor, dass keine Wissenschaft den Menschen Brot geben wird, solange sie frei bleiben – und enden wird es damit, dass sie uns (den Kirchenfürsten) ihre Freiheit zu Füßen legen und sagen: Knechtet uns lieber, aber macht uns satt! Insofern war der Kampf von Andreas Tangen weit mehr, als nur einer um genügend Brot. Denn immer spielt in seinem inneren Streit die Moral die größte Rolle. Du bist ein Trottel, du lernst das Heucheln nie beschimpft sich Hamsuns Protagonist selbst und wenige Zeilen später stellt er ernüchternd fest: Du bist zu arm, um dir ein Gewissen zu leisten. Moral ist ein Luxus, den man sich leisten können muss. Doch wer nicht fähig ist, sich zu verstellen wird verhungern. Dieses Grundbedürfnis nach bedingungsloser Ehrlichkeit steht im Widerspruch zu den realen Arbeits- und Lebensbedingungen. Das spürte ich als 18jähriger nur allzu deutlich, als ich zum ersten Mal in meinem Leben selbst dafür zu sorgen hatte, Miete und essen zu finanzieren. Genau diese Differenz macht den Roman aus dem Jahr 1890 so aktuell. Vielleicht ist den meisten gar nicht mehr bewusst, dass sie zu gar nichts gezwungen zu werden brauchen, weil sie ihre Sklaverei lieben. Die Freiheit suchte auch der Autor des Romans und wanderte mit Anfang 20 nach Amerika aus. Er schlug sich als Hilfsarbeiter und Straßenbahnschaffner durch, kehrte aber nach einer Lungenentzündung wieder zurück. Auch ein zweiter Versuch von ihm in den USA Fuß zu fassen, scheiterte. Der American Way of Life behagte ihm nicht. Auf der Rückfahrt fing er an, diesen Roman zu schreiben. Er spielt in Kristiana (heutiges Oslo) ca. 40 Jahre nach der Schleswig-Holstein-Erhebung die einen Monat auf die Märzrevolution in Paris folgte. Wie in allen Revolutionen geht es nicht um Liebe, sondern um Hass. Wut auf die Verhältnisse (ob die Wut gerechtfertigt ist oder nicht, spielt dabei nicht immer eine Rolle) eskaliert. In dem Helden des Romans haben wir jedoch einen Ich-Erzähler der immer wieder versucht, seine Wut zu zügeln und lieber sich selbst geißelt. Sein Hunger und sein Elend sind nur durch seine gefühlte moralische Überlegenheit zu ertragen. Hamsun stellt ein Gegengewicht dar zu den sozialistischen Ideen, dass Moral erst möglich sei, wenn der Hunger gestillt ist. Hier vollzieht sich geradezu das Gegenteil. Moral ist hier kein Luxus, sondern entspringt der Gewissheit etwas Besonderes zu sein. Und führt mich wieder zu meinem adoleszenten Ich der 1980er Jahre zurück, wo ich genau diesen Stolz fühlte, von dem der Protagonist Andreas Tangen (wenn es denn sein wahrer Name war) angetrieben wurde.
Klinisch betrachtet schildert Hamsun die Symptome einer ausgewachsenen Psychose. Durch die erzwungene Nahrungskarenz erlebt er außerkörperliche Erfahrungen die typisch sind für die Schizophrenie: Nach und nach hatte ich das seltsame Empfinden, weit weg zu sein, anderswo, ich hatte halb unbestimmt das Gefühl, dass nicht ich es sei, der dort auf dem Pflaster ging und den Kopf einzog. Dennoch kann er alles um sich herum wahrnehmen, was eine Folge der dopaminergen Überdosierung des Gehirns ist und dazu führt, dass das Wahrnehmungssystem nicht mehr filtert: So fremd ich mir selbst in diesem Augenblick war, so vollständig eine Beute unsichtbarer Einflüsse, nichts um mich herum geschah, ohne dass ich es wahrnahm. Das Schizophrene geht bis zum Beziehungswahn, den er mit dem kleinen Mann und seiner Zeitung erlebt.
Detailliert beschreibt Hamsuns Erzähler die Folgen des Hungers. Das ist so genau, dass man
davon ausgehen kann, dass Hamsun weiß wovon er schreibt.
Heute las ich den Roman mit einer ganz anderen Wahrnehmung. Meist musste ich lachen über die Naivität des Protagonisten. Ein Hans im Glück. Es war ein homerisches Lachen das mich dabei ergriff. Ich
dachte darüber nach, ob es nur dann möglich ist ehrlich und gut zu sein, wenn man so naiv ist wie dieser Protagonist. Und natürlich suchte ich nach der Ironie im Text. Ich fand sie allerdings nicht.
Dennoch erinnerte mich meine aktuelle Lektüre-Erfahrung an Kafka. Auch dort las ich erst den Ernst und danach die Komik. Der Tramp Andreas Tangen spiegelt sicher Hamsuns negative USA-Erfahrungen
wider. Diese Mischung aus Ernst und Komik hat Charly Chaplin Jahre später (1915) in dem Film The Tramp meisterhaft verkörpert.
Ein weiterer Aspekt ist auch die irrtümliche Vorstellung des Dichters über sein Auserwähltsein, die auch Hamsuns Held bei der Stange hält. Schwankend ist diese Vorstellung und der mentale Halt trügerisch. So schwankt der Held zwischen Größenwahn und tiefster Verzweiflung. Ein Gleichgewicht scheint kaum möglich. Und alle Lebenswelten sind von dieser Vorstellung erfüllt. Hatte er einen guten Text geschrieben fühlte er sich unantastbar und war glücklich. War er unproduktiv fühlte er sich als Nichtsnutz und erlebte die ganze Härte der Realität. Der Traum des Dichters schürft sich an der Realität auf. Als sich die Bediensteten über seine Texte und sein schäbiges Dasein lustig machen zeigt sich die ganze Dimension dieser Tragikomödie. Die meisten Menschen kümmern sich nicht um diese Träume. Sie sind ihnen völlig gleichgültig. Sie interessiert nur ihr Auskommen, ihr täglich Brot. Der Traum des Dichters erscheint auf urkomische Weise singulär. Das Kollektiv zuckt mit den Schultern und wundert sich über die Schrulligkeit und Eigenwilligkeit dieses Mannes. Ich brauchte selbst sehr lange, um das zu verstehen. Der Traum des Dichters muss erst harte Realität werden. Erst dann glauben auch die Traumlosen, ihn zu verstehen. Und doch lieben wir alle diese Traumfabrik. Wie hart erkämpft sie manchmal ist, fällt gerne unter den Tisch. Nicht umsonst haben von Thomas Mann bis Henry Miller (zwei Träumer die unterschiedlicher nicht sein könnten) den Roman verehrt. Denn der Hunger ist hier Metapher. Auch wenn er als Realität auserzählt wird. Oder gerade weil er als Realität auserzählt wird ist der Hunger eine Metapher für einen ganz, ganz anderen Hunger.
Das war nun das dritte Mal, dass ich diesen Roman gelesen habe. Mit 18 Jahren, mit 35 Jahren und mit 55 Jahren. Von der mittleren Leseperiode weiß ich nur noch, dass mich die klinischen Symptome besonders evozierten. Ich arbeitete in der Psychiatrie und erlebte die Spinner hautnah. Ich erlebte sogar junge Menschen die freiwillig auf Nahrung verzichteten. Doch nie war ich so nah an der Geschichte, wie als 18jähriger. Da der Roman damit endet, dass der Protagonist auf einem Schiff anheuert und endlich (endlich möchte man ausrufen) einer ordentlichen Arbeit nachgeht, könnte man sagen, dass auch die Träumerei erst dann einen Boden hat, wenn man damit auch Geld verdient. Dieses Geld war aber nie das eigentliche Begehren des Helden in diesem Roman, zu oft hat er es wieder weggegeben. Es ging immer nur darum, anzukommen vor sich selbst. Dieser Überlebenskampf ist das Sinnbild für uns alle. Wir alle sind mit vielen Träumen angetreten und ums Geld ging es uns nie. Wir nehmen es inzwischen, weil wir dazugelernt haben.
20. November 2019
Vater unser
Von Angela Lehner
Erschienen im Verlag Hanser 2019
Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker, der hatte nichts zu beißen und zu
brechen, und kaum das tägliche Brod für seine Frau und seine zwei Kinder, Hänsel und Gretel. So beginnt
eines der berühmtesten und bekanntesten Märchen. In der Grimmschen Version schickte die Mutter die Kinder weg, weil es nicht genug zu essen gab für alle. Die Mutter führte sie noch tiefer in den
Wald hinein, wo sie ihr Lebtag nicht gewesen waren. Am Ende stirbt die Mutter und der Rest der Familie lebt wieder glücklich zusammen. Diese sozialkritische Note wurde in späteren
Versionen durch das Motiv der Stiefmutter verändert. Nach Bruno Bettelheim passt die Ausgangssituation zur verbreiteten kindlichen Angst, von den Eltern verstoßen zu werden und verhungern zu müssen.
Zugleich ist das Lebkuchenhaus auch ein Bild des (Mutter-)Leibes, der das Kind vor und nach der Geburt ernährt. Doch die Kinder müssen lernen, sich davon zu emanzipieren.
Der Wald in Angela Lehners Hänsel-und-Gretel-Version ist die Niederösterreichische Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke Am Steinhof, heute das OWS, Otto-Wagner-Spital. Diese
Namensbereinigung hat Tradition. Ich selbst lernte im heutigen Klinikum Innenstadt Ost, zu meiner Zeit hieß es noch Bezirkskrankenhaus Haar. Ganz früher Eglfing (Eglfing mach’s Türle auf, da Irre
kommt im Dauerlauf). Eine riesige Anlage mit ehemals 1000 Betten, Bettensälen (in einem Saal standen 20 Betten, nicht einmal eine spanische Wand trennte sie). In einer Reform Anfang des
Jahrtausends wurde die Anlage verkleinert um die Hälfte, die Kranken auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Auch dieses Bezirkskrankenhaus wäre würdig, einen Wald abzugeben für Hänsel und
Gretel.
Ein literaturgeschichtlich bekannter Insasse des Steinhofs war Paul Wittgenstein, aus
einer Erzählung von Thomas Bernhard (Wittgensteins Neffe), die im Jahr 1967 spielt, als Bernhard aufgrund seiner Lungenerkrankung auf der Baumgartner Höhe im Pavillon Hermann lag, in direkter
Nachbarschaft zum Steinhof. Womöglich heißt der magersüchtige Hänsel in Lehners Roman deshalb Bernhard.
Lehner erzählt die Geschichte von zwei traumatisierten Geschwistern aus der Perspektive der älteren Schwester. Eva Gruber lässt sich unter einem Vorwand in die Psychiatrie einliefern, um ihren Bruder
von dort zu befreien. Im Verlauf des Romans, dessen Handlung zum großen Teil im Spital spielt, erfahren wir bruchstückhaft eine Missbrauchsgeschichte. Der dissoziative Charakter der Ich-Erzählerin
lässt uns aber nie ganz sicher sein. Vergangenheit mischt sich mit der Gegenwart, so dass sogar die Flucht der beiden Geschwister imaginiert sein könnte. Gerade durch diese enigmatische
Erzählstruktur gelingt es Angela Lehner das Drama vom Missbrauch authentisch zu erzählen. Die Eva lügt ja immer. Niemand glaubt ihr und wie bei einem Rocketsystem bestätigt Eva das Misstrauen ihr
gegenüber immer wieder. Sie lügt und täuscht, weil das ihr Überlebenssystem ist. Auf der Metaebene könnte man sagen: Das Erfinden von Geschichten wird zur Überlebensstrategie in einer feindlich
realistischen Welt. Die Atmosphäre der Psychiatrie, die Sitzungen mit Dr. Korb hat Lehner sehr glaubhaft gestaltet. Ärzte, Schwestern und Patienten treffen sich wie eine große Familie im Trog, einer
Mischung aus Greißler (ostösterreichische Bezeichnung für einen kleinen Lebensmittelladen) und Café. Auch das hat Tradition. In der Nußbaumstraße, der Münchner Universitätspsychiatrie gibt es genauso
einen Laden, der auch als Café dient. Dort sitzen dann Patienten, Besucher, Ärzte, Pfleger, Schwestern bunt gemischt. Das Bezirkskrankenhaus Haar hat sogar einen eigenen Discounter, ein berühmtes
Café, das Regenbogencafé, und ein Museum für Psychiatrie. Psychiatrien sind Heterotopien. Eine eigene Welt, ein Geisteswald. Nicht umsonst sagt Dr. Korb gerne, dass die Irren eigentlich draußen
rum laufen. Auch das ist ein Spruch, den ich kenne.
Der dritte und letzte Teil des Romans spielt dann allerdings durchgängig in der Provinz
Kärnten. Ein Altarbild und ein Portrait von Jorg Haider in Dr. Korbs Arztzelle geben das Schlüsselmotiv. Oder Schlüsselvotiv. Das wortkarge und fleischgegerbte Bauernpaar, ein Hexenpaar, die Evas
Bruder Bernhard zu mästen versuchen, sind die Menschenfresser dieser Landschaft, wie sie der Namensvetter Thomas Bernhard immer wieder beschrieb. Bernhards Magersucht ist aber schon so
fortgeschritten, dass alle Nahrung wieder beinah unverdaut zurück gegeben wird. So schützt sich der Bruder von Eva vor der feindlichen Realität. Wie im Märchen wird auch Bernhard nicht dicker.
Angela Lehner inszeniert ihre Gretel als schlagfertig und kämpferisch. In der feindlichen Welt durchbricht ihr Humor die Verzweiflung. Und doch kann ihr der Sarkasmus nicht wirklich helfen. Ob nun im
Wald vom Steinhof oder im Wald von Kärnten: The walking dead lauert überall.
Eva leidet an der für das PTBS typischen Hypervigilanz. Das eigentlich zerstörerische Trauma wird nie erzählt. Auch das zeigt, dass Angela Lehner weiß, was sie tut. Denn zur PTBS gehört genau dieser
Gedächtnisverlust. Diese Lücke wird ausgefüllt durch ständige Wachsamkeit, Gereiztheit und Angriffsbereitschaft bis zur Halluzination. Diese Lücke im Lebenskontinuum muss irgendwie gefüllt werden.
Für Außenstehende ist nie möglich zu entscheiden, ob Eva Gruber wirklich das Opfer ist, für das sie sich ausgibt. Lediglich die Symptome verweisen auf die Ereignisse. Der Vater ist abwesend. Eva muss
ihn töten, weil er abwesend ist. Die anwesende Mutter lehnt sie ab, denn sie hat es nicht verhindert. Dass die Mutter zum Ende sogar einen neuen Vater mitbringt und dieser der für Eva so wichtige Dr.
Korb wurde (den sie eigentlich für tot hielt) ist in sich schlüssig. Aber dieser Vaterersatz gelingt nicht. Daher muss der Bruder sterben.
So hat der Roman bei aller sprachlichen Lockerheit psychologische Tiefendimension. Ob nun Trauma oder nicht, Vatermord oder nicht, ist es ein coming of age Roman mit tragischem Ende. Die beiden Kindernamen hinter dem Efeu legen ein Grab frei. Nichts anderes. Das eigentliche Mordopfer ist die Kindheit. Die Welt der Erwachsenen ist die feindliche Welt. Als Kind kann man dieser Welt der Erwachsenen nur entkommen, indem man verrückt wird. Daher laufen die Irren draußen herum. Im seelischen Innenraum dieser erwachsenen Irren lebt noch das Kind, das langsam verhungert bis es tot ist. Ist es erst tot, dann ist man ein Zombie, ein angepasster Untoter. Die Kranken heißt es in Wittgensteins Neffe von Thomas Bernhard, verstehen die Gesunden nicht, wie umgekehrt die Gesunden nicht die Kranken und dieser Konflikt ist sehr oft ein tödlicher…
08. November 2019
Das geheime Leben der Bäume
Von Peter Wohlleben
Erschienen im Verlag Ludwig 2015
Der Naturschützer und Nachhaltigkeitsforscher hat schon einige Bücher über den Wald geschrieben. Seine Waldführungen und Seminare sind regelmäßig ausgebucht. Und so hat er viel zu tun. Denn rund ein Drittel der Landesfläche in Deutschland besteht aus Wald (11,1 Millionen Hektar). Die häufigsten Baumarten sind hierzulande die Nadelbäume Fichte (28 Prozent) und Kiefer (24 Prozent), gefolgt von den Laubbäumen Buche (15 Prozent) und Eiche (10 Prozent). Alle vier Baumarten nehmen zusammen rund drei Viertel der Waldfläche ein. Dies sind dann auch die am häufigsten genannten Baumarten in Wohllebens Baumologie. Aber die Bäume sind vor allem als Klimaschützer angesagt: Der Wald in Deutschland wirkt derzeit als Senke und entlastet die Atmosphäre jährlich um rund 52 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Und laut BMEL ist der deutsche Wald gesund. Der NABU kommt allerdings auf kritischere Zahlen. Doch auch in ihrer jährlichen Waldzustandserhebung macht das BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) den Fehler zu behaupten, dass die Speicherung von Kohlenstoff in langlebigen Holzprodukten eine positive Klimawirkung hätte. So heißt es auf der Internetseite des BMEL: Jeder Kubikmeter Holz enthält etwa 0,3 Tonnen Kohlenstoff, der in Produkten wie Gebäuden oder Möbeln jahrzehntelang gebunden ist. Wenn Holz dabei energieintensive Materialien ersetzt, werden Treibhausgasemissionen, die bei der Produktion anderer Materialien entstehen, in erheblichem Ausmaß eingespart. Hinzu kommt die energetische Verwendung von Holz, die einen wichtigen Beitrag zur Verringerung fossiler Brennstoffe leistet.
Doch genau dieser Analyse wiederspricht Peter Wohlleben deutlich (ab Seite 87, Kapitel „CO2-Staubsauger“). Der Wald ist komplexer und Wohlleben kritisiert daher auch mehrfach die Kultivierungsmethoden der Forstwirtschaft. Bäume werden da künstlich verjüngt, müssen – im Prinzip – kurz nach der Pubertät bereits sterben. Zudem sorgt die Kultivierung für eine Verarmung des Biotops „Waldboden“. Eine Parklandschaft ist kein Wald. Die Hälfte des deutschen Waldes befindet sich in Privatbesitz, was auch darauf hinweist, dass in Deutschland das „gemein“ im Wort „Gemeinwohl“ mit dem Adjektiv verwechselt wird, für das man auch das Synonym „niederträchtig“ verwenden kann. Wenn sich Wohlleben nun Gedanken macht über die Definition „Baum“ (Seite 75 im Kapitel „Baum oder nicht Baum“) dann hätte ich mir hier schon auch einmal gewünscht, dass der Naturschützer klarer darauf verweist, wer die Deutungshoheit hierzulande hat.
Die Tatsache, dass der Wald in erster Linie Nutzwald ist, hebt der Autor ja immer wieder hervor. Die vielen Schilderungen darüber, dass ein Baum weit mehr ist, als ein Nutzobjekt, dass ein Baum geradezu ein Lebewesen ist, blutet, kommuniziert, sich sorgt, das wird die Gewinnmaximierer dieser Welt kaum abhalten, weiter zu roden. Gut, das ist nicht die Aufgabe eines Sachbuches, das über das geheime Leben der Bäume erzählt. Die Crux ist da mal wieder unser aller Materialhunger, unser aller Konsumhunger. Und wenn das Buch von Peter Wohlleben am Ende dazu führt, dass nun ganze Horden von Hobby-Baumologen durch die deutschen Wälder grast und dabei ihren Plastikmüll hinterlässt, dann hätte Wohlleben wohl mit diesem Buch dem Wald einen Bärendienst erwiesen. Tatsächlich ist es so, dass mich der Text selber dazu anregte, den Wald zu suchen, weil er ja so gesund ist, sogar meine nikotinverhärteten Arterien weitet und wieder elastischer macht. Es ist so düster. Der Mensch schlachtet nicht nur 3000 Tiere pro Sekunde in den Schlachthöfen der Welt - diese grausamen Zahlen stammen von http://www.animalequality.de/essen -, nein, der Mensch vernutzt, rodet und zerstört auch seine eigene Biosphäre. Alle 2 Sekunden wird Waldgebiet von der Größe eines Fußballfeldes zerstört. So berichten die Vereinten Nationen (und die stehen nicht unter Kommunismusverdacht).
Da gibt es eine ziemlich gute HBO-Produktion "The Newsroom", über einen US-amerikanischen
Nachrichtensender ACN. Eine geniale Szene in der dritten Staffel zeigt folgendes: Der Anchorman McAvoy hat einmal einen Studiogast in seinen Prime-Time-Nachrichten, den stellvertretenden Leiter des
Umweltressorts. Warum nur den stellvertretenden? Weil die damalige Regierung Obama sich nicht einigen konnte, hat das Umweltressort keinen Chef (was wirklich so war). Entscheidend aber, dieser
stellvertretende Leiter des Umweltressorts erzählt nun zur besten Fernsehzeit, dass man auf Mauna Loa auf Hawaii gerade die Kohlendioxidwerte gemessen habe, und festgestellt habe, dass der point
of no return bereits überschritten sei.
McAvoy will nun wissen, was man tun könne?
"Nichts", antwortet der stellvertretende Ressortleiter.
"Wie nichts? Man muss doch was machen können."
"Vor 20 Jahren hätten wir noch abschalten können. Jetzt ist es zu spät."
"Wir können also nichts machen?"
"Nein."
Der Nachrichtensprecher ist verdutzt, sprachlos. "Ja, aber irgendwas müssen wir doch tun können. Wenn wir die Werte jetzt reduzieren..., es sind hier die 20 Uhr Nachrichten..."
" Wenn wir vor 20 Jahren abgeschaltet hätten, dann hätten wir vielleicht noch die Chance, auf einem dystopischen, postapokalyptischen Planeten zu leben. So aber ..., aber das interessiert
niemanden"
"Wann wird es so weit sein"" fragt McAvoy.
"Der Mensch, der es erleben wird, ist bereits geboren", antwortet der stellvertretende Umweltleiter. Tatsächlich hatte der stellvertretende Leiter des US-amerikanischen Umweltressors diese Worte
gesagt, wenn auch nicht in den 20 Uhr Nachrichten.
Was aber in der ganzen Sendung klar wurde. So schonungslos offen. Es interessierte tatsächlich niemanden. Für die Quote bringt der Beitrag nichts. Inzwischen gibt es zwar Fridays for Future, und viel ist die Rede vom Klimawandel (der kein Wandel ist, sondern eine Katastrophe) aber die Proteste haben am Umweltschutzpaket der Bundesregierung nicht wirklich etwas geändert. Und auch nicht am Mobilitätsverhalten der Bürger. Die Frage, ob Wohllebens Bestseller (zeitweise war das Buch sogar vergriffen, auf Amazon unter den Top Ten) dazu führt, dass wir unser Verhalten ändern, darf gestellt werden. Die Frage, ob wir überhaupt unser Verhalten ändern können, weil die Verhältnisse unser Verhalten diktieren, darf auch gestellt werden. Erschütternd an dieser „Liebeserklärung an den Wald“ (Buchrücken) ist doch: Daran wird Wohllebens Buch nichts ändern. Peter Wohlleben hat sich in seinem Buch vor allem darauf besinnt, die Faszination für den Wald zu stärken. Ein Appell an unsere emotionale Intelligenz. Aber durch die Sachzwänge einer Wachstumshysterie führt so ein Appell – zumindest bei mir – nur zu emotionalem Stress. In seinem Buch „Das wahre Leben der Bäume“ kritisiert der Autor und Biologe Torben Halbe Wohlleben. Halbe bezeichnet Wohllebens Buch sogar als umweltschädlich, da Wohlleben fordere, die Holzproduktion in Deutschland großflächig zurückzufahren. Halbe wirft Wohlleben wissenschaftliche Ignoranz und Respektlosigkeit gegenüber den im Wald Wirtschaftenden und Manipulation seiner Leser vor. Wohlleben zeichne keinen realen, sondern einen fiktiven, „perfekten“ Bambi-Wald, womit er sachliche Diskussionen verhindere. In den Medien würde Wohlleben und seinen Büchern unkritisch viel Platz eingeräumt.
11. Oktober 2019
Gegen den Hass
Von Carolin Emcke
Erschienen 2016 im Verlag S. Fischer
„Gehasst wird ungenau. Präzise lässt sich nicht gut hassen. Mit der Präzision käme die Zartheit…“, schreibt die Publizistin Carolin Emcke im Vorwort ihres Essays über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Im gleichen Jahr des Erscheinens dieses Essays wurde Emcke mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. „Wer liebt“, schreibt sie, „will sich nicht erklären müssen“. Liebe ist Anerkennung, die nicht unbedingt Erkennen voraussetzt. Als Beispiel dafür erläutert sie die Verliebtheit Titanias in den zum Esel verzauberten Zettel aus Shakespeares Sommernachtstraum. Schon hier muss sie gar nicht mehr erwähnen, dass der Hass ähnlich tickt. Hass muss sich auch nicht erklären und das gehasste Objekt wird nicht erkannt, sondern vielmehr verkannt. Hass muss man klar von Wut differenzieren. Wütend kann ich auch auf mein geliebtes Kind sein, wenn es zuwider handelt. Aber diese Wut verraucht. Hass bleibt, denn es besteht eine enge Verbindung des Hasses zum „für Böse halten“ (Kolnai). Hass ist tief und zentralisiert, ebenso ein historischer Aspekt des Menschenlebens. Ebenso wenig lässt sich der Hass aus der Angst ableiten. Bei der Angst kümmert mich nur mein eigener Zustand, nicht der des mich Bedrohenden. Beim Hass jedoch ist das anders. Hass ist auch nicht das Gegenteil von Liebe. Man kann sein Kind fanatisch lieben und voller Hass gegen seine störenden Eigenschaften vorgehen. Das Objekt muss von seiner Qualität her „hassenswert“ sein. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob Carolin Emcke wirklich richtig liegt darin, zu vermuten, die Hassenden wollten die Unsichtbarkeit und würden diesen Unsichtbaren nun als Monster verkennen. Wie Emcke es in dem Kapitel über institutionellen Rassismus beschreibt, erkennen die Polizisten nicht den an Asthma erkrankten Eric Garner, sondern sehen nur die Bedrohung, die von ihm auszugehen scheint. Es ist die historische Rolle, die der Schwarze hier spielt. Er war von jeher ein Sklave. Er ist daher kein Individuum mehr, sondern ein Stellvertreter für ein historisch geprägtes und zu hassendes Objekt. Die Gefahr, die von dem Bus mit den Geflüchteten und der zynischen Aufschrift „ReiseGenuss“ ausgeht, geht nicht von den einzelnen Menschen die in dem Bus sitzen aus, sondern von dem, was sie repräsentieren in den Augen der Meute, die den Bus wie ein gejagtes Tier stellen. Das Tier wird auch nicht vernichtet. Es wird ausgestellt. Historisch vorbereitet in den kolonialistisch imprägnierten Bildern, die man von fremden Menschen hat, die aus „niedrigeren Kulturen“ kommen und unseren so genannten „Standard“ gefährden. Zwar schreibt Emcke klar, dass dieser Hass vorbereitet wurde, dass seine Zielgerichtetheit nicht zufällig ist, aber sie unterlässt es dennoch, die historischen Bezüge genauer zu benennen. Das ist zwar dem Genre des Essays geschuldet, und man kann selbst den von Emcke gelegten Hinweisen (und Literaturverweisen) folgen, doch wäre ein extra Kapitel zur Präzession durchaus angebracht gewesen. Gerade weil immer mehr Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen entweder Erinnerungskultur ablehnen und Tradition fordern, oder Tradition ablehnen und Erinnerungskultur fordern. Es geht bei der Tradition um oral tradierte Wahrhaftigkeit, nicht um Wahrheit. Auch in der Shoa gibt es Elemente der Fiktion als ethnische Erzählung. Emcke schreibt: „Ein Rassist möchte niemand sein. Nicht einmal der Rassist möchte ein Rassist sein, weil zumindest das Etikett gesellschaftlich tabuisiert ist.“ In der Eloquenz dieses Satzes liegt auch das Element der Verkürzung. Gerade hier wäre der historische Blick tatsächlich genauer gewesen. Der Lehrer von Carolin Emcke – Axel Honneth – schreibt in seinem Versuch den Sozialismus zu erneuern, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem viel zu stark vernetzt und operativ verflochten sei, als dass die nationalstaatlichen Akteure ihm gegenüber noch ausreichend Kontrollmacht besäßen. Abscheu, Ressentiments und Missachtung gegenüber einer Menschengruppe haben, - wie viele Rassentheorien – ökonomische Hintergründe, sind sogar Folge des Marktliberalismus. Ich habe mich beim Lesen des Essays beständig gefragt, was mir eigentlich fehlt. Denn der Text ist wirklich gut geschrieben und kaum zu kritisieren. Nur fehlte etwas. Es fehlt durchgängig. Die Tatsache, dass ein radikaler Marktliberalismus Reservearmeen für den Arbeitsmarkt benötigt, wurde zwar angedeutet: das Werk in Döbeln wurde geschlossen und die Meute hatte keinen direkten Adressaten mehr für ihren Unmut. Doch der Umschlag des Hasses auf die, die am wenigsten dafür können, dass dieses schwedische Werk geschlossen wurde, wird lediglich durch das Fehlen eines Adressaten erklärt. Die Ursache des Hasses, das stellt Emcke richtig fest, ist also nicht das Objekt des Hasses. Doch wie kommt es zu dieser Verschiebung? War es tatsächlich der Zaubertrank eines Trolls, wie das Kapitel über Liebe nahe legt? Nicht die Bewohner von Clausnitz waren es, die den Zaubertrank verteilten. Sie haben den Zaubertrank getrunken. Denn die bezahlbaren Bedürfnisse werden gestillt durch diesen Zaubertrank. Dem Essay fehlte also die Analyse des Rezepts des Zaubertranks. Ebenso wenig klärt uns Emcke darüber auf, wer der König der Elfen eigentlich ist? Wer ist Oberon? Er ist der Zwerg Alberich, Andwari aus der Lieder-Edda. Er trägt eine Tarnkappe, die ihn unsichtbar macht. So konnte ihn auch Carolin Emcke nicht sehen. In der Lieder-Edda ist er der Hüter des Goldschatzes. Loki nahm ihm den Goldschatz ab, worauf Andwari den Goldschatz verfluchte. Das verfluchte Gold! Der Geschichte Sinn: Der Adressat des Hasses fehlt nicht etwa, sondern war von Anfang an unsichtbar. Geschützt ist, wer den Zaubertrank zu sich nimmt. Und sobald man ihn getrunken hat, vergisst man den Wirt. Der bourgeoise Tonfall „wir die Guten“ und da „die Bösen“ drang durch, auch wenn Emcke bemüht war, diesen Tonfall zu verschleiern. Das entschuldigt nicht das Verhalten von Rassisten und Menschenverächtern. Es verweist nur auf ein rationales Defizit in der Erklärung der Entstehung von Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Auch wenn der Marktliberalismus nicht an allem die Schuld trägt, existiert fast nur noch eine geldwerte Menschenwürde. Während die Menschenwürde überall angetastet wird, fühlen sich immer weniger Eigentümer zu irgendetwas außer sich selbst verpflichtet. Oberon hetzt die Individuen im Wettbewerb aufeinander und dann klagen wir über Streit? Der andere ist immer der Konkurrent. Noch einmal: Das entschuldigt nicht die Idioten, die voller Inbrunst Oberons Zaubertrank zu sich nehmen und dann die Juden, die Geflüchteten, die Muslime usw… hassen. Der eigentliche Zaubertrank ist die Lust, die Gier, und als Zutat die Illusion, wir, jeder könnte tatsächlich alles bekommen. Im größtmöglichen Glück der größtmöglichen Zahl der Menschen verbirgt sich der naturalistische Fehlschluss des Liberalismus. Vom Sein des bloßen Glücks wird auf ein Sollen des Glücks aller geschlossen. Aber Loki hat selbst erfahren, dass dieses größtmögliche Glück ein Fluch ist.
Das Gold, das der Zwerg besaß
wird zwei Brüdern den Tod bringen
und acht Edlen Streit.
Mein Schatz wird niemand nützen
So heißt es in der Lieder-Edda. Doch das ist auch nur eine Erzählung.
18. September 2019
All die unbewohnten Zimmer
Von Friedrich Ani
Erschienen 2019 im Verlag Suhrkamp
In seinem letzten Roman 2018 war er selbst verloren gegangen, der Mann von dem es heißt er
„bringe Verschwundenen ihren Schatten zurück“. In über 20 Romanen hat er nach vermissten Personen gesucht und verschwand dann selbst. Jetzt taucht Tabor Süden ganz unspektakulär wieder auf. Schon im
Prolog erscheint er auf der Bildfläche, verschwindet dann wieder über 100 Seiten und taucht am Hauptbahnhof Bier trinkend erneut auf, um dann später dazu beizutragen den zweiten Mord in diesem
Roman aufzuklären. Gemeinsam mit zwei weiteren Helden aus dem Ani-Universum, dem ehemaligen Mönch Polonius Fischer und dem inzwischen pensionierten Jakob Franck. Und hier setzt schon die eigentliche
Klammer dieses Romans an. Im Unterschied zu anderen Kriminalfällen sind hier nicht die Morde im eigentlichen Zentrum des Erzählens. Es gab ja zwei Morde. Der erste Mord ist schon nach 90 Seiten
aufgeklärt. Doch die Klammer bilden die Ermittler. Und im ersten Mordfall wird ein Polizist verletzt (versehentlich) und im zweiten Fall wird ein Polizist getötet. Eine weitere Klammer ist die
Einwanderung. Im ersten Fall tötete ein eingewanderter Italiener aus Furcht vor der Mafia und im zweiten Fall tötet ein Neo-Nazi einen Polizisten, der gerade zwei syrischen Kindern hinterher jagt.
Das einzige Ich in dem Roman stammt von Kriminalhauptmeisterin Fariza Nasri, sie lernte ihr Polizeihandwerk bei Jakob Franck, von ihm als „Lieblingssyrerin“ bezeichnet, und wird dann selbst zur
Mörderin aus Rache. Das verweist auf den eigentlichen Impetus des Autors. Hier wird mit Stereotypen (Stereotype sind gleichzeitig relativ starre, überindividuell geltende beziehungsweise weit
verbreitete Vorstellungsbilder, anders als Klischee oder Vorurteil beziehen sie sich rein auf Personen/Personengruppen) gespielt und auf diese spielerische Art werden sie aufgelöst, funktionieren
nicht mehr in unseren Köpfen. Die Neonazis entsprechen noch am ehesten unserem Stereotyp vom Neonazi. Aber immer treffen wir in dem Roman auf Menschen und auf ihre Schicksale. Ani dreht den
Opfer-Täter-Komplex nicht um. Aber er erzählt die blinden Flecken. Die beiden Mordfälle Anna Walther und Philipp Werneck gehören zwar nicht zusammen, aber beide Mordfälle schildern diese starren
Vorstellungsbilder von Menschen. Der erste Fall ist nur eine Art Vorspiel für den eigentlichen Fall: Der Mord an einem Polizeibeamten durch einen Nazi. Dass der Vater des Ermordeten selbst ein Nazi
ist, macht die Situation schon fast zu einem Familiendrama. Zumal der ermordete Polizist Philipp große Probleme mit seiner Freundin hatte und diese auch schlug. Im Binnenraum der Haupterzählung
kämpfen sich die beiden kindlichen Zeugen Mohamed und Hasim durch das bombardierte Aleppo. Sie bleiben auch in München immerzu auf der Flucht. Die Flucht wird zum Racket-System der beiden Kinder, bis
zum Ende als sie aus München flüchten, weil ihr Vater von einem Nazi erschlagen wird. Wer sonst sollte einen syrischen Vater in München erschlagen?
Jakob Franck, längst pensioniert, vermittelt für die Polizei noch Todesnachrichten. Als er Ralph Werneck die Nachricht übermittelt, dass sein Sohn Opfer eines Überfalls wurde, während er auf Streife
war, wissen wir Leser noch nicht, dass er mit der ehemaligen Smith&Wesson des eigenen Vaters erschossen wurde. Der wieder aufgetauchte Süden sucht sinnigerweise nach einem verschollenen
Alleinunterhalter. Der Alleingänger Süden sucht den Alleinunterhalter Soltau. Seine Arbeit kann er aber wohl nur im angetrunkenen Zustand verrichten. Schließlich war er selbst eben noch
verschollen.
Ani schwelgt in seinen Figuren, lässt den Leser durch München wandern und erzählt uns von reichlich kaputten Typen. So bekommt München einen Hauch Berliner Bushido.
Nun haben wir verunsicherten Zeitzeugen in der wirklichen Welt neulich ein ganz neues Wort kennen gelernt: Feindzeuge. Ich hörte das Wort zum ersten Mal in dem unerträglichen Interview
zwischen Gebhard und Höcke. Ich habe herauszufinden versucht, woher der Begriff „Feindzeuge“ kommt, denn im Duden steht der nicht. Die LTI ist bettelarm“ schrieb Klemperer. Und „Feindzeuge“ habe ich
weder im Duden noch sonst wo als Wort gefunden. Es kommt wohl aus dem Jargon des Verfassungsschutzes und wird als „Feindzeugen-Strategie“ vom Ex-Verfassungsschutzpräsident Helmut Roewer verwendet,
der wiederum der identitären Bewegung nahesteht. Bedenklich wie viele ehemalige Verfassungsschützer im rechten Lager auftauchen. Plötzlich ist das Wort in der Luft, fast so plötzlich wie
einer blutend auf der Straße liegt. Dass der Vater des ermordeten Polizisten ein Nazi ist, und sein Sohn mit seiner Waffe getötet wurde ist eine in dieser Hinsicht fremdzeugend schöne
Metapher.
Das einzige Ich der Erzählung ist – wie schon gesagt – eine syrisch-stämmige Polizistin, Opfer
einer Vergewaltigung durch den Staatsanwalt Gorden (die Sau). Der Sohn von Christopher Gorden heißt Jim Gorden. Da überlegte ich, ob Ani mit Absicht an Gotham City erinnern wollte, an den
mit Batman befreundeten Commissioner James (Jim) Gordon? Immerhin passt es ein wenig, dass Jim Gordons Hauptproblem in Gotham City korrupte Polizisten sind. Aber München ist zum Glück nicht
Gotham.
Im Unterschied zu vielen anderen Kriminalromanen (zuletzt ja der nasse Fisch), erzählt Ani in einer poetischen Sprache. Schon im Prolog seine Stimme war nicht viel mehr als betreutes
Schweigen, ich horchte ihr nach, so rasch war sie verstummt. Ani kann seinen Figuren sprachlich eine Tiefendimension vermitteln, die auch wichtiger ist, als die Mordfälle selbst. Mit
geschickten Vor- und Rückblenden, multiperspektivischem Erzählen und einem reichlichen Figurenkabinett zwingt uns Ani zur Langsamkeit. Er schafft es auch, seine vielen Stränge zusammenzubringen. Das
ist eine dramaturgische Leistung, auch wenn mir als Leser schon kurze Zeit nach Beenden des Buches nicht mehr ganz klar war, wer was mit wem zu tun hatte. Indra und Hanno geistern irgendwie durch
meinen Kopf und – das merkt man ja – tue ich mich mit einer stimmigen Besprechung des Buches schwer. Es geschah einiges, aber auch wieder nichts. Das ist aber auch die Kunst von Ani. Denn er blickt
auf die Nebenschauplätze und so werden die Details nebensächlich bedeutsam. Und es sind immer Details, die Stereotypen abbauen. Wer genau hinsieht, sieht immer Unterschiede. So ist Micha Gerg der
Sohn eines Lehrers. Vielleicht ist das ja nur ein Zufall. Im Epilog macht sich Fariza darüber Gedanken, was wäre wenn….
Es war auch ein Zufall, dass der angeschossene Polizist Gronsdorf gerade sein Frühstück holen wollte, als Anna Walther den Südtiroler Frey besuchen kam. Es war ein Zufall, dass der ermordete Polizist Werneck den syrischen Kindern hinterher lief, weil er frustriert war. Es war irgendwie auch Zufall, dass sein Kollege Tim Gorden ihm nicht folgte. Und es war Zufall, dass Hauser und Gerg gerade abseits der Demo auftauchten und so zu Polizisten-Mördern wurden. Was schützt uns vor so vielen Zufällen? Der genaue Blick auf die Details. Vielleicht erkennen wir das Leben vor allem am Kleingedruckten.
10. September 2019
Rita Münster
Von Brigitte Kronauer
Erschienen im Verlag Klett-Cotta 1983
Zu jungen Nachwuchsautoren soll Brigitte Kronauer einmal gesagt haben: „Macht was ihr wollt,
aber wollt auch etwas.“ Nun. In dem vorliegenden Roman macht Kronauer in der Tat was sie will, aber was sie will erscheint mir nicht so ohne weiteres erkennbar. Die wertenden Beobachtungen der
Erzählerin treiben uns womöglich die Illusion aus, wir könnten anderes, als eben wertend beobachten. So arbeitet der Text hier nicht mit dem Trick lebensechte Figuren zu schaffen, von Ruth bis Georg,
von Veronika bis Gaby. Im ersten Teil des merkwürdigen Romans beobachtet die bis dahin noch namenlose Ich-Erzählerin in Rondell-Form alle möglichen Menschen, die irgendetwas mit ihr zu tun haben. Im
zweiten Teil erfahren wir erstmals ihren vollen Namen. Doch Rita Münster verschwindet in diesen Alltäglichkeiten, muss sich sogar an einem Kalender festhalten. Da unsere Kopfmaschine permanent surrt,
permanent wahrnimmt, kommt man selbst nie zur Ruhe. Was Brigitte Kronauer auf überbordend poetische Weise beschreibt, ist der Tumult dieser Sinneswahrnehmungen. Im dritten Teil vermischt sich dies
mit allen Erinnerungen, denn zu allem Tumult der Sinneswahrnehmungen kommt ja noch, dass ein Teil davon abgespeichert wird und sich in den Stoffwechsel der aktuellen Sinneswahrnehmungen immer wieder
hineinmischt. Im Grunde ist es ein Wunder, dass bei diesen Ausschreitungen unserer Beobachtungen sowas wie Kohärenz entsteht. Mit unserem Willen organisieren wir diese Auf- und Ansichten, wir
spionieren uns dabei aus und versuchen festzuhalten, was immerzu Augenblick für Augenblick davon schwirrt. Die Tage rasen dahin, manchmal steht die Zeit im Stau, dann wieder zähflüssig verkehrend,
Begegnungen, Gedanken, Eindrücke. Hinzu kommt all das deklarative Wissen, manchmal nützlich, oft Ballast. Dieser zweite Roman von Brigitte Kronauer erschien erstmals 1983. Man fragt sich völlig zu
Recht, warum man diesen Roman heute lesen sollte. Es ist ein an seiner eigenen Sprachgewalt fulminant scheiternder Text. Es ist geradezu verschwenderische Prosa. Die einzige wirklich greifbare
Geschichte geht von Ruth aus und dem Scheitern ihrer Ehe mit dem Maler. Aber das ist ein so nebensächlicher Strang. Der Roman erinnert in seiner Struktur eher an ein Diary. Der erste Teil hat noch
eine formale Struktur in Form eines erzählerischen Figurenrondells. Der zweite Teil zerfranst, der dritte Teil ist fragmentarisch. In unserem Leben kommen wir selbst zu wenig vor. Obwohl wir
eigentlich der zentrale Ausgangspunkt unseres Daseins sind, haben alle anderen und alles andere mehr Bedeutung. Blicken wir in uns hinein, finden wir nur eine mehr oder weniger geordnete Ansammlung
dessen, was mal draußen war und dann über unsere Sinne in uns hinein kam. Das ordnende Ich, das fokussiert und Entscheidungen trifft, wirft all das in Form von Sprache wieder hinaus. Lesen wir also
diesen Roman, werden wir Teil eines dialektischen Vorgangs. Der Text als Extraktion von inhaliertem Draußen, wird von uns inhaliert und in irgendeiner mehr oder weniger geordneten, mehr oder weniger
bewussten Form wieder extrahiert. Dieses webende Wabern hat durchaus Ähnlichkeit mit dem Atmen. Der Spirit, der Hauch.
„Alles existierte ohne mein Zutun, ohne Gemeinschaft mit mir zu haben oder anzustreben, es sah alles in eine andere Richtung von seinem Entstehen an.“ Man könnte diesen Satz als einen Schlüsselsatz
betrachten. Dieses extrahierende Auseinanderstreben des Daseins immer wieder einzufangen ist vermutlich Ursache dieses Textes. Denn Rita Münster erzählt uns hier ihren persönlichen Ordnungsprozess,
gibt uns Einblicke in die chaotische Strukturbildung. So ein Text kann nur scheitern. Ja er ist sogar auf das Scheitern angelegt. Und genau das macht diesen Text eben zu Literatur. Das durchbricht
natürlich unsere Lesegewohnheiten. Eine Geschichte erzählen mit Anfang, Mitte und Ende, eine zentrale Figur mit der man sich durchgängig identifizieren kann (infizieren geradezu), eine Story die
einen Spannungsbogen aufweist, einen zentralen Konflikt und die angebotene Lösung des Konflikts. Alles das verweigert uns dieser Text. Wie ärgerlich. Ist das nur ein Verweigerungstext?
Befindlichkeitsprosa ist es dezidiert nicht. Denn Rita Münster findet sich ja nicht. Es ist vielmehr Unbefindlichkeitsprosa. So etwas hat durchaus eine literarische Tradition. Ich denke da zuerst an
Marcel Proust. „Ich habe neuerdings die Idee, dass alles auch ganz anders kommen könnte.“ Doch Ruth unterliegt einer Illusion, denn es kommt nicht anders. In dem unendlich verzweigten
Auseinanderstreben unseres Daseins liegen so viele Entscheidungen auf der Strecke, dass ein simpler Blick zurück belegt, wie weit wir schon zurückliegen. So ist das Leben nicht Selbstfindung, sondern
systematischer Selbstverlust. Zum Ende hin findet man sich dann noch als Kind. Am Anfang unseres Zeitbodens erscheint uns dieses Selbst wie ein ganz anderer. Wer also sind wir schon? „Aber nun, auf
einem Platz, mutwillig betreten, jetzt der lange Weg bis zur Mitte, es ist anders, als ich dachte, der Platz greift nach mir in seiner Ausdehnung, ich muss mich besinnen und wieder zu Kräften kommen.
Es ist ein Luftanhalten, Anhalten! Denke ich, nie wieder ausatmen! Kein leerer Platz mehr, ein gewaltiger Innenraum, ...“ Wir dehnen uns bis zum Ende aus und sind zum Ende genau dies, ein gewaltiger
Innenraum. Dies ist die Perspektive des Romans, der Innenraum von Rita Münster. All die Figuren, Gebäude, Städte, Pflanzen, Tiere befinden sich in diesem Innenraum. So ist der Text gestaltet und nur
so kann man ihn lesen. Es ist das Museum von Rita Münster. Aber mal im Ernst: Ein Leben in ein Museum stellen? Wie soll das denn funktionieren? Wer trifft denn die Auswahl darüber, welche Eindrücke,
Ereignisse oder Bedeutungen in die Vitrinen gestellt werden sollen? Denkt man an die typischen, zentralen Ereignisse eines Lebens, Geburt, Abitur, Hochzeit, letzter Arbeitstag. Unter Garantie haben
die meisten Menschen in ihren Erinnerungsvitrinen Sachen stehen, die – wollte man sie erzählen – irgendwie nicht rund klingen. Was unser Leben ausmacht, sind nicht die runden Geburtstage die man
feiert, sondern Eindrücke, die gar keinen Sinn ergeben, wenn man nicht das gesamte Museum als kompletter Innenraum im Blick hat. Man sitzt auf einem Hügel, schaut auf eine Straße, ist traurig, man
liegt im Bett, schweißgebadet, ist glücklich, draußen regnet es, man hat Zahnschmerzen und weiß nicht ein noch aus, es ist ein lauer Abend mit Freunden, die Bäume glänzen unter dem Laternenlicht.
Brigitte Kronauer erzählte uns in ihren Romanen von diesen Dingen, diesen Eindrücken.
Geboren wurde Kronauer 1940 in Essen; nach Pädagogik- und Germanistikstudium und
Tätigkeit als Lehrerin in Aachen und Göttingen kam sie Mitte der Siebzigerjahre in die Hansestadt. Hier begann sie ihre Laufbahn als Schriftstellerin. 1980 erschien ihr Debütroman "Frau Mühlenbeck im
Gehäus" bei dem Verlag Klett-Cotta, dem sie Zeit ihres Lebens treu blieb. Brigitte Kronauer starb nach langer und schwerer Krankheit am 22. Juli 2019 in Hamburg. Sie wurde 78 Jahre alt.
Ihr Werk zeichnet sich vor allem durch die Fähigkeit der Beobachtung von den scheinbar nebensächlichen Dingen und Ereignissen aus. Kronauer schaffte es immer wieder mit ihrer enormen Sprachkraft
unsere Perspektiven aufzusprengen. Sie erhielt zahlreiche Preise, unter anderem wurde ihr 2005 von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung der Büchner-Preis verliehen.
17. Juli 2019
Tage ohne Ende
Von Sebastian Barry
Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser
2018 im Steidl-Verlag auf Deutsch erschienen
2016 bei Faber and Faber unter dem Originaltitel „Days Without End“
Als ich kaum noch weiterlesen konnte bei der verstörenden Schilderung des Genozids an den Indianern, hörte ich das Lied, das Winona singt, als sie mit John Cole und Thomas Mc Nulty unterwegs waren auf ihren Maultieren zu Lige Magans Farm in Tennessie.
Dort heißt es in einer Zeile: And there I cut my lovely locks, I cut my locks and I
changed my name. Der 64jährige Autor und Dramatiker Sebastian Barry, selbst Ire, verzahnte in seinem
Neowestern aus der Zeit des Sezessionskrieges die Brutalität des Krieges, den massiven Rassismus der Frühzeit in der Nationbuilding der USA mit dem LGBT-Thema. Thomas McNulty trägt nicht nur
Frauenkleider, er fühlt sich auch wie eine Frau. Ich lege mich mit der Seele einer Frau zu Bett und wache auch mit ihr auf. So beschreibt es der authentische Ich-Erzähler in diesem
pikaresken Roman. Ja man findet alle literarischen Zutaten für einen Schelmenroman der Neuzeit: fiktive Autobiografie, ein Held niederer Herkunft, die Desillusionierung des Helden und seine
episodenhaften Abenteuer in der er die Schlechtigkeit der Welt erkennt. Und zugleich eine tiefe und wahrhaftige Naivität im Erzählen. Zugeben: Ich liebe den Picaro-Roman. Er ist zweifelsfrei meine
Lieblingsform. Vielleicht deshalb, weil ich - selbst von (ausgedachter) niederer Herkunft - mich gut mit diesen Erzählern identifizieren kann.
Im Rahmen der großen irischen Hungersnot wanderten die beiden Iren John Cole und Thomas Mc Nulty wie viele andere Iren nach Amerika aus. Die zweite Auswanderungswelle wurde vom kalifornischen
Goldrausch bestimmt und die dritte Welle vom Bürgerkrieg. Folgt man den Kriegsschilderungen in dem Roman hat man den Eindruck Iren kämpften gegen Indianer und Iren kämpften gegen Iren. Es ist daher
schon fast zwingend während der Lektüre dieses teilweise echt erschütternden Romans irische Traditionals zu hören, die auch alle so unendlich traurig ist. Was für eine Geschichte über die Kraft der
Liebe in schlimmsten Zeiten! Und was für eine gelungene Botschaft von Sebastian Barry! Während stumpfsinnige Rassisten wie Donald Trump ein riesiges immer noch gespaltenes Land regieren und
gleichzeitig an vielen Orten die Stimmen der Menschen lauter werden, die wie Thomas Mc Nulty sind, und diese Menschen immer wieder die Erfahrung von Hass und Misshandlung erleben, während dieser
Widersprüche zeigt dieser Roman eine verwirrende Sanftmut inmitten der Schilderungen brutalster Kriegshandlungen. Die häufigen peripatetischen Wendungen zeigen das ausgeprägte dramaturgische Können
des Autors. So wurde der Roman unglaublich spannend. Zugleich verblüfft der Text auch mit seinem Kenntnisreichtum in der Geschichte. In der Sprache werden viele Dialektausdrücke aus der Zeit
der Sezession verwendet, wie die Bezeichnung scalawag für weiße Sympathisanten der Republikanischen Partei. Scalawag ist eine Bezeichnung für minderwertiges Vieh und man bezeichnete
vermeintliche Opportunisten so, weil sie sich angeblich bereichern wollten an den Südstaaten. Nordstaatler nannte man Carpetbagger (Teppichtaschenträger). Nach dem Krieg kamen sie aus dem Norden mit
carpetbags und füllten sich diese Taschen mit dem Reichtum des Südens. Dabei wird ziemlich deutlich, wie zerlumpt und arm die Südstaatenarmee eigentlich daher kam. Allzu viel zu holen gab es da wohl
nicht – sieht man von der Landwirtschaft mal ab. Der Rassismus geht durch alle Reihen. Die unglaubliche Liebe von John und Thomas zu Winona ist auch in diesem Gegensatz so herzergreifend. Auch
Nebenfiguren wie der Dichter McSweny oder der Theatermann Nr. Noone. Selbst so bärbeißige Typen wie Starling Carlton bekommen ihre Sympathie-Werte. Die Dialoge sind knapp und so karg wie das
Leben der Menschen in dieser Zeit. Selbstverständlich kann man sich die Story als einen Film vorstellen und niemand anders als die Coen-Brüder sollten den Roman verfilmen. Und doch ist es nicht
ganz so einfach über den Roman etwas zu schreiben, was nicht metatextuell ist. So sehr trifft er eben auch einen gewissen Zeitgeist. Ein bisschen Gods and Generals (von Ronald F. Maxwall)
und The Proposition für den Nick Cave das geniale Drehbuch geschrieben hat. Im neuen Hollywood änderte sich der Western mit den Filmen von Sidney Pollack. Filme wie Der elektrische
Reiter über einen alkoholkranken Ex-Rodeo-Reiter dekonstrierten die Heldenverehrung der frühen Western-Darstellungen. Auch der Film The Wild Bunch von Sam Peckinpah oder Ride with
the devil von Ang Lee zielen in diese Richtung. Aber ihnen fehlt die Zärtlichkeit von Barrys Roman.
Amerika ist ein Land das von Hungerleidern, Kriminellen und Glückssuchern gegründet wurde. Es war ein Sklavenstaat und verübte an der indigenen Bevölkerung einen Genozid. Um was zu tun? Um – wie es
Thomas ab und an andeutet – ein Paradies zu erschaffen. Die Widersprüchlichkeiten und inneren Charakterbrüche der so glaubhaft gezeichneten Figuren gehen einem nah. Da ist der so gerechte Major
Neale, der seine geliebte Frau verliert und zum Monster wird. Da ist der Corporal Poulsen, der mit einem gewissen Widerwillen seine Pflicht tut, der immerzu schwitzende aber so treue Starling
Carlton, den Thomas töten muss, weil er Winona mehr liebt als ihn.
Nie verwendet Barry die Worte schwul, Transgender etc., klar, weil es sie damals gar nicht gab, aber gerade das Fehlen der Begriffe scheint auf wundersame Weise einen Möglichkeitsraum zu öffnen. Der
Brief von Corporal Poulsen an Thomas ist herrlich daher, weil er gar nichts anderes als Maskerade vermutete. Dass es weit mehr ist, dass Thomas eine Frau ist, das war nie in dessen Vorstellung. Und
so wird Thomas in seinen Frauenkleidern wie eine Frau behandelt.
Beeindruckend sind auch die Landschaftsbeschreibungen, diese extremen Gegensätze von Hitze und Kälte. Diese Naturhaftigkeit und Abwesenheit von Zivilisation ist ebenfalls wieder so zeitgemäß, weil
wir ja aktuell gar nicht mehr wissen, was eigentlich wirklich Natur bedeutet. Bei den Grünen hat man schon manchmal den Eindruck, dass die Lieblichkeit der Natur weichgespülter Pseudoromantik
entspringt. Barry macht uns mit den Augen seines Erzählers sehr deutlich, dass der Natur der Mensch ziemlich am Arsch vorbeigeht. Die ach so rettenswerte Natur wird den Parasiten und Mörder Mensch
ohne mit der Wimper zu zucken ausradieren und sich erholen.
Der deutsche Autor Alfred Döblin nutzte bewusst extreme Gewaltdarstellungen, um abschreckende Wirkung zu erzeugen. W.G. Seebald schrieb seine Dissertation über Döblin und kritisierte diese
Gewaltdarstellungen, da sie eher animierend wirkten, denn abschreckend. Was Barry aber so auszeichnet sind dabei nicht die Gewaltdarstellungen selbst, sondern sein wahrhaftiger Erzähler, der Teil der
Gewalt ist und zugleich nicht. Die moralische Verhandlung über diese Gewalt findet seine Gegendarstellung in der zarten Liebe zwischen John und Thomas und ihrer gemeinsamen Liebe zu Winona. Dieses so
natürliche und zarte, dabei aber auch kluge und umsichtige Indianermädchen das die beiden quasi adoptieren ist sicher eine der faszinierendsten Figuren – aber ich muss sagen, kaum eine Figur die
keine Spuren hinterlassen hat. Barry versteht es sehr gut, seine Figuren durch ihr Handeln zu zeichnen. Der Blick seines Erzählers macht die Figuren zu dem, was sie sind. Klar. Doch Thomas blickt mit
einer Glaubwürdigkeit auf sie, dass ich nicht zögere, sie auch so zu sehen.
Um also mit der Zunge von Amazon zu sprechen: Fünf Sterne für diese Stars and Stripes
Antiidylle.
07. Juli 2019
Hotel Savoy
Von Joseph Roth
Erstmals erschienen 1924 in der Frankfurter Zeitung und im gleichen Jahr im Verlag Die Schmiede
Ausgabe dtv 2003
Der aus dem Krieg in seine alte ostgalizische Heimat zurück kommende Ich-Erzähler Gabriel Dan
quartiert sich in dem Titel gebenden Hotel Savoy ein um sich ein paar Tage oder eine Woche auszuruhen. Sein Vorhaben war, sich Geldmittel zu verschaffen und dann weiter seinen Weg zu gehen.
Nun beschreibt er das Leben in diesem Hotel wie einen gesellschaftlichen Mikrokosmos mit den Gegensätzen von arm und reich. Oben wohnen die armen Menschen, die ihren Koffer an den Liftboy Ignatz
verpfänden, wenn sie die Hotelrechnung nicht bezahlen können. Schon von Anfang an wundert sich Gabriel Dan, dass der Liftboy ein alter Mann ist. Den Direktor des Hotels mit dem schwer zu sprechenden
griechischen Namen Kaleguropulos kennt niemand. Es ist am Ende als das Hotel brennt eine große Überraschung, als wir erfahren wer Kaleguropulos wirklich ist. Im Nachhinein lesen sich die vielen
Andeutungen wie selbstverständlich. Alle warten auf einen weiteren Heimkehrer, den Millionär Henry Bloomfeld, der ausgewanderte ostgalizische Jude hat in Amerika sein Glück gemacht. Als er endlich
kommt, wird er von allen umringt. Aber meist schweigt Bloomfeld und lässt seinen Sekretär alles regeln. Nach einer gewissen Zeit wird Gabriel Dan sein Sekretär und so zum Vermittler zwischen Reichtum
und Bittsteller. Bloomfeld ist ein zarter Mann mit Kinderhänden, der das Grab seines alten Vaters aufsucht und dort weint. Er ist kein Monster wie der Fabrikant Neuner. All die Reichen wohnen im
Hotel in den unteren Zimmern. Sie trinken Schampus und lassen die Mädchen nackt tanzen. Der Kriegskamerad Zwonimir beobachtet dieses Treiben mit revolutionärer Attitüde und zugleich mit sozialem
Neid. Joseph Roth, den man einmal auch als roten Joseph titulierte (Joseph Roth schrieb unter anderem für die sozialdemokratische Zeitschrift Vorwärts), entlarvt an der Figur Zwonimir, dass
der Unterschied zwischen arm und reich nicht nur materiell ist, sondern auch vom Habitus bestimmt wird. Im 15. Kapitel versaut Zwonimir mit seinem Auftritt den Stammgästen den Abend.
Immer mehr Heimkehrer kommen in die Stadt. Es sah aus als wollte ein neuer Krieg ausbrechen, beschreibt es Roth hellsichtig. Als Bloomfeld klammheimlich wieder abreist, kommt es schließlich
zum Aufstand und das Hotel brennt.
Sofort nach seinem Erscheinen löste der Roman ein großes Echo aus. Es war Roths erste
selbstständige Publikation im Verlag Die Schmiede. Roth war seit drei Jahren (1921) österreichischer Staatsbürger und seit zwei Jahren mit Friederike Reicher verheiratet. Er war gerade zum
Weimarer Starjournalisten aufgestiegen und seit 1923 Redakteur der Berliner FZ. In diesem Jahr erschien auch der Vorabdruck seines ersten Romans Das Spinnennetz in der
Arbeiterzeitung. Auch in diesem Roman steht ein Heimkehrer im Zentrum. Der Juden und Sozialisten hassende Leutnant Theodor Lohse kann sich nicht in die Gesellschaft einfügen und gerät in das
paramilitärische Netzwerk von Ludendorf und Kurt von Schleicher. Joseph Roth bekam in der Folge großes Gehör. Das Hotel Savoy brachte viele Befindlichkeiten dieser schwierigen Epoche auf den
Punkt. Die Gegensätze von arm und reich, die Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit der Kriegsheimkehrer, die industrielle Revolution. Gott strafte diese Stadt mit Industrie. Industrie ist die
härteste Strafe Gottes, schreibt Joseph Roth im 17. Kapitel. Mit dem Symbol „Amerika“ wird zugleich die Ferne der Aussichten und mit dem Warten auf Bloomfeld die Sehnsucht nach einem Wunder
offenbar. Dass sich der Hotelbesitzer hinter einer bediensteten Person verbirgt, zeigt darauf dass der mächtigste Mann, der Besitzer von 864 Zimmern und Herr über ein ganzes Reich für die Masse nicht
sichtbar ist. Und ganz ehrlich: Wissen wir heute im 21. Jahrhundert wer der Hotelbesitzer wirklich ist? Das Hotel als literarischer Topos für die Schilderung eines gesellschaftlichen Mikrokosmos ist
nicht neu. Vom Hotel Adlon bis zum Hotel Sacher steht das Grand Hotel für die transzendentale Obdachlosigkeit der Kriegsheimkehrer, wie das Georg Lukacs in seinem Grand Hotel, Abgrund von
1933 sprichwörtlich feststellt. ‚Von Vicky Baums Erfolgsroman Menschen im Hotel (1929) bis zu Franz Werfels Hoteltreppe ist der heterotrope Ort des Grand Hotels Symbol für die
existenzielle Krise des Subjekts in modernen Gesellschaften. In Kafkas Romanfragment Der Verschollene ist es das Hotel Occidental in das es Karl Roßmann verschlägt und in dem er selbst als
Liftboy arbeiten muss. Hier werden die frühkapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse präzise geschildert.
Fragt man sich, welchen Mehrwert dieser fast 100 Jahre alte Roman im Zeitalter der digitalen Revolution hat, kann man zumindest eine Metamorphose des Kapitalismus feststellen. Heute gibt es keine
Heimkehrer mehr, sondern Flüchtende. Auch Gabriel Dan will nicht bleiben. Er will weiter ziehen. Die Heimat, die Gabriel vorfindet besteht aus naiven Träumern wie Hirsch Fisch, aus traurig Suchenden
wie Alexander Böhlaug, Ausgebeuteten und Ausbeutern. Der Name des Variétes-Mädchens Stasia wird im Programm nicht genannt. Ausgegrenzt leben die Heimkehrer in Baracken. Ausgegrenzt leben die
Geflüchteten in Ankerzentren. Natürlich ist die Armut in den westlichen Industrienationen nur eine relative Armut. Aber global betrachtet verfügen 40 Prozent der Weltbevölkerung nicht über einen
Zugang zu einer Toilette. Heute ist das Hotel global geworden. Die Zimmerzahl ist erhöht worden und auf kaum mehr zu überblickende Stockwerke verteilt. Die wirklich Armen leben zwar weit weg, doch
kommen sie übers Meer und fallen den Schampus trinkenden Reichen in den Industrienationen zunehmend zur Last. Die Stadt von der Joseph Roth berichtet, hatte keine Kanäle und stank. An grauen
Tagen sah man am Rand des hölzernen Bürgersteigs in den schmalen, unebenen Rinnen schwarze, gelbe, lehmdicke Flüssigkeit, Schlamm aus den Fabriken, der noch warm war und Dampf aushauchte.
Unsere Städte sind sauber. Der Krieg ist weit entfernt und mit der Angst der Geflüchteten sind wir psychologisch überfordert. Ist auch unser Hotel ein reicher Palast und ein
Gefängnis?
Joseph Roth ist nicht leicht einzuordnen. Einerseits beschreibt er Fakten wie in der Neuen Sachlichkeit. Andererseits ist seine Sprache noch vom Stakkato des Expressionismus geprägt und vereinzelt
symbolistisch. Roth ist vielleicht auch wegen dieser Uneindeutigkeit heute noch gut lesbar, auch wenn die historische Patina des Textes sichtbar ist. Roths weiterer Lebensweg war dann geprägt vom
Exil in Ostende und in Frankreich. Berühmt ist auch seine Liebesgeschichte mit Irmgard Keun. Beide verbrachten ihre Zeit in Ostende und liebten den Alkohol. Keun beschrieb das Leben mit Joseph
Roth in ihrem Roman Kind aller Länder. Schließlich gehörte Roth (wie Zweig, Mann, Brecht oder Feuchtwanger) zum großen literarischen Haupt das sich in Sanary sur Mer an der französischen
Riveria im Exil wieder fand. Er schrieb für die berühmten Exilzeitschriften von Querido und Allert de Lange, für das Pariser Tageblatt und auch für Klaus Manns Die Sammlung. Am 27. Mai
1939 stirbt Joseph Roth in einem Pariser Armenspital an den Folgen einer Lungenentzündung und eines kalten Entzugs (Delirium). Er war wenige Tage zuvor in seinem Stammcafe Tournon zusammengebrochen –
wie es heißt nachdem er vom Selbstmord Ernst Tollers erfuhr. Roths letzter Text wenige Tage vor seinem Tod trägt den Titel: Die Eiche Goethes in Buchenwald. Dort drückt Roth einerseits seine
Verbundenheit mit den Klassikern aus und andererseits seinen tiefen Hass gegen den Nationalsozialismus.
05. Juni 2019
LTI – Notizbuch eines Philologen
Von Viktor Klemperer
Erstmals 1947 im Aufbau-Verlag Berlin erschienen,
Reclam 2010, herausgegeben von Elke Fröhlich
Wenn ein Verkehrsminister die „Aktion Abbiegeassistent“ startet, wenn eine Bildungsministerin
wieder und immer wieder von „Kulturschaffenden“ spricht (Wilhelm Emanuel Süskind widmet diesem Wort ein ganzes Kapitel in seinem Buch Aus dem Wörterbuch des Unmenschen), dann verwenden diese
beiden Politiker Worte aus der LTI. Die „Aktion“ gehörte von Anfang bis zum Schluß zu den unverdeutschten und unentbehrlichen Fremdwörtern der LTI schreibt Klemperer (Seite 82) und es ist
deprimierend, wenn Julia Klöckner einen „Nationalen Aktionsplans IN FORM“ gründet und den „Ernährungsführerschein“ für Kinder einführt. Das ist nazistische Sprache vom Feinsten. Das übertrifft bei
weitem jeden AFD-Politiker. Das soll nicht bedeuten, die gesamte CDU sei nationalsozialistisch. Sicher nicht. Aber die dauerhafte Beschwörung der Geschichte steht in einem sonderbaren Widerspruch zum
Sprachbewusstsein. Insofern wirkt der „nationale Aktionsplan Integration“ von Angela Merkel direkt unheimlich. Und die bayrischen „Ankerzentren“ machen es nicht besser.
Angesichts der verhängnisvollen Rolle, die das Wort bei der Vernichtung von Behinderten und Juden gespielt hat, könnte es befremden, dass eine Organisation zur Förderung von Behindertenprojekten
„Aktion Mensch“ (früher „Aktion Sorgenkind“) heißt und sich ein ursprünglich von der Evangelischen Kirche initiiertes Freiwilligenprogramm für Arbeitseinsätze in Ländern, die besonders unter der
NS-Herrschaft gelitten haben, „Aktion Sühnezeichen“ nennt. So berichtet Matthias Heine (Kulturredakteur der WELT). Aber Heine schreibt auch: Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass selbst
belastete Wörter wieder frei werden können. Ich bin mir da nicht sicher. Während des Lesens der LTI stellte ich mir immerzu die Frage, ob die Geschichte eines Wortes nicht auch eine
Geschichte des Stils und des Geschmacks ist. Nicht standardisierte Sprachvarietäten werden zum Jargon, zum unverständlichen Gemurmel. Klemperer schreibt, dass man solche Wanderungen nach Zeit, Raum
und Sozialschichte untersuchen müsse und bringt dann eine treffende Anekdote: Irgendwer hat mir erzählt, die Gestapo habe einmal in Berlin ein Gerücht ausgegeben und dann untersuchen lassen, in
welcher Zeit und auf welchem Wege es bis München gelangt sei. So beschreibt Klemperer im neunten Kapitel die Melioration des Wortes „fanatisch“. Klemperer fragt sich, ob man die Epitheta
(Attribut in Form eines Adjektivs) „düsterer Fanatiker“ und „liebenswürdiger Schwärmer“ tatsächlich vertauschen könne. Dem Wort bleibt etwas und die Art der Verwendung, die Erscheinungsform des
Wortes (eben der Stil) ist eine Folge von Prozess und Resultat, also einer Tat. Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern Handlung. Jeder Schriftsteller weiß das. So blieb in dem Wort
„fanatisch“ die Tat erhalten. Die Nationalsozialisten waren in der Tat „fanatisch“ und zwar im schlechtesten Sinn des Wortes. Etwas schön zu reden, was hässlich ist (der berühmte Euphemismus) macht
es nicht schöner. Das altgriechische Wort „Krise“ meint eine Entscheidung, eine Zuspitzung, einen Wendepunkt. Klemperer beschreibt sehr nachdrücklich, wie die nazistische Sprache das Wort
„Krise“ missbrauchte. Und gerade dieses Wort kommt im Jargon der Reden bürgerlicher Politiker des 21. Jahrhunderts inflationär vor. Von der Euro-Krise zur Landwirtschaft-Krise über die multilaterale
Krise zur Krisenregion (die meist schon jenseits aller Krisen nichts als ein Haufen Schutt ist), findet das Wort seinen Eingang in den politischen Sprachgebrauch. Der Mechanismus, den Klemperer nicht
müde wird zu beschreiben, macht sich nicht an einzelnen Worten aus, sondern am Gebrauch der Worte. Das Drama der Verhunzung solcher Worte beschrieb schon Thomas Mann. In dem berühmten Aufsatz
„Bruder Hitler“ (1939 in „Das Neue Tagebuch“) spricht er von „Verhunzung“: „Und wirklich, unserer Zeit gelang es, so vieles zu verhunzen: Das Nationale, den Sozialismus – den Mythos, die
Lebensphilosophie, das Irrationale, den Glauben, die Jugend, die Revolution und was nicht noch alles.“ So ist die Romantik nicht die Ursache (wie Klemperer meint), sondern weiteres Opfer
nazistischer Verhunzungen. Wenn auch ein leichtes. Romantik ist ein zu schillernder Sammelbegriff. Das Drama der stilistischen Sauereien ist kein Alleinstellungsmerkmal der 1930er Jahre. Nazistische
Sprache ist kein einmaliges historisches Ereignis, das man analysiert, beschreibt und dann in die Regale der Geschichte stellt, sondern ein Muster, das zur Wiederholung neigt und dabei variiert.
Daher ist Klemperers LTI zeitlos und ein Lehrstück auch im Umgang mit der Sprache im 21.Jahrhundet. Es geht nicht darum, eine Sprachpolizei aufzubauen, die – wie der VDS oder ein Barocklyriker – uns
mit akademischer Gelehrsamkeit den Alexandriner um die Ohren haut. Im Talmud gibt es eine Lieblingsstelle von mir:
Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden zu Worten.
Achte auf Deine Worte, denn sie werden zu Handlungen.
Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten.
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter.
Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal.
Der Gebrauch von Worten ist mehr, als nur eine Oberfläche. In der LGBT geht es um mehr, als einen moralinsauren Zeigefinger. Es geht auch nicht darum, dass man jede sprachliche Entgleisung rituell abstraft. Es geht vielmehr darum, ein Bewusstsein zu entwickeln, das vom Gebrauch meiner Worte auch wieder zurück reflektiert auf meine Gedanken, meine Lebenshaltung und so weiter.
Nominalstil, Hyperbeln, Dichotomien oder apodiktische Setzungen sind nicht per se giftig. Wie
in der Medizin macht hier die Dosis das Gift. Hitlers „Mein Kampf“ ist vollgestopft mit diesen Stilmitteln. Ein schönes Beispiel für eine apodiktische Setzung aus dem Kampf: Was wir heute
an menschlicher Kultur, an Ergebnissen von Kunst, Wissenschaft und Technik vor uns sehen, ist nahezu ausschließlich schöpferisches Produkt des Ariers. Gerade diese Tatsache aber läßt
den nicht unbegründeten Rückschluß zu, daß er allein der Begründer höheren Menschentums überhaupt war, mithin den Urtyp dessen darstellt, was wir unter dem Worte „Mensch“ verstehen. (Seite 317
Kapitel 11 Volk und Rasse) Würde man hier nach Argumenten fragen: Woraus schließen sie, dass alle menschliche Kultur das Produkt der Arier sei, dann würde wohl nichts kommen. Aber Hitler
schreibt von einer „Tatsache“, was lediglich eine Unterstellung ist, nirgends bewiesen wird und nur durch das Wort „Tatsache“ zur Wahrheit mutiert. So könnte man zum Beispiel genauso behaupten:
Was wir heute an menschlicher Kultur, an Ergebnissen von Kunst, Wissenschaft und Technik vor uns sehen, ist nahezu ausschließlich schöpferisches Produkt Außerirdischer. Gerade diese
Tatsache…
Das Gegensatzpaar „Arier – Jude“ ist heute entlarvt und es ist durch und durch unzeitgemäß. Das Gegensatzpaar „Freiheit – Totalitarismus“ dagegen findet inflationären Gebrauch und dient nicht selten
apodiktisch gesetzten Propaganda-Methoden. Welcher Diktator würde seinem Volk schon sagen: „Hey, ich führe euch in die Unfreiheit und versklave euch, damit ihr für die Großindustrie produktiv sein
könnt, und wenn ihr alt seid, verreckt doch einfach.“ Wenn man Politiker der Lüge bezichtigt, ist man lediglich naiv. Was man aber fordern kann, sind Belege, Beweise und Transparenz der Methoden.
Zuletzt hat das der Blogger Rezo auf bestechende Weise gemacht. Es sind nicht die Lügen, die so entsetzen, es sind die Taten oder die Tatenlosigkeit. Und all das zeigt Viktor Klemperer in seiner LTI.
Die Verschränkung seines privaten Lebens in der Zeit der Schreckensherrschaft mit seiner Sprachanalyse, ist der erhellende Faktor. Die Unmittelbarkeit des Erlebten macht uns viel mehr bewusst, als
jede formalistische Analyse.
Was die Herausgeberin Elke Fröhlich vielleicht noch hinzufügen hätte können, wäre ein Verzeichnis der LTI im Anhang. Der Historiker Friedrich Stieves (Kommentar 294,12) starb nicht 1945, sondern
1966. Und Dietrich Eckart (Kommentar 182,4-6) war der Mentor von Hitler und der erste, der ihn als „Führer“ glorifizierte. Nach ihm wurden Schulen und Straßen benannt.
04. Juni 2019
Der Fall Meursault
Von Kamel Daoud
Aus dem Französischen
von Claus Josten
Erschienen 2016
im Verlag Kiepenheuer & Witsch
Wenn man in einen ebenen Spiegel blickt, erscheint ein unverzerrtes, wahrheitsgetreues Abbild
des eigenen Gesichtes. Nur: Die Händigkeit ist vertauscht. Die linke Gesichtshälfte erscheint im Spiegel rechts und die rechte Gesichtshälfte im Spiegel links. Wie ein Widerspruch wirkt es, dass oben
und unten dabei nicht vertauscht wird. Und eigentlich zeigt der Spiegel damit die hintere Seite der vorderen Seite. Heute ist Mama gestorben, lautet der erste Satz des 1942 erschienen Romans
von Albert Camus über einen Fremden namens Meursault, der einen Araber erschießt ohne eigentlich dafür ein erklärendes Motiv zu haben. Mama lebt – immer noch! Lautet der erste Satz in dem
Roman von Kamel Daoud. Der 1970 geborene in Oran lebende algerische Schriftsteller Daoud hält Camus den Spiegel vor und herausgekommen ist eine feine Novelle, erzählt von Haroun, dem Bruder des
von Meursault ermordeten Arabers. Daoud gibt dem toten Araber einen Namen und eine Geschichte. Aber der Untertitel Eine Gegendarstellung täuscht. Daoud geht diffiziler vor und lässt seinen
Erzähler, den alten Weintrinker und Bruder des ermordeten Moussa und Sohn der Witwe, Haroun, scheinbar ausschweifend und flanierend durch die problematische Vorlage Camus schweifen. Daoud geht dabei
tief in die Details und es ist natürlich von Vorteil, wenn man die Vorlage kennt. Aber wer kennt sie nicht? Nach diesem Buch kennt man sie ganz neu und erlebt, dass der Held bei Camus in seinem
rassistischen Vorurteil verharrt und die Araber nie bei ihrem eigentlichen Namen nennt. Es sind nur die Araber. So nennt Haroun die Franzosen Roumi. Auch Haroun begeht einen Mord an
einem Roumi ohne erkennbares Motiv. Meursault wird verurteilt, weil er den Tod seiner Mutter nicht betrauerte und Haroun wird verurteilt (bzw. beinahe), weil er den Roumi erst am 05. Juni 1962
erschossen hat (einen Tag nach der Befreiung Algeriens). Einen Tag zuvor wäre es völlig in Ordnung gewesen. Beide Urteile sind absurd. Bewusst gibt ihm Haroun einen Namen und ermöglicht dem Opfer
eine eigene Persönlichkeit. Der ermordete Joseph Larquais ist damit keine reine Metapher mehr. Haroun konkurriert gegenüber seinem verhassten und zugleich verehrten Vorbild Meursault um die Frage,
für wen von ihnen beiden das Leben absurder ist. Schon das ist eine komische Konkurrenz. Hinter der zarten und poetischen Sprache (nur eins der zahlreichen Beispiele: das ist Mousas einziges
Buch. Kürzer als ein letzter Seufzer, der in drei Sätzen auf dem ältesten Papier der Welt sichtbar wurde, auf seiner Haut) verbirgt sich ein tiefgründige Humor, der in der Szene des Verhörs mit
dem Offizier der Befreiungsarmee besonders zum Vorschein kommt. Scheinbar larmoyant schwadroniert der um sein eigenes Leben betrogene Haroun um die Geschichte seines ermordeten Bruders herum. Und
doch ist es so tiefgründig, wie er die Trauer beschreibt und die bleierne Decke, die sich über die Beziehung zwischen seiner Mutter und ihn legte. Daoud deckt den versteckten Rassismus in Camus Werk
auf und zeigt, wie gerade dadurch wieder nur Rassismus auf der anderen Seite erzeugt wird. Ausgerechnet der Sohn des ermordeten Arabers, des Märtyrers, schließt sich nicht dem Widerstand, der
Befreiung von den Kolonialherren an. Dennoch rächt er seinen Bruder. Für seine Mutter. Der eigentliche Frevel Meursaults war ja, dass er keine Trauer zeigte nach dem Tod seiner Mutter, dass er mit
einer Freundin (Marie) ins Kino ging. Als Meriem auftaucht um Mutter und Sohn erstmals darüber zu berichten, dass der Mörder ein Buch geschrieben hat, kommt schonungslos heraus, dass weder die Mutter
noch der Sohn davon wussten, dass das Konterfei des Mörders allen bekannt war, aber nicht den letzten Hinterbliebenen. Die Mutter ging lieber zu einem leeren Grab um dort zu beten, oder verfluchte
das Meer. Die aufgehobenen Zeitungsartikel in französischer Sprache konnte sie gar nicht lesen. Kamel Daoud schreibt seine Romane in französischer Sprache. Über ihn wurde eine Fatwa verhängt und er
äußerte sich in Le Monde kritisch zu den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015/16 in Köln durch maghrebinische Migranten. Unter anderem beklagte er eine Naivität des Westens, der die
Gegensätze zwischen westlicher und islamischer Kultur herunterspiele. Er wurde daraufhin von einer Gruppe von neunzehn französischen Intellektuellen angeklagt, Islamophobie zu schüren und Pegida zu
unterstützen. Wie sein Held Haroun sitzt auch Daoud zwischen den Stühlen. Selten ein bequemer Platz. Heute spricht man auch vom so genannten „positiven Rassismus“, der Fremden nur aufgrund ihrer
Fremdheit Vorteile gewährt. Tötet man aus den richtigen Gründen ist es kein Mord, sondern eine Heldentat. Für jeden Kantianer ist das eine Form des Vernünftelns. Hier werden spezielle
Interessen über eine allgemeine Maxime gestellt. Auf diese Weise lässt sich jeder Krieg als eine heilige Angelegenheit verkaufen. Konsequenterweise will auch Haroun zahlreiche Zuschauer die ihn
unbändig hassen. Haroun erträgt es kaum, dass seine Schuld genauso unbeglichen bleibt, wie die Schuld von Meursault. Aus den falschen Gründen verurteilt zu werden ist nicht weniger
absurd, wie aus den falschen Gründen frei gesprochen zu werden. Natürlich gab es Greueltaten der Kolonialherren. Aber es gab auch Greueltaten der so genannten Befreier. Und die im Roman geschilderte
Hetzjagd auf Franzosen ist nicht besser, nur weil andere Franzosen vorher das gleiche getan haben. Die Moral des Auge um Auge und Zahn um Zahn ist eine alte und grausame Anomalie menschlichen
Zusammenlebens. Es war vor allem Immanuel Kant, der mit seinem kategorischen Imperativ damit vollständig aufgeräumt hat. Wie ist das mit Totschlag aus Rache? Könnten wir ernsthaft wollen, dies zu
einem allgemeinen Gesetz werden zu lassen? Sicher nicht. Umso entsetzter muss man über die französischen Intellektuellen sein, die Daoud der Islamophobie bezichtigten. Wie billig! Und wie dumm.
Religion ist Privatsache. Und dass Daoud und auch sein Protagonist Haroun unter dem öffentlichen Druck der Religion leiden ist in der Geschichte der Menschen kein Einzelfall. Haroun erlebt seine
eigene und private Befreiung, als er den Franzosen Joseph tötet und zwar für seine Mutter. Er beschreibt das wie einen Orgasmus und verweist damit auf die romantische Entgrenzung. Deshalb kann er
auch nicht mehr lieben (Ein Verbrechen schadet immer der Liebe und macht es unmöglich zu lieben). Denn das ist auch Entgrenzung. Der Druck wird zum Überdruck und es kommt zur
Explosion. Wenn die Schleusen geöffnet sind, ist das Morden und Töten für eine Sache möglich. Daoud kritisiert in seinem Roman sehr deutlich, dass es so eine Sache für die man töten könnte gar nicht
gibt. Es ist so oder so absurd. Bis hin zum allgemeinen Urteil in dem wir alle Privilegierte sind. Es gibt da keinen Grund, für den es zu sterben gilt. All die Märtyrer, all die Racheengel
befinden sich im absurden Ungrund. Wenn überhaupt, dann gibt es einen Grund zu leben und im Leben dem ganzen Unternehmen einen Grund zu geben. Jeder Tod ist das Gegenteil von Grund. Der Tod ist
bodenlos. Oder wie es Haroun seinem namenlosen Gast nahe legt: Der einzige Vers im Koran übrigens, der in mir nachklingt, ist der hier, mein Lieber: „Wer auch nur eine einzige Seele tötet, für
den soll es sein, als habe er die ganze Menschheit getötet.“
Ein alter Mann in einer Taverne trinkt Wein und erzählt einem Unbekannten (einem Namenlosen wie der Araber in Camus Der Fremde) seine Geschichte. Er wollte nie einen Roman schreiben, aber
träumte doch davon, einen zu verantworten. Und das ist die eigentliche Botschaft dieses – wie ich finde – genialen Romans: Verantwortung. Wir setzen uns selbst einen Zweck und müssen für die
Folgen auch einstehen. Sonst ist das Leben nur noch willkürlich und sinnlos.
14. Mai 2019
Irrungen, Wirrungen
Von Theodor Fontane
erstmals erschienen 1887
in der Vossischen Zeitung
… und sagte mit so viel Leichtigkeit im Ton, als er aufbringen konnte: „Was hast du gegen
Gideon, Käthe? Gideon ist besser als Botho. So nüchtern endet die Romanze zwischen dem Baron Botho von
Rienäcker und der Schneidermamsell Magdalene (Lene) Nimptsch. Der Roman des 1819 geborenen Apothekersohnes Theodor Fontane spielt in den 1870ern, wie mehrfach deutlich wird, ziemlich klar im
14. Kapitel, als Rienecker das Grab des 1856 bei einem Duell erschossenen Berliner Polizeipräsidenten Hinkeldey besucht (Das war nun an die zwanzig Jahr, dass der damals Allmächtige zu Tode
kam). Der Roman stieß bei den Lesern fast durchgängig auf Kritik, ja heftige Ablehnung. Selbst einer der Mitinhaber der Vossischen Zeitung äußerte der Schriftleitung gegenüber: „Wird denn die
gräßliche Hurengeschichte nicht bald aufhören?“. Der Roman galt als zu freizügig und es kam einem Skandal gleich, dass Fontane das Bürgermädchen Lene gegenüber der adligen Käthe (geschwätzig)
als moralisch überlegen schilderte. In heutiger Lesart verweist der Roman auf die Zeit der Gründerjahre, den Aufstieg des Bürgertums und die Dekadenz des Adels. So wird Botho als zu weich und
nachgiebig geschildert und zudem ist er fast bankrott und sieht sich aus ökonomischen Gründen gezwungen eine standesgemäße Ehe vorzuziehen. Lene hingegen heiratet schließlich Gideon Franke, der über
die bürgerliche Freiheit verfügt Lene zu akzeptieren obwohl sie schon zuvor ein Verhältnis hatte. Gideon Franke verkörpert den aufstrebenden Bürgertypus. Der Name „Gideon“ (Zerstörer) ist nicht
umsonst gewählt. Gideon Franke wird bei aller Freiheit als tief religiös dargestellt und gründet doch seine eigene neue Moral im Sinne des bürgerlichen Individualismus: Denn er war ein
Konventikler und hatte, nachdem er erst bei den Mennoniten und dann später bei den Irvingianern eine Rolle gespielt hatte, neuerdings eine selbstständige Sekte gestiftet(17. Kapitel). Sein
mehrfach erwähnter Stehkragen (Vatermörder) ist ein modisches Indiz für die Gesinnung des Biedermeier und des Vormärz. In seinen jungen Jahren war Fontane selbst ein Republikaner, bis er aus
ökonomischen Gründen für die preußischen Reaktionäre arbeitete.
Eine entscheidende Wende nimmt der Roman im dreizehnten Kapitel, als das gesellschaftlich ungleiche Paar am Westufer des Zeuthener Sees (Hankels Ablage) einen Ausflug macht und dabei auf Bothos
Freunde aus dem Club trifft, die in Begleitung ihrer Hetären sind. Lene erfährt nun sehr deutlich das gesellschaftliche Gefälle und ihr wird klar, dass die Verhältnisse nie zulassen würden, dass sich
diese Liebe erfüllt. Sie ist daher vernünftiger als Botho und beendet die Beziehung. Botho gibt ihr nach und geht die Vernunftehe mit Käthe ein. Sie ist eine heitere, blonde Frau und wird durchaus
umschwärmt. Sie ist damit eine gute Partie. Aber für Botho ist sie eine Qual, sie ist nicht authentisch, nicht tief. Der Adel mit seiner ganzen Oberflächlichkeit kulminiert in dieser Ehe. Lene
dagegen heiratet schließlich den deutlich älteren Bürgerlichen Gideon, dessen sektiererisches Verhalten Böses ahnen lässt.
Anfangs bei den ersten Kapiteln hatte ich manchmal den Verdacht, Botho interessiere sich mehr
für die Frau Dörr, jener Anstandsdame die auch schon mal eine gescheiterte Liebe mit einem Graf hinter sich gebracht hatte und dann mit Hans Dörr einen geizigen Bürgerlichen mit Pockennarben
heiratete. Bis die beiden endlich wirklich für sich sein konnten, brauchte es ganze zwölf Kapitel. Doch dann, ab dem dreizehnten Kapitel, nimmt die Geschichte Fahrt auf.
Die Abschiedsszene zum Ende des vierzehnten Kapitels ist herzzerreißend. So stand sie noch lange, bis sein Schritt in der nächtlichen Stille verhallt war.
Auch der Tod von Lenes Pflegemutter ist ergreifend geschildert. Wie die polternde Frau Dörr sich an das Pflegebett setzt und zur letzten Zeugin von der alten Frau Nimptsch wird und diese ihren letzten Wunsch äußert das mag altertümeln, aber es ist doch ein beredtes Zeugnis der Gefühligkeit des Biedermeier. Als Botho während der Kurabwesenheit von Käthe die Liebesbriefe von Lene betrachtet und anschließend verbrennt, bringt er diese Gesinnung auf den Punkt. Über Lene äußert er sich so: Ach, sie hatte die glücklichste Mischung und war vernünftig und leidenschaftlich zugleich. Alles was sie sagte, hatte Charakter und Tiefe des Gemüts. Arme Bildung, wie weit bleibst du dahinter zurück. Und diese Tiefe und Vernunft ist auch bei Frau Nimptsch (Pflegemutter) deutlich spürbar. Im Vordergrund stehen also das Gemüt und die Tiefe dieses Gemüts. Während Käthe alles Mögliche liest und trotzdem oberflächlich bleibt, ist es nicht die Bildung, sondern die Herzensbildung, die viel Freud, viel Leid, Irrungen, Wirrungen verursacht und damals positiv bewerten wurde.
Die Wiener Zeitung und die FAZ widmen dem Autor zu seinem200ten Geburtstag Artikel in dem sie sich vor allem mit dessen journalistischer Arbeitsweise der „unechten Berichterstattung“ beschäftigen. Fontane hat viel als Journalist von englischsprachigen Zeitungen abgeschrieben und war wie sein selbsterklärter Schüler Thomas Mann ein Meister des copy and paste. Fontane wie Thomas Mann waren Meister darin mit den Mitteln der Montage Emotionen zu evozieren. Fontane war Apothekergehilfe. Seine prekäre Lebenssituation und die Tatsache, dass er einer literarischen Honorartätigkeit nachging und keinen Mäzen hatte, erklären durch den Arbeitsdruck auch die Methode. Insofern – um den Bogen wieder zum Text zu spannen – ist es nicht unbedeutend, dass Bothos Entscheidung für die Vernunftehe einerseits auf Lenes Vernunft und auf seinem eigenen ökonomischen Druck beruht. Liebe? Wer die will, der muss auch zwischen den berühmten Zeilen lesen und darf sich nicht von gesellschaftlichen Konventionen in die Irre führen lassen. Und gerade zu diesen gesellschaftlichen Konventionen hat uns Fontane auch heute noch einiges zu sagen. So heißt es im siebzehnten Kapitel einmal: …dass mit Käthe wohl ein leidlich vernünftiges, aber durchaus kein ernstes Wort zu reden war. …als ob sie der Fähigkeit entbehrt hätte, zwischen wichtigen und unwichtigen Dingen zu unterscheiden. Botho geht eine Vernunftehe mit einer Frau ein, die dieser Vernunft gar nicht entspricht und er verzichtet aus Vernunft auf Liebe und die vernünftige Partnerin. So könnte man in dieser Dialektik sogar vermuten, dass Fontane uns sagen will, dass es eigentlich vernünftiger sei aus Liebe (sprich Unvernunft) zu heiraten. Das Gefühl und die Tiefe unseres Gefühls machen uns erst vernünftig. Verstand ohne dieses Gefühl verhindert, dass wir die wirklich wichtigen Dinge von den unwichtigen Dingen unterscheiden können. Und die Liebe gehört zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben.
08. Mai 2019
Der nasse Fisch
Von Volker Kutscher
Erschienen 2007
im Verlag Kiepenheuer & Witsch
Der von Köln nach Berlin versetzte Kommissar Gereon Rath ermittelt vom 28. April bis zum 21.
Juni 1929, also exakt vor 90 Jahren in einer ganzen Reihe von Todesfällen. Mitten im Umfeld des mondänen Berlin der späten 1920er, den als Blutmai in die Geschichte eingegangenen Berliner Maiunruhen
1929, soll ein geheimnisvoller russischer Goldschatz einen großen Waffenkauf für die nazistische Vereinigung ehemaliger Reichswehrsoldaten, dem Sturmhelm, ermöglichen. Mit verwickelt ist Raths
Kollege von der Sitte Bruno Wolter, der dann auch zu seinem Intimfeind wird und in einer dramatischen Schlussszene grausam ums Leben kommt. Neben Rath und Wolter stehen auch historische
Persönlichkeiten im Zentrum des Romans, unter anderem der sozialdemokratische Berliner Polizeipräsident Karl Friedrich Zörgiebel (1878-1961) der sich weigerte das im Dezember 1928 zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erlassene Demonstrationsverbot aufzuheben, oder Ernst August Ferdinand Gennat (1880 – 1939), der schon zu Lebzeiten eine Legende unter
Kriminalisten war und den man – wie im Roman – als Buddha oder „der volle Ernst“ bezeichnete. Das im Roman erwähnte „Mordauto“ wurde von ihm eingeführt. Gennat verbesserte die Arbeit der
Spurensicherung.
Einem größeren Publikum wurde Kutschers Roman bekannt durch die Fernseh-Serie Babylon Berlin. Auf der Grundlage des Romans schuf Tom Tykwer die bislang teuerste deutsche Fernsehserie (40
Millionen Euro Kosten). Ursprünglich funktionierten Literaturverfilmungen, weil der Roman bereits große Bekanntheit hatte. Der Topos der Literaturverfilmung musste sich am Roman messen. Das hat
sich längst umgedreht. Inzwischen misst sich der Roman an der Verfilmung. Ich erinnere mich noch gut an die typischen Redewendungen, dass die Literaturverfilmung enttäuschend war. Inzwischen
beherrschen die Synergie-Effekte den Markt. Merchandising verursacht sogar das Fanzine-Phänomen, in dem der Film nacherzählt wird. Die Stärke von Berlin-Babylon sind fast magische,
suggestible Bilder und ein Titelsong mit enormer Kraft, der die Dekadenz der Weimarer Republik feiert. Die litauische Schauspielerin Severija Janušauskaitė (spielt die Gräfin Sorokin) singt Zu
Asche zu Staub in androgyner Kostümierung mit schwarzem Ledermantel, Zylinder, Fliege und angeklebtem Menjou-Bärtchen. Sie soll auch an Anita Berber (1899-1928) erinnern, die als eine der ersten
Frauen Herrenhosen trug. Mit Smoking und Monokel, kreidebleicher Haut und aufgemalten Augenbrauen prägte sie eine Mode, die u.a. von Marlene Dietrich (1901-1992) übernommen wurde.
Dekadenz, Hyperinflation, Rausch. Das Moka Efti im Roman kommt gediegener daher und steht auch nicht so sehr im Zentrum. Das Berlin-Bild von Volker Kutscher ist im Roman zwar auch sehr dominant, wir
fahren oft mit Gereon Rath durch die Berliner Straßen und Ortsteile. Aber im Gegensatz zur Neuen Berliner Straße der Babelsberger Filmstudios (dort wurden große Teile der Serie gedreht),
sind die vielen Baustellen mehr nervig, als mondän. Gereon Rath ist auch kein Zitterer (wie im Film), sein Kokainkonsum im Roman beschränkt sich auf zwei Szenen in denen er es nimmt um wach zu
bleiben. Auch die Sekretärin Charly Ritter ist ganz anders. Im Film zieht sie nachts um die Häuser und kämpft tagsüber gegen bittere Armut, im Roman studiert sie Jura und lebt eher kleinbürgerlich
mit einer Freundin zusammen. Sie wird im Roman auch nicht von Bruno Wolter erpresst.
Seine Tauglichkeit für eine Verfilmung erhält der Roman nicht durch den Inhalt, nicht durch die literarische Kraft des Textes, sondern durch den Verweis auf Berlin und Weimar. Und das ist eine
typische Aktualität von Literaturverfilmungen. Früher scheiterte der Film oft an der literarischen Vorlage. Die LeserInnen hatten sich schon eigene Bilder im Kopf gemacht. Gegen diese kreative
Eigenleistung der LeserInnen musste die Literaturverfilmung ankommen. Umgekehrt funktioniert das nicht. Der Film ist ein schnelles Medium. Und er prägt zunehmend auch unsere Sprache. Aber da gibt es
eine Grenze. Denn Text evoziert Bilder im Kopf. Das kann der Film nicht, denn er ist ja bereits Bild. Ein Film evoziert aber auch keinen Text. Dazu bräuchte es das ausgebildete Handwerk des
Schriftstellers.
Der Film ist ein schnelles Medium und das bedeutet im Unterschied zum Text – gerade auf historischem Gelände – dass der Film gar nicht über die Zeit verfügt, eine Kulisse aufzubauen, die für den
Rezipienten authentisch wirkt. Der Film bedient weit eher Klischees von historischen Vorstellungen. Das Medium der Serie hat es noch etwas besser. Immerhin hat Berlin Babylon zwei Staffeln
mit je acht Folgen von 45 Minuten Länge. Das sind 12 Stunden Filmvergnügen. Für den Roman mit 543 Seiten benötigen LeserInnen gute 20 Stunden. Der große Vorteil der laufenden Bilder ist ein ganz
anderer: Zum Teil scheint daran die biologische "Orientierungsreaktion" schuld zu sein, die der russische Physiologe Iwan Pawlow (1849-1936) erstmals 1927 beschrieben hat: Unsere Augen und Ohren
wenden sich instinktiv jedem plötzlichen oder unbekannten Reiz zu. Dies ist Teil unseres evolutionären Erbes – eine Art eingebauter Sensor für überraschende Bewegungen und mögliche räuberische
Gefahren. Bei einer typischen Orientierungsreaktion erweitern sich die zum Gehirn führenden Blutgefäße, das Herz schlägt langsamer, während Blutgefäße, die große Muskelgruppen versorgen, sich
zusammenziehen. Kurz, das Gehirn konzentriert sich auf die Aufnahme zusätzlicher Informationen, während der restliche Körper ruht. Wenn der Fernseher läuft, muss man einfach hinschauen. Diesen
Vorteil hat das Buch nicht. Fernsehen reduziert die Herzfrequenz und die Hautspannung. Fernsehen wirkt ähnlich wie ein Tranquilizer. Lesen dagegen verbessert den Signalaustausch in verschiedenen
Hirnregionen bis hin zu so alten Regionen wie Thalamus und Hirnstamm. Beim Lesen werden die Handlungen im Kopf simuliert. Daher kann man zwar 12 Stunden am Stück fernsehen, aber 12 Stunden am Stück
lesen ist viel anstrengender. Eine historische Kulisse wie im Roman von Volker Kutscher wird beim Lesen nicht konsumiert, sondern mit gebaut. Nun hat Tom Tykwer ja den Roman sicher auch gelesen und
so mit seinen Kollegen zusammen und vielen Schauspielern und Komparsen (immerhin 5.000) seinen Kopffilm gedreht mit den Mitteln, die der moderne Film hergibt. Dabei sind ihm zahlreiche Fehler
unterlaufen. Die im Film gezeigte Lok wurde erst 1942 gebaut, auch der gezeigte Kesselwagen wurde erst nach dem zweiten Weltkrieg gebaut, die Sowjetunion verwendet Breitspuren für die Bahn und keine
Normalspuren. Der Historiker Hanno Hochmuth (vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam) wies viele weitere Fehler nach und diagnostizierte: „Babylon Berlin' verrät mehr über die Gegenwart
als über die 20er Jahre.“
Das widerlegt jetzt nicht den Film, denn auch im Roman könnten Fehler aufgetreten sein. Da wir aber beim Fernsehen unter Drogen stehen hat es der Film leichter. Selbst eklatante Regiefehler werden eher übersehen. Die kreative Mitgestaltung des Romans beim Lesen hat zwei sich widersprechende Effekte. Fehler im Roman stören die Simulation und werden weniger verziehen. Werden die Romanfehler jedoch übersehen, ist die fehlerhaft Simulation viel nachhaltiger, als der fehlerhafte Film. Wer einem Romanschriftsteller glaubt, kann die Fehler anschließend schwerer korrigieren, da es seine eigene Konstruktion ist. Und da sind wir alle ein wenig voreingenommen.
Volker Kutscher hat einen seriösen und guten Krimi verfasst. Aber ganz sicher nicht so gut, dass man ihn nicht besser hätte verfilmen können. Spannend in der Rezeption ist vor allem der Plot. Denn die Mitwirkung von Polizisten am Waffenschmuggel für Faschisten, das ist nicht so weit weg von heute. Auch die Rolle der Presse die im Roman geschildert wird, verweist auf aktuelle Phänomene.
20. März 2019
Die einzige Geschichte
Von Julian Barnes
Übersetzt von Gertraude Krueger
Erschienen im Verlag KiWi 2018
Du kommst ans Ende des Lebens – nein, nicht des Lebens an sich, sondern von etwas anderem: das Ende jeder Wahrscheinlichkeit einer Änderung in diesem Leben. Du darfst lange innehalten, lange genug, um die Frage zu stellen: Was habe ich sonst noch falsch gemacht? ... Da ist Akkumulation. Da ist Verantwortung. Und darüber hinaus herrscht Unruhe. Es herrscht große Unruhe.
There is great unrest. Mit diesem Satz endet Barnes Roman Vom Ende einer Geschichte aus dem Jahr 2011, in der ebenfalls ein älterer Erzähler auf seine Vergangenheit zurückblickt und diese in erstaunlichen Wendungen zu einer regelrechten Kriminalgeschichte macht. In gewisser Weise knüpft der aktuelle Roman an dieses Geschichtsende an. Die Ähnlichkeit im Titel ist also nicht zufällig. Im Roman Vom Ende einer Geschichte erhält der Erzähler Tony Webster ein Testament von der Mutter einer ehemaligen Geliebten. Und ein Tagebuch seines alten Freundes Adrian, der sich mit der Mutter seiner damaligen Geliebten eingelassen hatte und Selbstmord beging. Die griechische Tragödie ist auch diesmal nicht fern. Der Kern der griechischen Tragödie ist immer das Orakel, das die Prophezeiung erfüllt, nicht obwohl, sondern weil man seinem Schicksal zu entkommen versucht. Dadurch ergeben sich peripatetische Wendungen, die nur im Rückblick so klar sind. Adrian gibt in Vom Ende einer Geschichte seinem Lehrer auf die Frage wer für den ersten Weltkrieg die Verantwortung trägt folgende Antwort: Wir wollen einem Einzelnen die Schuld geben, um damit alle anderen reinzuwaschen. Oder wir geben einer historischen Entwicklung die Schuld, um damit Einzelne freizusprechen. Mir scheint, es gibt – gab – da eine Kette individueller Verantwortlichkeiten, die samt und sonders notwendig waren, aber die Kette ist nicht so lang, dass jeder einfach die Schuld auf den anderen schieben kann. Adrian identifiziert das Kernproblem einer Geschichte in der Frage der subjektiven gegenüber der objektiven Interpretation. Wir müssen, so Adrian, die Geschichte des Geschichtsschreibers kennen, damit wir verstehen, warum uns gerade diese Version unterbreitet wird.
In der einzigen Geschichte erleben wir mit Paul einen 19jährigen der ein Verhältnis
mit einer 25 Jahre älteren, verheirateten Frau anfängt, nein, kein Verhältnis, eine Partnerschaft die über zehn Jahre dauern sollte. Die beiden Töchter von Susan McLeod sind im gleichen Alter wie
Paul. So könnte man hier spekulieren, dass dies die Geschichte von Adrian ist, nur ganz anders, einem Adrian der das alles überlebt.
Der ältere, zurückblickende Ich-Erzähler, Du-Erzähler, wechselt im letzten Teil in die personale Erzählform, weil auch das Ich des Erzählens durchgestrichen gehört und wie bei einem Palimpsest
überschrieben werden muss. Wenn wir uns die einzige Geschichte im Laufe des Lebens mehrfach selbst erzählen, wechselt jedes Mal durch unseren natürlichen Alterungs- und Erfahrungsprozess die
Perspektive. Ein und dasselbe Ereignis wird mit diesem perspektivischen Wanderungswechsel immer wieder überschrieben. Nicht die Inhalte, nicht die objektive Geschichte ändert sich. Wir sehen ja: es
bleibt weiter eine Liebesgeschichte von einem Mann mit einer deutlich älteren Frau. Es kommen Details dazu, manche Details müssen wieder durchgestrichen werden. In der Geschichtsschreibung nennt man
dies historic turns. Und das verursacht regelmäßig Legitimationskrisen. So kann die Deutung eines historischen Ereignisses nie abgeschlossen werden. Aber ein historisches Ereignis ist nie
wiederholbar. Die Einmaligkeit (die einzige Geschichte eben) eines historischen Geschehens verursacht einen Zauber, der in der Tragödie als Mythos zur Geltung kam. Mythos ist Wiederholung, wie sich
ja auch die Beziehung Susan und Gregor als Muster in der Beziehung Susan und Paul wiederholt. Bezogen auf das persönliche Leben ist das also nicht anders. Es ist nicht wiederholbar und wiederholt
sich doch in gewandelter, peripatetischer Form immer wieder. Der Romancier schneidet aus diesen Wiederholungen das Einmalige heraus. Der Geschichtsschreiber sucht im Einmaligen das Muster einer
Wiederholung. Die Tragödie der gefallenen Frau ist ein altes Klischee der französischen Unterhaltungsliteratur. Wenn eine Frau heute aus Liebe fällt, so fällt sie morgen um Geld,
schreibt der gerade 19jährige Thomas Mann in seiner ersten Novelle (Die gefallene Frau) und greift zurück auf ein Thema, das sich auf die Jungfräulichkeit einer Frau (gefallenes Mädchen) bezieht.
Barnes schildert Susan nicht als erfahrene Frau, und ironisiert mehrfach das Klischee von der älteren in Liebesdingen bewanderten Frau, die ihren jungen Geliebten in der Liebe einführt und ihn dann
in die Welt hinausschickt, damit er sich ein gleichaltriges Mädchen suche und seine Erfahrungen nun nutzbringend anwendet. Der Fall von Susan ist ein anderer. Aus der Co-Abhängigkeit zu ihrem
trinkenden Ehemann entwickelt Susan ihre eigene Abhängigkeit. Der dionysische Hintergrund ist damit augenfällig wörtlich. Und Nietzsches alter Gegensatz spielte schon im Ende einer
Geschichte seine herausragende Rolle. Nietzsche bringt in Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik das Begriffspaar apollinisch-dionysisch als ästhetische Gegensätze ins
Gespräch. Apollinisch ist demnach der Traum, der schöne Schein, das Helle, die Vision, die Erhabenheit; dionysisch ist der Rausch, die grausame Enthemmung, das Ausbrechen einer dunklen Urkraft. Susan
verfällt der Liebe. Paul muss sich plötzlich mit den rationalen Problemen von Lebenshaltungskosten, Mieteinkünften, Arbeitssuche beschäftigen. Die der Liebe verfallene Susan verliert ihr Objekt an
den Anforderungen des maßhaltenden Apollo. Das Ende einer Geschichte erzählte Apollos unglückliche Liebe zu Daphne, die nicht auf Gegenliebe stieß. Diesmal erzählt uns Barnes die Geschichte von
Dionysos. Sehr leicht daran zu erkennen, dass sich Paul am Ende mit Ziegen abbilden lässt. Die Ziege ist von jeher das Symboltier des Dionysos. Es war die Nymphe Amaltheia (was so viel wie
göttliche weiße Ziege bedeutet) die Dionysos groß zog. Der mit Wahnsinn geschlagene Dionysos reist durch die ganze Welt (im Grunde wie Paul). Es ist die große Mutter, die ihn schließlich
heilt. Magna mater (Kybele) ist ein echtes Muttertier. Ihr Mythos ist für sich schon faszinierend, da sie ein Teil ist. Ein furchterregendes dämonisches Zwitterwesen wurde von den Göttern kastriert
und der so kastrierte Dämon wurde zur großen Mutter. Ihr männlicher Teil wollte dann eine Königstochter heiraten, aber Kybele schlug eifersüchtig alle mit Wahnsinn. Kurz: Der Wahnsinn den am Ende
Susan ergreift ist wieder Mythos. Was Julian Barnes also versucht ist, aus diesem Geflecht herauszukommen. Kaum erwähnenswert, dass Barnes älterer Bruder Jonathan Barnes zu den wichtigsten Kennern
der Antike zählt. Es ist also sehr offensichtlich, den literarischen Anlass dort zu suchen, wie ja auch in dem Vorläuferbuch Vom Ende einer Geschichte sehr klar der Mythos
erzählt wird. Die einzige Geschichte verhandelt damit den Geschlechterdualismus und Barnes erzählt uns meisterhaft – wieder einmal – wie sehr wir mit unseren kleinen Erlebnissen verflochten
sind. Die einzige Geschichte des Menschen ist die Tragödie. Die Komödie ist nur ein rationaler Schlummer. Und diesen Schlaf brauchen wir dringend, um uns wieder zu erholen – bis zum nächsten
Rums.
20. Februar 2019
Zehnter Dezember
Von George Saunders
Aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert
Erschienen 2015 im Verlag btb
Über hundert Stimmen erschuf der sprachgewaltige Autor George Saunders in seinem ersten Roman
Lincoln im Bardo (von 2018), der von einer einzigen Nacht erzählt, und eine ganze Epoche einfängt. In seinem wenige Jahre zuvor erschienenen Erzählband Zehnter Dezember macht er es
ähnlich, nur verteilt auf zehn verschiedene Storys. Dabei sind es keine Storys im herkömmlichen Sinn. Die üblichen Erzählmuster löst Saunders zugunsten der Figuren auf. Die Geschichte entsteht aus
dem Kopf der Figur selbst. Sprachlich in einer Mischung aus Stream of consciousness und erlebter Rede springen wir in allen Geschichten sofort in den Kopf der Figuren.
In einem Interview zu ihrem Büchner-Preis im Jahr 2005 fragte man die Schriftstellerin Brigitte Kronauer einmal, was sie jungen Autoren rate. „Macht was ihr wollt. Aber wollt auch etwas“, lautete
ihre präzise Antwort. Lange Zeit hielt ich diese Antwort für absolut zutreffend. Inzwischen bin ich mir aber sicher, dass ‚etwas zu wollen‘ der größte Schreibblockierer aller Zeiten ist. Der Rat den
Kronauer gab könnte man als einen paradoxen Appell bezeichnen. Innerhalb des Schreibens jederzeit die Blickrichtung zu ändern und gerade etwas nicht zu wollen ist Voraussetzung für einen guten Text.
Wenn überhaupt, dann will die Figur etwas. Als Autor ist man nur ein Medium und folgt seinen Figuren. Es wäre der Tod der Geschichte, würde man seiner Figur seinen Autorenwillen aufzwingen. Der Autor
ist ein Escort der Figuren und sollte seinen Figuren jederzeit das Gefühl vermitteln können, dass er sie liebt und dass er sie begehrt. Und das spürt man in allen Figuren von Saunders Geschichten. Er
ist in ihren Köpfen und sie dürfen es ganz alleine entscheiden. Saunders überredet seine Figuren zu nichts und das unterscheidet ihn sehr von vielen anderen Autoren, die zu sehr erzählen wollen und
dabei ihren Figuren die Luft zum Atmen nehmen. Saunders Spannung entsteht, weil er ihnen ganz einfache Aufgaben gibt, ganz einfache Fragen stellt. Was würdest du tun, wenn das was du willst oder
sollst schlecht für andere ist? Das ist die Kernfrage der Erzählungen.
Kyles Rettungstat mit der er Alison Pope von ihrem Peiniger erlöst wird nicht nur zu einem Sprung zum Sieg, sondern zu einer prinzipiellen Frage in der zwei Moralen aufeinanderprallen. Da ist einmal die Moral von Kyles Vater, diese Ordnungsliebe und Zwangshaftigkeit der Kyle ausgesetzt ist und da ist die – sagen wir mal höhere Moral ein junges Mädchen zu retten. So wird die Mutprobe von Kyle verdoppelt und all das erzählt Saunders ohne auch nur annähernd über Moral zu diskutieren. Oder Callies Welt in Welpe. Auch hier wird etwas hoch Moralisches verhandelt. Callie erzieht ihre Kinder in Opposition zu ihrer eigenen kargen Kindheit. Aber sie kann den Welpen dann nicht kaufen, wegen des angeketteten Jungen. Sie muss sich entscheiden zwischen dem Bedürfnis, ihren Kindern jeden Wunsch zu erfüllen und dem abstoßenden Erlebnis des angeketteten Kindes. Auch hier entscheidet sich der Protagonist für die höhere Moral, zieht eine Bremse und findet ein inneres Prinzip. Nicht anders verhält es sich mit Jeff in der Geschichte Flucht aus dem Spinnenkopf der am Ende sich selbst opfert, um nie wieder töten zu müssen. Die vordergründige SF-Thematik erinnert ein wenig an Anthony Burgess‘ Roman Clockwork Orange. Die Experimente in dem Gefängnis in dem Jeff einsitzt dienen keinem höheren Ziel, sondern der Manipulation und chemischen Kriegsführung. Als Jeff das versteht, weiß er auch, dass er keine Ausrede mehr hat. Er wird mit seiner Teilnahme an diesen Experimenten wieder zum Täter.
Al Roosten dagegen kehrt nicht um, um Donfreys Schlüssel zu finden, den er selbst in einem
negativen, wütenden Impuls wegkickte. Er entscheidet sich gegen die höhere Moral, denn das würde ihn wohl zu sehr bloßstellen. Würde er umkehren, würde man wissen, dass er es war. Er überlegt sich
zwar eine Strategie der Verschleierung, aber es bleibt im Kopf. Er opfert die höhere Moral seinem Impuls und erweist sich als feig.
Die – neben der Titelgeschichte – stärkste aber auch längste Story Die Semplica-Girl-Tagebücher verhandeln ebenso die Widersprüche zwischen Bedürfnis und Moral. Dass gerade die kleine
achtjährige Eva die SG’s befreit und damit zugleich der Familie großen Schaden zufügt ist ja bezeichnend. Zuvor hatte der Ich-Erzähler (ihr Vater) noch eine süße Moralpredigt abgehalten. Aber das war
im Grunde keine Moral, sondern nur ein Impuls der durch das Erlebnis des Todes seines Kollegen und die Beerdigung ausgelöst wurde. Auch hier wird also im Wesentlichen wieder Ähnliches verhandelt. Das
Bedürfnis nach Anerkennung und dem Bedürfnis seiner ältesten Tochter Lilly die Zuneigung zu beweisen (eigentlich auch nur ein Vorwand, denn die Erniedrigung durch den Luxus der Torrini fühlt ja nur
er selbst) führt schließlich dazu, die SG’s zu kaufen und sich damit etwas zu leisten, was sie sich eigentlich nicht leisten können. Pams Vater, der Farmer bringt es auf den Punkt (Seite 171) Einmal
„seit wann sind ausgestellte Menschen ein wünschenswerter Anblick?“ und dann „Ihr habt Euch selbst in den Schlamassel reingeritten und müßt Euch am eigenen Schopf wieder rausziehen…“ Auch hier
ist der SF-Charakter nahe an der Realität und erinnert an Geschichten, wie sie in Black Mirror erzählt werden. Flüchtlinge werden wie menschliche Laternen benutzt mit der Rechtfertigung, sie
hätten es immer noch besser als dort wo wie ursprünglich herkommen. Die Doppelmoral daran wird von einem Kind durchschaut. Das Kind handelt inspiriert von einer Moralpredigt des Vaters – die gar
keine Moralpredigt war, sondern der gleichen Doppelmoral entspringt, wie der Kauf des SG’s. Das Kind handelt auf Grundlage einer höheren Moral. Den Preis dafür kann das Kind Eva noch gar nicht
zahlen. Es kann das noch gar nicht begreifen, also rein rational. Aber das hat schon Immanuel Kant festgestellt, dass Kinder von Natur aus nach einer höheren Moral handeln können.
In der Titelgeschichte Zehnter Dezember ist es ein alter, kranker Mann der trotz seiner offensichtlichen Verwirrtheit und dem drängenden Bedürfnis dem Verfall vorzeitig ein Ende zu setzen, umschaltet und instinktiv das dicke Kind vor dem Ertrinken rettet. Das Kind im Teich ist dabei eine Variante eines Fallbeispiels von Peter Singer, der uns fragt, was wir opfern würden, um ein ertrinkendes Kind zu retten. Singer überträgt dies dann auf die verhungernden Kinder in der ganzen Welt und diskutiert dadurch unsere Spendenbereitschaft. In Saunders Story entscheidet sich der alte Mann Don Eber dafür, seinem Todeswunsch zu widerstehen und wird am Ende belohnt und transzendiert. Denn nachdem ihn Mrs Kendall, die Mutter des Jungen gerettet hat, weiß er auch, dass er seiner Frau Molly das nicht antun kann und dass er auch seine Würde nicht verliert, wenn er gepflegt werden muss.
12. Februar 19
Frost
Von Thomas Bernhard
Erstmals erschienen im Verlag Insel 1963
Nichts ist mehr geeignet uns in die Kenntniß des menschlichen Elends zu leiten, als die
Betrachtung der wahren Ursache von der beständigen Unruhe, in welcher die Menschen ihr Leben hinbringen, schreibt Blaise Pascal im siebten Abschnitt seiner Pensees. Thomas Bernhard war gerade mal Anfang 30, als sein erster Roman erschien. Der Erfolg des Romans wurde nicht zuletzt
durch einen alten Freund seines Großvaters befeuert. Carl Zuckmayer (Henndorfer Kreis) schrieb im Juni 1963 eine begeisterte Rezension für DIE ZEIT. Von einem „Sinnbild der Kälte“ ist darin die Rede.
Carl Zuckmayer gehörte gemeinsam mit Bernhards Großvater Freumbichler dem Henndorfer Kreis an, einer Literatenclique aus dem Salzburger Land.
Geschrieben hat Thomas Bernhard diesen Roman nahezu durchgehend in der Badehose, ein Jahr zuvor – 1962 - in einem der heißesten Sommer, während der Hundstage. Motivisch ist der Roman auch nicht
originell, denn zwei Jahre davor erschien der Roman Die Wolfshaut im deutschen Claassen Verlag. Eine Parabel des österreichischen Opernsängers und Schriftstellers Hans Lebert. Sie
erzählt von dem Dorf Schweigen, in welchem sich einige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges außergewöhnliche Todesfälle zu häufen beginnen, welche Anschuldigungen und Diffamierungen in der
Ortschaft zur Folge haben und ein lange verschwiegenes, kollektives Verbrechen zu Tage bringen. Sprachlich ist Leberts Roman allerdings nicht mit Frost zu vergleichen. Lebert schrieb einen
expressionistischen, im ländlichen spielenden Kriminalroman der 99 Tage schildert und an allen 99 Tagen regnet es. Aber die Motive des Antiheimatromans, die Perspektive der Nachkriegszeit, der
Zusammenbruch der ländlichen Idylle eines Ganghofer, sind auch in Bernhards Roman deutlich sichtbar. Nur hat Bernhard wesentlich karger und reduzierter geschrieben und deutet hier schon seinen
aggressiven Redefluss der Philippika entlehnt an. In seinem Blut seien so viele Giftstoffe, daß man „ganze Stadtbezirke damit ausrotten könnte“, lässt Thomas Bernhard den Maler Strauch
sagen. Der Erzähler bleibt namenlos, er ist einfach der Famulant, der vom Assistenzarzt für den er arbeitet den Auftrag bekam, nach Weng zu reisen und dort dessen Bruder den Maler Strauch zu
beobachten. In siebenundzwanzig Tagen entwickelt sich so ein desaströses Landschaftsbild. Da, wo blühende Wiesen waren und herrliche Ackerkulturen und die besten Wälder, da sind jetzt nur noch
Betonkötze zu sehen. Das ganze Land ist bald von Kraftwerkbauten zugedeckt, und es wird sich in absehbarer Zeit kaum mehr ein Platz finden lassen, wo man nicht von Kraftwerkanlagen oder wenigstens
von riesigen Telegraphenmasten irritiert wird beschwert sich der Maler Strauch beim Ingenieur. Doch dieser kontert, wie sie auch heute noch kontern: Die Elektrizität ist das Kostbarste…,
Häßliche Dörfer verschwinden über Nacht unter dem Wasser, Sumpfgegenden und braches, nutzloses Land… Wenn unser Land die Kraftwerke nicht gebaut hätte, die es gebaut hat, unter welchen Umständen
immer, wäre es ein armes Land. So aber könne es, trotz aller Mißstände, doch immerhin von sich behaupten, wohlhabend zu sein. Je mehr Kraftwerke noch entstehen, desto glücklicher wird unser Land
sein.- Darüber waren sich alle einig. Nur der Maler schwieg…
Der Maler Strauch leidet unter einer unheilbaren und nicht benennbaren Krankheit. Sein Kopf bläht sich auf, aber seine Füße werden immer kleiner und müssen diesen gewaltigen Kopf dennoch tragen. Es
ist offensichtlich unter einer heutigen Lesart, dass Frost nicht nur ein Antiheimatroman ist, sondern ein Roman von einem Umweltaktivisten, als es noch gar keine Umweltaktivisten gab. Die
Bauern werden zurück gedrängt und die Proletarier kommen. Die Zellulosefabrik, das Kraftwerk, die Eisenbahn. Die moderne Welt ist es, die den Kopf des Malers aufbläht und während er mit seinen
kleinen Füßen dennoch schnell und beständig durch den Schnee stapft, verschwindet die Natur unter seinen Füßen, löst sich auf und zeigt sich in der Niedertracht der Landbevölkerung, ihrem Stumpfsinn,
ihrer sinnlosen Gewohnheiten. Sie fressen und saufen vor sich hin. Sie sind völlig machtlose Teilnehmer ihres eigenen Verschwindens. Es ist dabei nicht so, dass man ihnen besonders nachtrauern würde.
Die Tragödie des Menschen war es von jeher, dass er mit der Natur gar nicht zurechtkommt. Die Natur ist wie die Klamm gnadenlos. Und die Natur interessiert sich nicht für die Menschen. Vermutlich
wird sie sich wieder erholen, sobald die Menschheit verschwunden ist.
Die Welt die Thomas Bernhard beschreibt gibt es so heute nicht mehr. Der Krieg war da noch keine zwanzig Jahre her. Die Leute in Weng erzählten sich immer noch am liebsten Kriegsgeschichten. Sie
waren traumatisiert. Die Symptome hat auch der Maler Strauch: Seit Jahrzehnten leide ich unter der intensivsten Aufmerksamkeit, wissen Sie, was das heißt? Hypervigilanz gehört zu den
herausragenden Symptomen des PTBS, des posttraumatischen Belastungssyndroms. Und so ist auch die unheilbare Krankheit des Malers und seine verschobene Weltperspektive zu betrachten. Auch die
Philosophie hilft ihm nicht weiter dabei. Das Wort Schmerz lenkt die Aufmerksamkeit eines Gefühls auf ein Gefühl. Schmerz ist ein Überfluß. Aber die Einbildung ist die Wirklichkeit.
Die Philosophen nennen das Qualia und meinen ein phänomenales Bewusstsein, worunter man den subjektiven Erlebnisgehalt eines mentalen Zustandes versteht. Wie ist der
Schmerz beschaffen? Wie ist der Geschmack beschaffen? Wie ist Farbe?
Der Maler Strauch wurde mit dem Landschaftsmaler Rudolf Holz in Verbindung gebracht, den
Thomas Bernhard im St. Veiter Armenhaus kennenlernte. Im Schwarzacher Krankenhaus hat der Halbbruder von Thomas Bernhard Peter Fabjan seine Famulatur verbracht (1960). Und den Bau des Kraftwerks
Wagrain hat Thomas Bernhard selbst verfolgen können.
Doch all das ist mehr die Kulisse, als wirklich bedeutsam für den Roman. So sagte Thomas Bernhard: „Ich bin doch nicht ein Autor für Österreich oder für drei Gemeinden. Interessiert mich doch gar
nicht.“ Tatsächlich schrieb ein spanischer Kritiker bei Bernhards Tod, dass der wichtigste Schriftsteller des spanischen Realismus gestorben sei.
Für den Bürgermeister von Weng war Bernhards Roman natürlich ein fremdenverkehrsschädigendes Werk.
Doch so wenig der Maler Rudolf Holz wirklich gemeint ist, so wenig ist Pongau gemeint. Im Maler Strauch steckt viel zu viel Thomas Bernhard, viel zu viel von seiner komödiantischen Weltsicht, die
mehr Karikatur darstellt und aus der Postkartenidylle eine stinkende Jauchegrube macht, mit feisten Wirtinnen und brutalen Verbrechern. Bernhards Übertreibungskunst hat auch mich getäuscht, als ich
den Roman zum ersten Mal las. Ich war damals nur unwesentlich jünger, als der Famulant in dem Roman (der 23 Jahre alt ist). Ich steckte mitten in meinem Zivildienst und sah zum ersten Mal
eine ungeschönte Wirklichkeit, die ja auch im Roman geschildert wird. Dementsprechend war ich geschockt, verstört. Hier hatte jemand für mich einen Roman geschrieben und für mich verschriftlicht, was
ich mit eigenen Augen sah. Die Täuschung war insofern perfekt und ich sah mit den Augen des Malers eine widerliche und abstoßende Welt um mich herum. Ich saß im Biergarten und sah diese abstoßenden
Karikaturen, die sich für Menschen hielten. Ich brauchte viel Geduld mit mir, um meine Kompassnadel wieder so auszurichten, dass mein Kopf sich nicht auch aufblähte und mein Körper ihn kaum
noch tragen könnte. Denn ich machte den gravierenden Fehler, gleich nach Frost die anderen Romane von Thomas Bernhard zu lesen. Gemeinsam mit Beckett, Camus und Sartre und selbstverständlich
auch einer Ausgabe von Blaise Pascals Gedanken ruinierte ich meinen Verstand auf Jahre hinaus.
23. Januar 2019
Schattenspiel
Von Viivi Luik
Aus dem Estnischen von Cornelius Hasselblatt
Erschienen im Wallstein Verlag 2018
Auf einen Quadratkilometer Fläche leben in Estland 29 Menschen. Zum Vergleich: In Rom müssen
sich über 2000 Menschen einen Quadratkilometer Erde teilen. Genau so viele Menschen (2000) teilen sich in Estland je einen Braunbären (Bestand: 600). Estland hat nur halb so viele Einwohner wie Rom,
ist aber 45-mal so groß. Dennoch kommt der estländische Diplomat JJ als Vertreter eines sehr kleinen und unbedeutenden Landes in die ewige Stadt. Größe verhält sich immer relativ zur statistischen
Erhebung. Viivi Luiks Odyssee durch Rom führt sie zu Zahnärzten, Wohnungsmaklern, Schuster, Diebe in allerlei Straßenwinkel, sie kauft Fahrkarten, trinkt Cafe, unterhält sich zwischendrin mit einem
estnischen Geistlichen (Atspol), sie erzählt von ihrer Zeit in Berlin, und so geht es assoziativ hin und her. Dabei gelingen ihr immer wieder schöne Sätze, wie zum Beispiel auf Seite 27 Jeder
denkt, dass er der Einzige ist, der lebt, und dass die anderen nichts davon wissen. Aber dann haut sie daneben wie zum Beispiel auf der Seite 142 Das Hemd bewegte sich leicht auf seiner
Brust. Sein Herz schlug. Die Ich-Erzählerin entwirft einen subjektiven, im Stil eines Tagebuchs gehaltenen Blick auf Rom und die italienische Lebensart. Sie scheut auch keine Klischees:
Denn in Italien ist nichts anstößiger, als seine Alltagssorgen zur Schau zu stellen - Seite 27. Oder noch schlimmer: Manche empfanden nichts. Sie waren nicht erregt. Sie
zogen sich eine Linie rein und ritzten sich oder anderen unter Begleitung des Grölens von Rammstein mit einer Rasierklinge in die weiße Haut. Das Blut spross auf wie eine Rosenblüte. – Seite
104.
In Estland oder Lettland, fabuliert die Autorin, sind die Blätter an den Bäumen dünner als in Italien und rascheln aufgeregter (Seite 105). Wie sie von dem um Gefallsucht und Sachlichkeit
bemühten Signor Necci auf Seite 104 zu Polen und den aufgeregten Blättern auf Seite 105 kommt, geht über Schweiz, Österreich, Deutschland, über Äcker, Friedhöfe und Schlachtfelder bis zum Sand
der Sahara. Und dann verlieren sich leider die scharfen Beobachtungen der Autorin und der Satz: In Rom gingen nur die Katzen und die Obdachlosen nahe am Wasser entlang, (Seite 106) wird fast
überlesen. Die üppige Erzählweise schwankt stilistisch schon sehr. So nimmt der Engel der Diebe auf Seite 161 wie ein Spatz alles aufs Korn, was auf dem Tisch ist. Über diesen
Engel, den ihr JJ aus Neapel mitbrachte, kommt die Autorin auf einen Geldbörsendiebstahl. Das Wetter wird dann auffallend grau und finster und Luik erzählt uns dann gleich zwei Diebstähle und aus
Sicht der Erzählökonomie gerät das im Kopf des Lesers so durcheinander, dass man Mühe hat, sich zu erinnern. Die Dreieinigkeit des Erzählens wurde einmal von Joseph Pulitzer auf den Punkt gebracht:
Schreibe kurz und sie werden es lesen. Schreibe klar und sie werden es verstehen. Schreibe bildhaft und sie werden es im Gedächtnis behalten. Wobei das nur im Paket geht. Und es stimmt
übrigens auch nicht. Es gibt drei goldene Regeln, um eine Novelle zu schreiben, - leider sind sie unbekannt, scherzte der englische Schriftsteller Somerset Maugham. Warum tat ich mich dann
so schwer mit dem Text von Viivi Luik? Mir fehlte einiges. Aber vor allem fehlten mir die nötige Kohärenz, und auch die sprachliche Kongruenz. Beim Lesen verlor ich den Überblick, den erzählerischen
Leitfaden. Rom allein reichte nicht, zumal der subjektive Blick der Erzählerin auch immer wieder abschweifte und am Ende bildete Rom mehr den Rahmen und nicht den Faden. Rom wurde zur bloßen Kulisse
für die Befindlichkeitsprosa der Autorin. Die sprachliche Kongruenz fehlte mir, weil der Text in seinem sprachlichen Niveau schwankte. Die Brackets der Mädchen blitzten, sie amüsierten sich wie
immer über alles, sie lachten und machten sich dabei beinahe in die Hose. In diesem Satz stimmt einiges nicht. Zum Beispiel die Floskel „wie immer“. Das suggeriert, dass die Erzählerin sie schon
lange kennt. Das tut sie aber nicht. Diese Mädchen kommen ausschließlich an dieser Stelle vor. Die ganze Folgeszene auf Seite 167 ist so inkongruent aufgebaut. Sätze wie Die Menschen wurden
lebhaft folgen der Schilderung von lebhaften Menschen. Schon vorher sah man Menschen die Haltet den Dieb riefen, die aufkreischten und man sah alle alten Leute aufspringen und
wachsam um sich blicken. Die ganze Seite 167 ist einerseits gut erzählt und andererseits mit zu vielen Bildern belegt. Die Menschen waren nicht nur lebhaft, als die Polizei kommt ist die
Menschenmenge sogar eine wildgewordene Menschenmenge, es kommt vorher schon zu einem Handgemenge. Wie gesagt, einerseits gut erzählt und amüsant, andererseits wieder nicht. Die
Szene wäre mit einer einzigen kleinen Überarbeitung viel besser geworden und man hätte sie sich in der Tat im Gedächtnis behalten. So aber ist zu viel springen, Verwirrung, Lebhaftigkeit, vorhanden.
Und andererseits macht es sich die Autorin dann doch zu einfach. Der Grund dafür ist, dass in dem gesamten Text auf 270 Seiten einfach zu viel erzählt wird. Das ist Stoff für mehrere Romane. Nur
wenige Figuren begleiten uns durch den ganzen Text. Gelungen ist die Figur von Atspol, aber über JJ erfährt man nichts. Er ist so blass wie seine Namensabkürzung. Dafür erfährt man viel von Kristiina
und ihren Zahnarzt. Aber dann hört man nie mehr wieder etwas von ihr. So geht es die ganze Zeit. Das meine ich mit der Inkongruenz des Textes. Figuren die nur als Nebenfiguren, ja als Statisten
auftauchen wird viel Platz eingeräumt, aber den wichtigeren Figuren zu wenig.
Wie es im Klappentext zu der Äußerung kommen kann, dies sei ein europäischer Roman, ist mir dann doch schleierhaft. In der Netflix-Serie Berlin-Station wird in der dritten Staffel ein Konflikt zwischen den russischen Esten und den estnischen Esten geschildert. Eine estnische Politikerin versucht, den Konflikt beizulegen aber sie scheitert zunächst. Paramilitärische Gruppen aus Russland marschieren heimlich – finanziert von einem russischen Oligarchen – in Estland ein und eskalieren den ethnischen Konflikt. Natürlich handelt es sich nicht um einen Spionage-Roman bei Schattenspiel. Aber so wie das Bild der Römer im Klischee hängen bleibt, bleibt auch das Bild von Estland im Klischee hängen. In der Netflix-Serie habe ich mehr über Estland und die schwierige Lage Estlands erfahren, und mehr über Europas Konfliktscheu und damit von Europas Seele, als über Rom in diesem Buch. Was bleibt mir im Kopf? Die Römer sind irgendwie antiquiert, die Erzählerin erscheint als eine Art Fremdkörper in dieser Stadt und hat in einer Art Befindlichkeitstagebuch typische Touristen-Erfahrungen eingestreut. Für mich war dies leider eines der schlechtesten Bücher, die ich seit langem gelesen habe. Und ich bin schon ein gnädiger Kritiker. Denn ich fand auch in diesem Buch einige Perlen. Allerdings losgelöst von ihrem Gehäuse weit verstreut und so zerstreut, wie die Erzählerin selbst.
18. Januar 2019
Die Stadt ohne Juden
Von Hugo Bettauer
Erschienen erstmals im Jahr 1922
erster Nachdruck 1988
Der Schriftsteller und Drehbuchautor Hugo Bettauer kam 1872 in der alten Doppelmonarchie in
Niederösterreich (Baden bei Wien) zur Welt und emigrierte 1899 in die USA. Da er aber in den USA keine Arbeit fand, kehrte Bettauer zurück und kam über die Umwege Berlin und München wieder nach Wien.
Der Mitschüler von Karl Kraus, Hugo Bettauer (ehemals Betthauer), konvertierte als 18jähriger vom Judentum zum Protestantismus und galt als assimilierter Jude. Der vorliegende Roman wurde verfilmt
und 1924 in Österreich uraufgeführt. In dem Film spielte Hans Moser einen antisemitischen Parlamentarier. Es war erst seine vierte Filmrolle überhaupt. Kurz nach der Aufführung kam es zu Tumulten und
Hugo Bettauer wurde nach einer wochenlangen Medienkampagne gegen ihn von dem Zahntechniker Otto Rothstock im März 1925 erschossen. Buch und Film gelten seither als geradezu prophetisch. In dem
Film werden die Vertreibungsszenen entsprechend der Stummfilmdramaturgie emotional dargestellt und es verwundert nicht, dass Bettauers Mörder ein eingetragenes Mitglied der NSDAP war und vom
Geschworenengericht frei gesprochen wurde. Es gibt zahlreiche Unterschiede zwischen dem Film (auf youtube vom Filmarchiv Austria frei zugänglich zu sehen) und dem Roman. Daher distanzierte
sich Bettauer von dem Film selbst. So zeigt der Film sehr eindrücklich die Gespaltenheit der jüdischen Gemeinde in Wien. Auf der einen Seite die reichen Westjuden, assimiliert und in vielen liberalen
Berufen vertreten (so wie im Roman), andererseits die Ostjuden, verarmt zerlumpt. Die reichen Juden standen in keiner Verbindung mit den armen Ostjuden und schämten sich eher für die Existenz dieser
Armut. Dieser Fakt wird im Roman nicht erwähnt. Dafür erspart sich der Film politische Anspielungen und erzählt die Geschichte durch einen Geheimbund, dem Dr. Schwertfeger angehört. Im Roman sind die
Anspielungen auf reale Politiker allzu deutlich. So ist die Figur des Dr. Schwertfeger eine Mischung aus dem 1922 bis 1924 amtierenden österreichischen Bundeskanzler Ignaz Seipel und dem
christsozialen Wiener Bürgermeister Karl Lueger (von 1897 bis 1910). Gerade Karl Lueger war ja ein Vorbild für Adolf Hitler (Heute sehe ich in dem Manne mehr noch als früher den gewaltigsten
deutschen Bürgermeister aller Zeiten, Hitler in „Mein Kampf“). Von Karl Lueger stammt der berühmte Satz: „Wer a‘ Jud‘ is‘ bestimm‘ I‘.“
Und Ignaz Seipel verdrängte die Sozialdemokraten, indem er für eine Koalition der CS mit den Deutschnationalen einging. Ebenso unterstützte er den Aufbau militanter rechtsradikaler Gruppierungen in
Wien.
In der charismatischen Figur des Radierers Leo Strakosch steckt viel Autobiografisches drin. Hugo Bettauer brannte mit der damals erst 16jährigen Helene Müller durch, emigrierte zum zweiten Mal in
die USA. Helene Müller war seine zweite Ehefrau. Auch der Bezug zum Krieg (in den Armen von Leo Strakosch starb der Bruder von Lotte) erinnert an Hugo Bettauer, der sich selbst freiwillig bei den
Kaiser-Jägern als Einjähriger meldete, dann aber desertierte und in die Schweiz flüchtete.
Die hochgradig beißend-satirische Geschichte zeigt einerseits die kulturelle Abhängigkeit Wiens vom jüdischen Input, aber auch die Manipulierbarkeit der Massen. Der Einschnitt durch die Ausweisung
der Juden und auch der jüdisch stämmigen Mitbürger zieht sich mitten durch alle Familien. Sogar der österreichische Erzbischof steht plötzlich ohne Familie da, weil sowohl sein Bruder als auch
seine Schwester mit assimilierten Juden zusammen sind. Selbst der Schwiegersohn von Nationalrat Schneuzel ist ein Jude (Alois Corroni). All das führt den Rassismus ad absurdum. Viele Juden
werden im Ausland begrüßt und die österreichische Krone verfällt. Der Niedergang der Stadt Wiens wird von dem Rechtsanwalt Haberfeld so dargestellt: „Wien versumpert ohne Juden.“ Und dann vergleicht
er die Juden mit seinem Sodbrennen. Dagegen nimmt ein Soda-Bikarbonat ein. Aber ohne Juden hat er gar keine Magensäure mehr und so „wer’n wir noch zugrund‘ geh’n“.
Mit viel Witz und Charme wendet der heimlich zurück gekehrte Leo die Geschichte. Wir wissen, dass es etwas anders ausgegangen ist. Aber auch in der Realität kehren nach dem zweiten Weltkrieg die
Juden wieder zurück. Nicht alle. Zu viele wurden ermordet. Insofern ist es schon erschreckend, dass in letzter Zeit wieder der Antisemitismus zurück kehrt. Die Figur des Dr. Schwertfeger bringt es
gleich zu Anfang des Romans auf den Punkt, als er die Überlegenheit der Juden darstellt. Hugo Bettauer zementiert in seinem Roman dieses Klischee. Insofern speist sich der Antisemitismus auch aus der
Selbstdarstellung mancher Juden. Es ist aus psychologischer Sicht aber auch nicht ungewöhnlich, dass das Selbstwertgefühl von Menschen stark fremdbestimmt ist. Wir übernehmen oft das Bild, das andere
von uns haben und nehmen es in unser Selbstbild auf. Bettauers Roman macht da wohl keine Ausnahme. So wird Wien ohne Juden der Lächerlichkeit preisgegeben und das kulturelle Leben bricht zusammen.
Die ausgewiesenen Juden dagegen kommen überall klar und machen Karriere. Die Realität in Wien um 1900 sah anders aus. Von 1880 bis 1900 verdoppelte sich die jüdische Bevölkerung in Wien (von
72000 auf 147000). Aber darunter waren sehr viele, sehr arme Juden aus dem Osten Europas. Sehr viele Juden lebten im Elend von der Hand in den Mund. Der Anblick bettelnder und zerlumpter Juden auf
der einen Seite und der Hass auf die reichen und erfolgreichen gebildeten Juden auf der anderen Seite lieferten ein stark inkohärentes Bild. Menschen halten Ambiguität (Mehrdeutigkeit) schlecht aus.
Für das Selbstverständnis der assimilierten, liberalen und intellektuellen Juden war der Anblick bettelnder, fremdartig wirkender Juden schwer zu ertragen. Für die übrige Bevölkerung wirkten beide
Bilder verstörend. Was Menschen brauchten, war eine stimmige Erzählung die eindeutig ist. So wurde aus den Juden „der Jude an sich“. Und dieser ist einerseits überlegen, aber hinterlistig. Ähnliches
geschieht ja heute auch mit den so genannten Asylanten. So schreibt Ludwig Hartmann (Spitzenkandidat der Grünen bei der Wahl in Bayern) auf seiner Internetseite: „Was fehlt ist eine Schule, in der
alle Kinder gleiche Chancen haben, ihre Träume und Wünsche zu leben. Egal, ob die Mama Flüchtling oder Zahnärztin ist.“ In Hartmanns Vorstellung kommt ein flüchtender Zahnarzt nicht vor. Die
Unterscheidung zwischen Volk und Flüchtling ist längst gesellschaftlicher Konsens. Gestritten wird über die soziale Teilhabeberechtigung unterschiedlicher Gruppen. Der erfolgreiche Asylant versus der
„kriminelle Asylant“. Auf der einen Seite schwer integrierbare, fremd wirkende und in Armut lebende Zuwanderer und auf der anderen Seite die erfolgreichen Zuwanderer, die uns Wohnung und
Arbeitsplätze weg nehmen. Auch hier halten manche Menschen die Mehrdeutigkeit nicht aus. Sie brauchen ein eindeutiges Bild vom Zuwanderer. Entweder sind sie alle super. Oder sie sind alle
schrecklich. Aber jeder Zuwanderer ist ein Individuum. Manche sind nett und passen sich gut an. Andere sind gefährlich. Wieder andere sind einfach dumm. Und manche Zuwanderer sind sehr klug. So wie
die Menschen, die hier leben und sich als Einheimische fühlen. Auch unter so genannten Deutschen gibt es böse, gute, kluge oder Dumme. Das ist jetzt eine Binsenwahrheit. Aber Rassismus entsteht, wenn
man sich einseitig einer Gruppe zuordnet und die andere verteufelt. Es ist auch eine Form von Fremdenfeindlichkeit, wenn linke Spinner jeden Bankmanager zum Volksfeind erklären. Der Schritt zur
rassistischen Verschwörungstheorie (die auch bei Linken verbreitet ist) ist da nicht weit. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sucht nach Eindeutigkeit und hält es nicht aus, wenn ihr banales
Menschenbild Löcher aufweist.
06. Januar 2019
Die Ringe des Saturn
Von W. G. Sebald
Erschienen 1995 im Verlag Fischer
Ich verdanke der Konjunktion eines Spiegels und einer Enzyklopädie die Entdeckung
Uqbars, beginnt die Erzählung Tlön, Uqbar, Orbis Tertius von Jorge Luis Borges, der W.G. Sebald
einen längeren Abschnitt in seinem Reiseroman widmet. Sebald zitiert: das Grauenerregende an den Spiegeln , und im übrigen auch an dem Akt der Paarung, bestünde darin, dass sie die Zahl der Menschen
vervielfachen. Dieses Uqbar entdeckte Borges Freund Adolfo Bioy Casares im 26. Band the Anglo-American Cyclopaedia einem gefälschten Nachdruck des berühmten englischen Originals
(Enzyklopaedia Britannica), und er fand es auch nur in einem einzigen Exemplar. Bei Borges handelt es sich um etwas Verschollenes. Ein anderer Planet auf dem das Räumliche nicht als in der Zeit
fortdauernd erfasst wird. Auf Ucqar gibt es viele Schulen, manche glauben, dass die Gegenwart undefiniert sei, dass die Zukunft nur als gegenwärtige Hoffnung Wirklichkeit habe, dass die Vergangenheit
nur als gegenwärtige Erinnerung Wirklichkeit habe. Eine andere Schule behauptet, dass bereits alle Zeit abgelaufen und dass unser Leben nur die Erinnerung oder der nachdämmernde und unzweifelhaft
verfälschte und verstümmelte Widerschein eines unwiederbringlichen Vorgangs sei. Eine andere Schule glaubt, dass die Geschichte der Welt – und darin unser Leben und die geringfügigste Einzelheit
unseres Lebens – die Schrift sei, die eine untergeordnete Gottheit verfertigt, um sich mit einem Dämon zu verständigen. In den Nachtrag zu dieser Erzählung klärt uns Borges auf, dass dieses Ucqar die
Erfindung einer Geheimgesellschaft ist, und dass die wirkliche Welt im Unterschied zur künstlich geschaffenen Welt in Übereinstimmung mit göttlichen Gesetzen – ich übersetze: mit
unmenschlichen Gesetzen -, die wir niemals begreifen werden ausgestattet ist.
Und die vielen Geschichten von Sebald beinhaltet viele Uqbars, wenn man so will. Die Klammer dieses durchaus barock anmutenden Spazierganges von W.G. Sebald durch Suffolk in Ostanglien, bildet der
englischen Gelehrte und Sohn eines Seidenhändlers Thomas Browne, der im 17. Jahrhundert lebte. In den zehn Teilen reisen wir aber nicht nur durch das karge und von der Wirtschaftskrise
gezeichnete östliche England, sondern auch nach Holland, China, Polen. Ein langes Kapitel bildet im fünften Teil des Buches die Geschichte von Joseph Conrad und seiner Anfänge als Kapitän. Er war
befreundet mit dem irischen Freiheitskämpfer Roger Casement, der die schaurigen Kongo-Gräuel aufdeckte. Dies ist ein großer Schatten, den die belgischen Kolonien werfen unter der Führung des
belgischen Königs Leopold II. Sogar ein längerer Kommentar zur Naturgeschichte des Herings kommt in Sebalds Suffolk-Wanderung vor.
Besonders wirkmächtig fand ich das fünfte Kapitel, das sich mit dem jungen Joseph Korzeniowski (bekannt als Joseph Conrad) beschäftigt und seiner Verbindung zu Roger Casement, einem irischen Diplomaten und irischen Freiheitskämpfer, der maßgeblich an der Aufdeckung des Kongogräuels beteiligt war, über das ja Conrad in seinem Herz der Finsternis berichtet. Joseph Conrads Vater Tadeusz übersetzte Die Arbeiter der Meere von Victor Hugo und da erwähnt Sebald die Worte: Ein Buch über Schicksale einzelner Personen, vertrieben, verloren, die ausgestorben sind und gemieden werden. Ganz wie das Schicksal von Roger Casement, der wegen Homosexualität hingerichtet wurde.
Wunderbar ist auch die Geschichte von Alec Gerard, der den Tempel von Jerusalem nachbaut und
dafür seine Landwirtschaft zunehmend vernachlässigt, und dessen Hartnäckigkeit ihm langsam sogar eine gewisse Anerkennung einbringt. Die Grenze zwischen Anerkennung einer kulturellen Leistung und
Verspottung als spleenige Exotik ist wohl fließend.
Auch die Geschichte des Vicomte de Chateaubriand ist wieder eine Geschichte in der Geschichte. So verschachtelt und schillernd ist im Grunde das ganze Buch. Es liest sich wunderbar leicht wie eine
Sammlung feinster Feuilleton- Artikel. Eine Entdeckungsreise, die viel typische englische Geisteshaltung widerspiegelt, wie den viktorianischen Schriftsteller Edward FitzGerald aus Suffolk, oder den
sadomasochistischen, Skandal umwitterten Algernon Charles Swinburne. Die Geschichte einer Freundschaft, wie Walter Watts seinen Freund Algernon Swinburne vom Alkoholismus rettete und in ein streng
häusliches Leben einbettet, die ist schon auch herzergreifend einerseits, andererseits typisch für die viktorianische Lebensart.
Bedenkt man, dass sich auf Tlön (Borges) die Dinge verdoppeln und dazu neigen undeutlich zu werden und die Einzelheiten einzubüßen, wenn Leute sie vergessen, dann wird Sebalds Luginsland noch einmal interessant. Ein schönes Beispiel nennt Borges: Jene Türschwelle, die andauerte, solange ein Bettler sie aufsuchte; nach seinem Tod wurde sie nicht mehr gesehen. Zuweilen haben ein paar Vögel oder ein Pferd die Ruinen eines Amphitheaters gerettet.
Das ist der eigentliche Hintergrund von Sebalds Wanderung. Und vielleicht erscheint uns daher
manches in dem Buch ein wenig fremd und sonderbar. Nicht umsonst ist das erste Foto ein schmales Fenster und ein Blick in Wolken. Danach kommt schon der Totenschädel von Thomas Browne. Dieser barocke
Philosoph aus dem 17. Jahrhundert setzte sich einst zwischen alle Stühle der zu seiner Zeit herrschenden naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Sein virtuelles Museum ist eine dieser besonderen
Leistungen der Neuzeit, in der wir an der Schwelle standen (Der BR hat 2010 dazu eine Sendung gemacht, die man noch nachhören kann auf https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/hoerspiel-und-medienkunst/hoerspiel-bassenge-musaeum-clausum100.html)
. Und dass dieser Browne auch noch als Sohn eines Seidenhändlers zur Welt kam, verweist auf das feine Gespinst der Vergangenheit. Wenn Descartes uns auf die Maschine hinweist, die in uns tickt (Seite
26 Sebald), muss man wissen, dass unser aller Herz ab der sechsten Schwangerschaftswoche anfängt zu schlagen, wie ein Uhrwerk, pünktlich, als hätte irgendwer die Uhr eingeschaltet. Und das Herz
schlägt dann gute zwei bis drei Milliarden Mal. Aber dabei singt, lacht, jubelt, weint, klagt, bebt, zerspringt, schmachtet, bricht das Herz, trotzig, falsch, abgründig, zitternd oder hüpfend.
Was ich meine ist, dass Sebalds Geschichtsbetrachtungen, Geschichtserhebungen im Rahmen seiner Wanderung eine Form der poetischen Geschichtsschreibung ist. Wir halten uns nicht unnötig an den Fakten,
chronologischen Verläufen und rationalen Zusammenhängen auf. Und so ist es möglich, dass die Kulturgeschichte des Herings wie selbstverständlich nach Bergen Belsen verläuft. Diese „unaufhaltsame
Verdrängung der Finsternis“ (Seite 77 Sebald) wirft einen großen Schatten auf diese Welt. Das spürte man beim Lesen oft. Diese Melancholie ist nur an sehr wenigen Stellen ein wenig heiter.
Für den im Alter von 57 Jahren 2001 in Norfolk in Folge eines Herzanfalls und darauf folgenden Autounfall verstorbenen Schriftsteller wurde auf dem Gelände der University of East Anglia in Norwich
2003 eine Blutbuche gepflanzt von der Familie W. G. Sebalds, zur Erinnerung an den Schriftsteller. Zusammen mit weiteren Bäumen, gespendet von früheren Studenten des Schriftstellers, wird der Platz ,
Sebald Copse‘ („Sebald-Wäldchen“) genannt. Die Bank, deren Form an die Ringe des Saturn erinnert, trägt ein Zitat aus Unerzählt (auf Deutsch): „Unerzählt bleibt die Geschichte der
abgewandten Gesichter“.
Rufen Sie einfach an unter
Arwed Vogel
++49 ( )8762 726121
oder
Bernhard Horwatitsch
017646130019
horwatitsch[at]gmx.at
...
oder
nutzen Sie unser