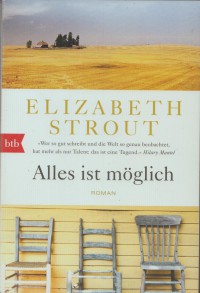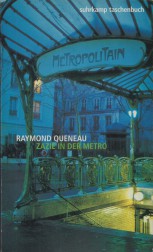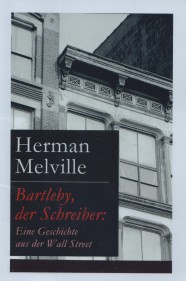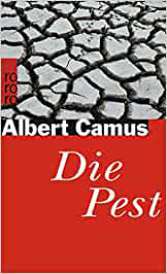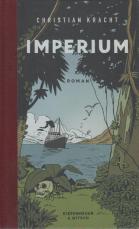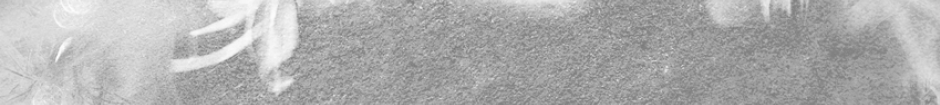
15. Dezember 2020
Von Hand zu Hand
Von Helen Weinzweig
Mit einem Nachwort von James Polk
Aus dem Kanadischen Englisch von Hans-Christian Oeser
erschienen 2020 im Verlag Wagenbach
erstmals 1973 unter dem Titel Passing Ceremony bei House of Anansi Press in Toronto
Gleich vorneweg zitiert Helen Weinzweig eine Autorin von 18 Romanen, die alle mehr oder weniger von einer Familie und ihrer Erbschaft handeln und davon, wie das Geld von Erbschaft zu Erbschaft weiter geht. Hier könnten die Entdeckungsreisenden in Sachen Literatur des Wagenbach-Verlags gleich weiter machen, denn von den 18 Romanen der englischen Autorin der klassischen Moderne, von Ivy Compton-Burnett wurden nur vier ins Deutsche übersetzt. Dies seltsame Ding, diese nur vorüberziehende Zeremonie – man kann es kaum glauben. Was für ein edles Paar! Ein Homosexueller und eine Prostituierte. Aber man kann schließlich nicht alles haben. Natürlich, das ist heute kein Aufreger mehr. So ein Paar hätte Topchancen im Dschungelcamp Karriere zu machen. Und das macht ihren Exoten-Status bis heute aus. Ich erinnere mich selbst an eine sehr gute Freundin, die ich an eine Hochzeit mit einer Ärztin verlor. Die Hochzeit war gut bürgerlich und der von Weinzweig geschilderten Hochzeit gar nicht unähnlich, nur viel weniger gehässig. Viele ehemalige Liebhaber meiner homosexuellen Freundin waren bei dieser Hochzeit anwesend gewesen. Da ich meine Freundin über viele Jahre begleitet habe und selbst ein halber Verflossener war, weiß ich das. Ich habe in einem Viertel Jahrhundert erlebt, wie sie sich von der Diva in eine reife Frau, ehetauglich, wandelte. Ich erzähle das, weil auch bei ihr Kriegserfahrung und Flucht eine Rolle spielten. Sie wurde durch den damaligen Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien vertrieben. Sie gehörte der höheren Gesellschaft an, spielte in ihrem Heimatland Tennis und verkehrte mit Intellektuellen. Ihr Bruder ist heute Uno-Botschafter. Ich habe ja selbst auch mal geheiratet. Man steckte mich in ein Clownskostüm und ließ mich Worte sagen und Dinge tun, die mir bis heute peinlich sind. Es war bei mir eine ganz normale Hochzeit. Soweit meine spärlichen Erfahrungen auf diesem Gebiet. Dann habe ich noch ein Buch von einem Altnazi im Bücherschrank mit dem Titel „Hochzeit der Menschheit“. Dort wird die Ehe erst mit der Geburt eines Kindes vollzogen – als Dreiheit. Für den Idealisten Hegel ist die Ehe ein unmittelbar sittliches Verhältnis, es verwandelt die äußerliche Einheit der natürlichen Geschlechter in eine geistige, in selbstbewusste Liebe. So steht es im § 161 seiner Grundlinien der Philosophie des Rechts. Die Ehe als Liebesheirat ist der bürgerliche Event schlechthin und in den 1970ern dürfte das Bewusstsein ihrer Bedeutung noch tief verwurzelt gewesen sein. Doch Weinzweig schildert ein gezeichnetes Paar, das diese Hochzeit als Sprungbrett ihrer Befreiung nutzt. Und die Hochzeit erinnert an das jüdische Bußritual des Malkut. Beim Gottesdienst legt sich der Büßer auf den Boden und die Gemeinde stiefelt über ihn hinweg. Nur so kann man als Verstoßener wieder in die Gemeinde aufgenommen werden. Insofern ist diese Hochzeit ein Bußritual dem sich die beiden unterziehen und zugleich ist diese Hochzeit ein Akt der Befreiung. Eine letzte offizielle Demütigung als Hoch-Zeit. Die Bühne ist ein perfektes Herrenhaus am Bessborough Drive in Toronto. Doch dieses Herrenhaus mit Spiegelsaal hat auch seine besten Zeiten hinter sich. Oben eingesperrt eine demente alte Frau mit der es den besten Dialog überhaupt gibt, mit Judith, die sich später im Spiegelsaal mit dem Captain vergnügt (oder was auch immer das war). Wenn die Tugend ihr eigener Lohn ist, glauben Sie dann, dass das Böse seine eigene Strafe ist? Die versnobte Antwort trifft den Punkt: Das alles ist eine Frage der Proportion. Kleine Tugenden und große Übel werden stets belohnt. Aber große Tugenden und kleine Übel sollten bestraft werden, weil sie so öde sind.
Helen Weinzweig erneuert den scharfen gesellschaftlichen Blick einer Virginia Woolf. In dem
gelungenen Nachwort von James Polk erfahren wir mehr über die spät berufene Autorin. Da auch meine Worte nur Nachworte sind, was soll ich da noch sagen?
Die Sprache ist ein wahres Blitzgewitter. Nicht einfach zu lesen durch den multiperspektiven Stream, den inneren Monologen und MG-Feuer gleichenden Dialogen. Wir werden als Leser
herausgefordert. Die bittere Komik ist immer anwesend, zum Beispiel wenn der Bürgermeister in seiner Ansprache nur über sich selbst spricht und dann abrupt abbricht, weil er noch wo anders eine Rede
halten muss. Dass alle weinen und Tränen vergießen macht den Spießrutenlauf des Brautpaars nur noch effizienter. Und wenn die mexikanische Frau des Brautvaters (nicht älter als die Braut selbst) am
Boden sitzt und ihr Kind stillt, erscheint das ganze Herrenhaus einem Flüchtlingslager zu ähneln. Das Chaos eines Flüchtlingslagers mit Sektempfang. Das Herrenhaus als Heterotopie, als ein wirklicher
Ort, wirksamer Ort, der in die Einrichtung der Gesellschaft hinein gezeichnet ist, eine Art Widerlager, tatsächlich realisierte Utopie, in dem der wirkliche Platz innerhalb der Kultur
gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet wird, dieses Herrenhaus ist gewissermaßen Ort außerhalb aller Orte, wiewohl er tatsächlich geortet werden kann. Alles was dort geschieht hat den
Charakter der Parabel, muss nicht weiter gedeutet werden, hat keine Moral von der Geschichte oder so etwas. Die Nebeneinanderstellungen der Hochzeitsgäste, ihre Sehnsüchte, ihre Wunden, ihre
Abgründe, und dann dieses bleiche ungeschminkte Gesicht der alten, jungen Braut! Die Rituale (der Brautstrauß zum Beispiel) geraten zur Farce. Alles ein verkommener, abgelaufener bürgerlicher Witz?
Hier wird auch etwas beerdigt. Es könnte auch ein Leichenschmaus von gleicher Komik sein. Nur müsste man es einfach umdrehen. Hier die gespielte Freude, da die gespielte Trauer. Die dreieckigen
Köpfe, die glasigen Augen und die gekerbten Schwänze liegen steif in ihren silbernen Särgen.
So bleibt auch einiges im Dunkeln, nicht alle Gäste lassen sich einordnen. Geheimagenten und Auftragsmörder mitten unter den Gästen. Es ist keine reine Klassengesellschaft, sondern auch
Gegenüberstellung der Klassen. Der Reichtum ist eine Flut, die alle Schiffe anhebt. Hier explodiert auch etwas, gerät die alte Ordnung aus den Fugen. Und das passt wunderbar in diese Zeit der 1970er
Jahre einerseits und in das sich wandelnde Toronto (wie das James Polk in seinem Nachwort fixierte). Aber es gibt auch einen berechtigten Grund, dieses Buch fast ein halbes Jahrhundert später erneut
zu drucken. Denn unsere Toleranz-Gesellschaft bleibt nicht ungeprüft. Wie ernst nehmen wir die Akzeptanz diverser Lebensentwürfe? Wie weit können wir uns den Konventionen entziehen? Und gibt es nicht
immer noch so etwas wie eine autoritäre Straflust denen gegenüber, die nicht so sind, wie „wir“ es haben wollen? Auch die „Guten“ üben einen Terror aus. Subtil und so phantasielos wie ein
Psychiater.
Wie der ordentliche Captain, der mechanisch Judith vögelt. Sein Gesicht und Hals sind tief gebräunt und sein Körper blassrosa. Es ist diese Fassade einer Gesellschaft, die nur an den sichtbaren
Stellen pflegt und die unsichtbaren Stellen vertuscht statt auch diese zu pflegen. So verlottert auch der Prunk als nichts weiter denn spektakuläre Präsentation. Hoch-Zeit der
Menschheit.
17. November 2020
Alles ist möglich
Von Elizabeth Strout
Aus dem Amerikanischen von Sabine Roth
Als TB erschienen 2020 im Verlag btb
Das untrügliche Wissen, dass alles möglich sei, für jeden, waren es Abel Blaines letzte
Gedanken? Oder konnte ihn die muskulöse Notärztin doch noch retten? Die in jeder Hinsicht äquivoke Begegnung mit dem Geizhals Ebenezer Scrooge aus Dickens Weihnachtslied in Prosa bildet die
letzte Geschichte von neun Erzählungen des Episoden-Romans von Elizabeth Strout. Einen Roman mit Weihnachten enden zu lassen, das ist letztlich schon sehr amerikanisch.
Die inzwischen 64 Jahre alte Autorin stammt aus dem Bundesstaat Maine, der Ostküste der USA. Sie hat Jura studiert und auch einen Abschluss als Gerontologin. Sie ist mit dem ehemaligen Staatsanwalt
von Maine James Tierney verheiratet. Zusammen haben sie fünf Kinder.
Sie begann ihre literarische Karriere mit Kurzgeschichten, die unter anderem bei New Letters erschienen, einem der ältesten Literaturmagazine der USA. Im Jahr 1998 erschien ihr erster Roman, eine Mutter-Tochter-Beziehung wird da geschildert. Strout ist – wie viele Autoren der USA – Dozentin für kreatives Schreiben. Ihre Schreibtechnik erinnert in vieler Hinsicht an die Methoden des großen Altmeisters Raymond Carver und der vorliegende Roman an die Short Cuts von Carver aus den 1980ern. Ich muss gestehen, dass ich diese Form des Episoden-Romans sehr mag. Einem Roman der auf 300 Seiten eine kompakte Geschichte erzählt misstraue ich. Vor allem dann, wenn es sich um eine realistische Geschichte handelt. Und es sind realistische Geschichten, die uns Strout hier vorführt. So wie die Geschichte von dem ehemaligen Schulhausmeister Tommy Gubtill, der sich an die bitterarme Lucy Barton erinnert, die inzwischen eine berühmte Schriftstellerin geworden ist und daraufhin deren Bruder Pete besucht. Die Bartons treffen dann in der Geschichte „Schwester“ aufeinander. Patty Barton ist mit Angelina befreundet, die ihre Mutter in Italien besucht, wo sie mit ihrem zwanzig Jahre jüngeren Geliebten lebt. Später ist Patty mit Charles Macauly zusammen, der uns zuvor in der Geschichte „Das Hammer-auf-Daumen-Prinzip“ begegnete, die in einer Pension endet von Dotty, die Schwester von Abel Blaine (aus der letzten Geschichte). Charles Macauly erinnerte mich dabei stark an Walt Kowalski. Und sollten diese Geschichten einmal verfilmt werden (das werden sie, weil heutzutage alles auch verfilmt wird, und da ist das Präfix ver* schon sehr bezeichnend).
Alle neun Geschichten stehen für sich und doch kennt irgendwie jeder jeden. Alles ist möglich ist daher eine Mehrdeutigkeit, die mit impliziert wie fragil Lebensgeschichten sein können und zugleich in der Form von Schicksal auftreten. Geschichten sind – wie Geschichte – Fahrt aufnehmende Walzen, die irgendwann nicht mehr zu stoppen sind. Die eigene Lebensgeschichte nimmt ihre Fahrt auf und gelegentlich blickt man aus dem fahrenden Zug und denkt, dass man aussteigen möchte. Doch bei der Geschwindigkeit würde man sich das Genick brechen. Dennoch gelingt es Menschen immer wieder, aus dem fahrenden Zug zu springen und das zu überleben. Alles ist möglich. Und darin liegt – bei aller formalen Ähnlichkeit mit Short Cuts – der inhaltliche Unterschied. Während Carver düster bleibt und ein Erdbeben erst das ganz große Erdbeben das noch kommen wird, ankündigt, haben Strouts Geschichten etwas Versöhnliches an sich. Die Figuren des Romans sind verletzt, aber nicht wirklich böse. Naja, vielleicht Jay Peterson, der in „Angeknackst“ versuchte Yvonne Tuttle zu vergewaltigen und sie mit seinen Videokameras entwürdigte. Wie sagte es der Scrooge-Darsteller Linck McKenzy: „Das finden Sie alles im Internet, wissen Sie, bald werden Sie mit dem Handy das ganze Land in die Luft jagen können.“ Auch dieser gesellschaftliche Konflikt erscheint in den Geschichten, unausgesprochen, aber immer da, der zwischen Moderne und Antiquiertheit des Menschen, der zwischen Stadt und Land. Der zugleich trügerische Schutz der Familie steht immer am Anfang unserer Reise. Wenn unser Lebenszug Fahrt aufnimmt, dann ist die Familie unser Ausgangsbahnhof. Und wie jeder vernünftige Reisende möchte man auch wieder zurückkommen. Und hier endet die Metapher Lebenszug. Denn unser Leben endet ohne jede Rückkehr. Der Zug ist einfach plötzlich weg und nach einer gewissen Zeit sogar seine Rückstände, seine Spuren. Die einst eifrig verlegten Gleise verschwinden im Zeitstrudel. Und die hartnäckigsten Spuren, die bleibenden, werden von den Fährtenlesern falsch gedeutet. So viele fehlinterpretierte Leben! Auch das ist möglich. Strout lässt ihre Figuren über die Figuren nachdenken und dabei zeigen sich immer wieder neue Facetten dieser Figuren. Das macht sie insgesamt sehr lebendig. Und es ist eine sehr lebendige Erfahrung, dass wir in das Leben derer die uns begegnen nur einen sehr flüchtigen Blick erhaschen können. Leibnizsche Monaden, die sich durch einen kurzen Blick aus den Zugfenstern aneinander vorbeifahrender Züge erfassen und sich in sehr seltenen Momenten berühren können. Immerhin ist das auch möglich.
Strout nutzt auch die langen Sätze, mit Einschüben, durch Gedankenstrich gekennzeichnete Anmerkungen, wo man – wenn man nicht konzentriert ist – noch einmal ansetzen muss mit dem Lesen. Die Dialoge sind sicher das Schmuckstück der Erzählungen. Das Verhältnis zwischen den Figuren – um das es ja vornehmlich geht in den Erzählungen – wird gerade durch diese brillanten Dialoge spannend. Sie zeichnen auch die Figuren, wie die braun gebrannte Mutter von Angelina, die immer „Herzchen“ sagt und so zum Klischee ihrer selbst wird. Und doch ist sie kein Klischee. Sie hat so lange gewartet, um endlich ihren Anteil am Leben zu bekommen. Sie ist in fortgeschrittenem Alter aus dem Zug gesprungen. Und sie hat sich nicht das Genick gebrochen. Vielleicht braucht man jemanden, der einen sicher auffängt, wenn man aus dem fahrenden Lebenszug springt? Vielleicht fällt man auf die Nase, wenn man so jemanden nicht hat? Aber Lucy ist auch nicht auf die Nase gefallen. Doch sie hat schon als Kind geübt. Man lässt jedoch immer jemanden zurück, wenn man springt. Und dann geht es den Rest der Zeit darum, dass einem die Zurückgebliebenen verzeihen und man sich selbst verzeiht, dass man sie zurückgelassen hat. Auch das ist ein wesentlicher Aspekt der Geschichten und verleiht ihnen einen Zusammenhang, der damit mehr ins praktisch Philosophische zielt.
Daher kommt sicher der versöhnliche, warme Geschmack, den die Geschichten hinterlassen. Sie sind eben nicht ganz traurig, sondern strahlen eine Hoffnung aus, nicht im Erreichen, vielmehr im Erkennen – was eben das Basisgeschäft der Philosophie ist. Es sind keine philosophischen Geschichten, da möchte ich jetzt nicht falsch verstanden werden. Aber es sind Geschichten, die einen philosophisch stimmen. Eine Nachdenklichkeit hervorrufen, die durchaus auch nachhaltig ist. Die Zeit wird mir zeigen, wie nachhaltig.
20. Oktober 2020
Die Welt ohne uns
Von Alan Weisman
Aus dem Amerikanischen von Hainer Kober
Piper-Verlag 2007
Der Professor für Journalismus und Autor für The New York Times Magazin schrieb hier ein Sachbuch von sehr lebhafter Dramatik. Es versetzt uns ein wenig zurück in die Panikattacken der 1980er Jahre. Aber es hat nichts an seiner Dramatik verloren, dass der Mensch zweifelsfrei den Reichtum der Natur so rücksichtslos ausbeutet und in seiner Produktionsmacht sich zugleich selbst zu vernichten droht. Das Schauspielhaus Hannover fühlte sich jedenfalls von Weismans Gedanken-Experiment inspiriert in Zusammenarbeit mit lunatiks produktion (Theaterkollektiv aus Berlin) seit 2010 das „botanische Langzeittheater“ aufzuführen, das mit künstlerischen Mitteln die Frage behandelt, wie die Welt sich ohne Menschen weiterentwickelt. Und inzwischen gibt es zahlreiche Filmdokumentationen in denen das nachgespielt wird. Der Mensch dürfte das einzige Lebewesen sein, das sich die Frage überhaupt stellen kann, wie es wäre wenn es nicht wäre. Das konnte der Mensch nicht immer. Denn erst mit der Aufklärung begann der Mensch sich als Subjekt der Evolutionsgeschichte zu begreifen und nicht als Subjekt Gottes und damit Grundlage der Schöpfung überhaupt. Schon jetzt hat die Spezies Mensch auf der Erde seine Spuren so tief eingegraben, dass sie sein Verschwinden einige Tausend Jahre überdauern können. Doch das Zeitdiagramm am Ende des Buches zeigt, dass selbst diese Spuren vergehen. Vielleicht wird es sogar langsam Zeit, dass wir verschwinden?
Treffen sich zwei Planeten.
„Wie geht es dir? Du siehst schlecht aus“, sagt Planet A.
„Ach, ich kann dir sagen, ich fühle mich fiebrig und beschissen“, antwortet Planet B.
„Hast du dir was eingefangen?“
„Und wie, ich habe Homo sapiens.“
„Ach“, antwortet Planet A darauf und versucht Planet B zu beruhigen, „das kenne ich. Hatte ich erst selbst vor kurzem, vor einer Million Jahren. Das geht vorüber. 10.000 Jahre kommt er, 10.000 Jahre
bleibt er, 10.000 Jahre geht er.“
In ökologisch motivierten Kreisen wird dieser Scherz gerne tradiert und der Mensch zum Schädling, zum Krankheitserreger degradiert. Doch 30 Billionen Mikroorganismen die mit uns in Symbiose leben,
würden den Menschen vielleicht auch vermissen. Ein letztes Festmahl hätten sie noch an uns. Allein in meiner Achselhöhle leben ca. 4.000 Mikroorganismen. Und sie sind auf uns spezialisiert! Von den
ca. eine Million Arten sind nur 200 wirklich krankheitserregend. Das ist grade mal der fünfte Teil eines Prozents! Und auch von den 3.000 unterschiedlichen Viren die es gibt, machen uns nur 150
wirklich krank. Das sind auch nur 5 Prozent.
Und wie das Dr. Thomas Ksiazek (Seite 325) erläutert, sind sie es nicht, die uns alle töten werden. Vermutlich müssen wir es selbst machen und man könnte unser Verhalten auch als suizidal einstufen.
Andererseits könnte es genauso sein, dass gerade in diesem Widerspruch gegen die Natur unsere Zukunft liegt. Man nennt das seit ein paar Hundert Jahren Fortschritt. Wir können daher nicht
einfach einen Wert setzen und aus dem jetzigen Sein der Welt auf das zukünftige Sein-Sollen der Welt schließen.
Vor kurzem hörte ich mir einen Vortrag der Meeresbiologin Antje Boetius an, über das dramatische Schmelzen des arktischen Eises. Sie reiste mehrfach mit dem Polarstern in die Arktis. Ich zitiere mal:
„Gestern war ich noch in Berlin auf einer Ärztekonferenz und morgen fliege ich dann nach New York zu einer Ethik-Konferenz.“ Hat man hier also den Bock zum Gärtner gemacht? Und wenn wir schon
nicht ganz verschwinden, sollten wir uns wenigstens deutlich reduzieren? Im Augenblick wo ich dies schreibe leben 7.707.000000 Menschen auf der Erde und wenn ich mit dem Text hier fertig bin, sind
weitere 5.000 dazu gekommen. Durch die wachsende Zahl steigt die Reproduktion exponentiell an. 30 Billionen Mikroorganismen leben in mir und auf mir. 100 Milliarden Nervenzellen finden allein in
meinem kleinen Köpfchen Platz. Wenn man meine Nervenzellen schön ordentlich nebeneinander legt ergibt sich eine Strecke von 5,8 Millionen Kilometern. Damit kann man die Erde 145-mal umwickeln. Nur
mit meinen Nervenzellen!! Die meisten meiner Nervenzellen (70 Prozent) befinden sich übrigens im Kleinhirn (nicht nur bei mir). Die meisten Menschen leben in Städten auf engstem Raum. Die „wir
platzen aus allen Nähten / das Boot ist voll These“ halte ich für falsch. Arten überleben durch Anpassung. Das Problem der Spezies Mensch dürfte in seiner Spezialisierung liegen. Ändern sich die
Bedingungen überlebt der Generalist. Doch der Mensch ist nach wie vor die cleverste Spezies dieser Erde – er hält sich jedenfalls dafür. Könnte es nicht sein, dass er Lösungen findet? Sicher. Aber er
muss sich beeilen. Doch unsere Trägheit ist System bedingt. Für die Erde wäre es eine Erholung, wenn der Mensch verschwindet. Und so wie die aktuelle Situation ist, sollte der Mensch sich mit seinem
Verschwinden nicht mehr viel Zeit lassen.
Nun. Ich bin ein Stadtmensch. Unberührte Natur begegnet mir bestenfalls in einer Netflix-Dokumentation. Mich selbst als Schädling zu begreifen, fällt mir schwer. Im Gegenteil. Ich halte mich sogar
gelegentlich für nützlich. Mein privates Verschwinden ist eine abgemachte Sache und der Gedanke daran wird mit jedem Jahr das ich älter werde unangenehmer. Die berühmte tickende Uhr gibt ein nerv
tötendes Geräusch von sich. Buchstäblich. Und ich lebe gern. Inzwischen bin ich bekennender Vegetarier (und fast Veganer). Im Gegensatz zu der Meeresbiologin Antje Boetius ist mein ökologischer
Fußabdruck bescheiden. Ich bin seit Jahren nicht mehr geflogen, seit Jahren nicht mehr weiter gereist als bis zur nächsten Stadt (um dort Geld zu verdienen von dem ich leben muss). Ich besitze kein
Auto und verbrenne keine Fossilien. Meinen Plastikmüll versuche ich zu kontrollieren und ärgere mich über jedes Polymer immer mehr. Und doch bin ich eine erdgeschichtliche Zeitbombe. Unter 100
Kilogramm Plastik im Jahr komme auch ich nicht. Mein Stromverbrauch ist allein durch das Internet (das muss ich benutzen für die Selbsterhaltung) maßlos. Meine bloße Existenz bläst durch Atmen etwa
1.000 Kilogramm CO2 jährlich in die Luft. Ich bin ein Monster, ein Erdfresser! Und natürlich warte ich darauf, dass Elon Musk endlich in die Pötte kommt, damit ich den nächsten Planeten
auffressen kann. In dieser satirischen Überspitzung sieht man ein Grundproblem, das wir als erstes in den Griff bekommen müssen. Wir müssen aufhören, die Spezies Mensch immer in Konkurrenz zur Natur
zu sehen. Wenn wir Menschenrechte (Freiheit, Leben, Würde) ernst nehmen, dann sind sie Teil unseres Projektes und wir nähern uns der Rechteübertragung auf Tiere und auf Pflanzen. Tiere und Pflanzen
können ihre Rechte nicht selbst einklagen. Sie sind Rechtsobjekte und keine Rechtssubjekte. Alan Weisman hat sehr beredt und fundiert dargelegt, dass wir diese Haltung überdenken müssen. Vielleicht
spricht die Natur zu uns auf diese Weise und wird damit zum Rechtssubjekt. Das mag seltsam utopisch, sogar sonderlich klingen. Doch schon der SF-Autor Arthur C. Clark definierte drei
Gesetze:
- „Wenn ein angesehener, aber älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, hat er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht. Wenn er behauptet, dass etwas unmöglich ist, hat er höchstwahrscheinlich unrecht.“
- „Der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist, ein klein wenig über diese hinaus in das Unmögliche vorzustoßen.“
- „Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.“
Lasst uns Magier werden mit einer tellurisch positiven Technologie!
16. September 20
Beethovn
Von Albrecht Selge
Erschienen im Verlag Rowohlt 2020
Sie sind mit der Haarlocke betrogen! Sehen Sie, mit solchen furchtbaren Creaturen bin ich umgeben, dass sie alle Achtung, die sie respectablen Menschen schuldig sind, auf die Seite setzen. - Ludwig van Beethoven.
In ihrem letzten gemeinsamen Studioalbum „Abbey road“ gibt es das Lied „Because“ und das
beginnt mit der verkehrt herum gespielten Eingangsmelodie von Beethovens berühmter Mondscheinsonate, die er 1801 für seine damals 16jährige Klavierschülerin Julie Guicciardi schrieb. Because the
world is round. Lautet die erste Strophe. Allein an dieser Anekdote erweist sich der popkulturelle Status des Tonkünstlers belgischer Abstammung. Lange bevor der Adonnino-Ausschuss die
Götterfunken der Neunten als Europahymne vorschlug und jedes depperte Fußballspiel uns mit Beethauffen um die Ohren geschlagen wird, lange vorher schon war Beathaven ein Popstar.
Nämlich schon zu Lebzeiten. In legendären Klavier-Battles fegte der junge Best of Heavy seine Konkurrenten von der Bühne. Und alle kennen wir den Anfang des zweiten Satzes der achten Sonate
Opus 14. Hört man während des Lesens von Selges Roman sich durch Beethoven durch, dann hat man permanente Wiederhörerlebnisse. Mir war gar nicht bewusst, wie viel Musik von Beethoven in meinen
Ohrengängen widerhallt. Goethe war 21 Jahr alt und beendete in Straßburg sein Jura-Studium, da wird Luigi in Bonn, Kurköln ins Heilige Römische Reich Deutscher Nation hineingeboren und im
restaurierten ausspionierten, österreichischen Kaiserreich in Wien wieder hinaus gestorben. Als Susanna Margaretha Brandt an einem kalten Januarmorgen an der Frankfurter Hauptwache unter
beständigem zurufen der Herren Geistlichen durch einen Streich der Kopf glücklich abgesetzt wurde, war Beethoven zwei Jahre alt. Allein daran sieht man, dass die Intervention von Napoleon im HRR
Deutscher Nation dringend nötig war. Die dritte Sinfonie hieß daher auch ursprünglich Sinfonia grande, intitolata Bonaparte. Doch als sich Napoleon 1804 selbst zum Kaiser krönen ließ, soll
Beethoven auf dem Notenblatt den Namen Napoleon so wütend ausradiert haben, dass das Blatt riss. Und das passt mehr zum Papapamm der fünften. Das alles ist sedimentiertes Kulturgut bürgerlicher
Vormärz-Nostalgie, bis sich das aufstrebende Bürgertum im Nationalliberalismus des wilhelminischen Kaiserreichs autoritativ zur Volkseinheit aufschwang. So tat sich schon Dieter Kühn 1996 mit seinem
Roman über Beethoven schwer. Kühn setzte Beethoven gemeinsam mit dem schwarzen Geiger Georg Bridgetower auf den Dreimaster Southern Cross und ließ ihn nach Afrika reisen, wo der wandernde Beethoven
von Charlotte von Trebnitz begleitet und inspiriert von den rhythmischen Klängen der Stampfhölzer die A-Dur Sonate, die berühmte Kreutzer-Sonate komponierte. Diese schwarzafrikanische Phantasie
zeigt schon, dass es mindestens so schwer ist, einen originellen Roman über Beethoven zu schreiben, wie über Goethe. Eigentlich sogar unmöglich. Michael Meert machte daher mit „Hände weg von
Beethoven“ (auch 2020 erschienen) eine Satire aus seinem Versuch, indem er Beethoven einfach in unsere Zeit versetzt. Am Originellsten ist noch der Graphic Novel „Unendliches Genie“ von Peer Meter.
Dort kondolieren die Besucher dem eben verstorbenen Genie und erzählen sich in Rückblenden über die heuchlerische Gesellschaft und ihrem rücksichtslosen Umgang mit Beethoven. Schon Adorno meinte über
Beethoven: „Beethoven hat sich nicht an die Ideologie des vielzitierten aufsteigenden Bürgertums der Zeit von 1789 oder 1800 angepaßt, sondern war selber von dessen Geist. Daher sein
unüberbotenes Gelingen.“ (Musikalische Schriften IV, Adorno)
Dieser lärmende, trinkende, taube und fast blinde Tonkünstler wird von Selge durch die Mithilfe seiner Zeitgenossen daher nur halb eingefangen. Allen voran die vermutlich „unsterbliche Geliebte“
Josephine von Brunsvick und sein Neffe Karl schildern ihn eher verlottert und verrückt. Aber Beethoven war auch ein äußerst erfolgreicher Unternehmer und Selbstvermarkter, ganz im bürgerlichen Geist
des aufstrebenden Liberalismus. Beethoven war kein mäßig besoldeter Hofkapellmeister, sondern eben ein Tonkünstler, ein Selfmademan in Sachen Musik.
Selge lässt seine ausgewählten Figuren im inneren Monolog jeweils über Beethoven nachdenken. Doch ein richtiges Zentrum, ein konzentrierter Plot entsteht nicht. Man kann darauf auch verzichten. Zumal
die eingefangenen Stimmen die Stimmung dieses restaurativen Metternich-Wiens gut einfangen. Sehr sympathisch an dem Roman ist, dass die Frauenstimmen lauter wurden. Schließlich spielten die Frauen in
Beethovens Leben eine tragisch herausragende Rolle. Und sie waren nicht nur Musen. Sie waren eigenständige Künstlerinnen, wie Tekla Badarzewska mit ihrem One-Hit-Wonder Gebet einer
Jungfrau.
Die von Albrecht Selge bislang immer begeisterten Kritiker waren diesmal nicht ganz so
angetan. Sie hatten sich mehr erhofft, als einen In-Talk mit verschlüsselten Bildungsbürger-Witzen. In gewisser Weise ist das ungerecht. Aber auch nicht ganz unberechtigt. Selge arbeitet oft mit dem
Stilmittel des Anakoluth und der Synkope. Die Gedankenstriche ergeben bestimmt drei bis vier Druckseiten. Die drei Formen des Anakoluths - Ausstieg, Umstieg und Rückzug -, die Selge besonders in der
Grillparzer-Passage nutzt, sind durchaus der Musik Beethovens angemessen. Aber in großer Summe nerven sie dann mehr. Aber wer weiß? Vielleicht ist das ja Absicht. Alex will. Wem. In. Die Fresse
hauen. So steht es auf Seite 200 oben in dem Kapitel über Alex Leverkuhn. Da hat Selge gleich zwei Bezüge eingebaut. Einmal in Alex den Bezug zu Clockwork Orange, dem
berüchtigten Roman von Anthony Burgess. Burgess schildert einen jugendlichen Schläger namens Alex. Der ist intelligent und liebt Musik, vor allem Ludwig van Beethoven. In einem Zeitungsartikel liest
Alex, dass ein Theoretiker meint, man könne die heutige Jugend besser in den Griff bekommen, wenn man sie für Künste interessiere. Alex kann darüber nur lachen, denn Musik (und gerade in seinem Fall
die als kultivierter als die Rock-Musik eingestufte klassische Musik) erweckt in ihm umso mehr bestialische Gelüste. Das hat dann Stanley Kubrick kontrafaktisch umgesetzt. Bei einer brutalen
Tötungsaktion der jugendlichen Schläger hört man im Hintergrund des Films eben Beethoven. Welcome Hooligans. Aber er hätte es einfach nicht noch extra erwähnen müssen. Da fühlte ich mich schlicht
nicht ernst genommen. So nach dem Motto: Du verstehst nicht warum ich das schreibe? Ich erkläre es dir gleich darauf. Ärgerlicher Snobismus.
Der weitere Bezug ist im Nachnamen Leverkuhn angelegt, das ist der Name von Thomas Manns Dr. Faustus – Adrian Leverkühn. So spiegelt sich brutal-teuflisches im Namen von Alex
Leverkuhn.
Haydn, nicht Hayden! Erzählt uns zum Ende das träumende Kind. Daher auch der Titel des Romans.
Am 27. März 1827 verstarb der große Tonkünstler an den Folgen einer Lungenentzündung in seiner letzten Wohnstätte im neunten Gemeindebezirk in der Wiener Schwarzspanierstraße 15. (In der gleichen
Wohnung erschoss sich 76 Jahre später der österreichische Philosoph Otto Weininger im Alter von nur 23 Jahren.)
Beethoven wurde zwei Tage später am Währinger Ostfriedhof beigesetzt. Franz Grillparzer hielt die Grabrede und Franz Schubert (der nur ein Jahr später verstarb) war einer der 36 Fackelträger.
25.August 20
Das Pfingstwunder
Von Sibylle Lewitscharoff
Erschienen 2018 im Verlag Suhrkamp
Im Jahr 2013 trafen sich in Rom auf dem Aventin 34 Dante-Forscher zu einem Kongress. Am Ende
des Kongresses verschwinden 33 von ihnen zusammen mit drei Angestellten, indem sie offensichtlich zum Himmel auffahren. Zurück bleibt allein der Ich-Erzähler Gottlieb Elsheimer. Allein und nahezu
verwahrlost lebt er danach in seiner Frankfurter Wohnung und erzählt von dort aus in einer Art Monolog die Ereignisse nach. Warum wurde ausgerechnet er zurückgelassen? Das ist auch Dantes Frage im
Paradiso: Warum darf Vergil nicht aus dem Limbo?
Lewitscharoff baut daraus eine Art Roman-Essay indem sie die Komödie von Dante nacherzählt. Der Schwerpunkt liegt auf dem ersten Teil der Komödie, den 34 Canti des Inferno. Es sind ja auch 34
Forscher. Es sind 34 Kapitel. Purgatorium und Paradiso werden in den letzten Kapiteln sehr gerafft nacherzählt. In die gelehrten Ausführungen über Dantes Komödie mischt Lewitscharoff Biografisches
vom Erzähler. Es ist kein Roman im eigentlichen Sinn (aber was soll das schon sein? Ein Roman im eigentlichen Sinn?) – es ist eine Hommage an Dante und seine Komödie. Dante Alighieri schrieb
die Komödie Anfang des 14. Jahrhunderts im Exil. Er wurde aus Florenz vertrieben und daher kommen in seiner Komödie auch viele seiner Zeitgenossen vor. Aber auch antike Gestalten, zumal sein Führer
bis zum Eingang ins Paradies der römische Dichter Vergil ist, der die Aeneis verfasste, den Gründungsmythos von Rom, der von dem Trojaner Aeneis handelt, der das fürchterliche Gemetzel der Griechen
an den Trojanern als einziger überlebte. Vor ziemlich genau 700 Jahren starb Dante (1321) und er hat Florenz nie mehr wieder betreten können.
Lewitscharoff gibt ein wenig an in dem Text. Sie hat nahezu alle Übersetzungen der Komödie ins Deutsche gelesen, sie kennt das berühmte Essay über Dante von Ossip Mandelstam, sie weiß von Becketts
Dante-Verehrung und dessen Lieblingsfigur Belacqua. Die Lust, im Original von Dante immer wieder nachzuschlagen, während man wie einen Führer durch Dantes Komödie den Roman liest, diese Lust muss man
dem Lesen voraussetzen. Denn Spannung verbreitet der Roman nicht. Eher liest es sich anstrengend, bildungsgesättigt, fast wie ein Seminar. Man kann das machen. Faszinierend ist die Komödie von Dante
bis heute. Wobei es in Dantes Komödie gar nicht lustig zugeht. Es ist nur im streng literarischen Sinn eine Komödie, weil es gut endet und schlecht beginnt und nicht in Latein abgefasst ist, sondern
im profanen Dialekt. Dante im Exil ist kurz davor, den gleichen Schritt zu unternehmen, wie Cato, der Seelenführer am Läuterungsberg. Cato hatte sich selbst getötet, um Cäsars Rache zu entgehen. Aber
Dante bringt sich nicht um, sondern entdeckt mit Vergil seinen Seelenführer. Ins Paradies jedoch darf der Heide Vergil nicht mehr mit. Da endet die Reise des Römers und er muss zurück in den Limbus.
Die Frage, die sich dem Leser unentwegt stellt: Was hat das alles mit mir zu tun? Das religiöse Thema des Investiturstreits der Päpste mit den Kaisern, die einst von Gregor VII. im11. Jahrhundert
ausgelöst wurde, das ist Geschichte, Geschichtsunterricht. Dante schreibt in Terzinen, in einer durchaus komplizierten dichterischen Form und sein Altitalienisch ist selbst für Italiener nur noch
schwer zu verstehen. Natürlich! Wer so viel über Dante weiß wie Lewitscharoff, der muss was draus machen. Dantes Komödie ist nicht nur bilderreich und bildungsreich. Es ist auch ein Werk, das im
Grunde die Renaissance begründet. Nach der Plünderung von Byzanz durch die Kreuzritter im Jahr 1204 pilgerten zahlreiche Gelehrte von Ostrom (Konstantinopel) nach Florenz und hatten in ihrem Gepäck
Bücher der antiken Denker. Spätestens als Byzanz 1453 endgültig fällt explodierte das Wissen in Westeuropa. Nur 30 Jahre nach Dantes Tod kam das Dekamerone von Giovanni Boccachio, angesiedelt
in Fiesole (drei Kilometer von Florenz). Diese Novellensammlung gliedert sich nach Dantes Vorbild in 100Hundert Novellen, in zehn Tagen erzählen sich sieben Frauen und drei Männer zehn Mal zehn
Novellen, um sich von der wütenden Pest abzulenken, die immerhin drei Fünftel der Bevölkerung von Florenz auslöschte. Weitere Hundert Jahre später kamen die beweglichen Lettern aus Gutenbergs
Manufaktur und beförderten durch die leichtfüßigen Flugblätter die Reformation. Der 30jährige Krieg brachte uns am Ende die Religionsfreiheit.
Dantes Komödie im 21. Jahrhundert? Im Jahr 2013, da steckt die drei drin, für die Terzine (0123), zählt man 20 plus 13, hat man die 33 Gesänge des Purgatoriums und des Paradiso. Das könnte schon ein
kabbalistischer Grund sein. Aber reicht das? Für einen Romanessay über Dante? Und reicht es, mal im großen Saal der Malteser eine Lesung gehalten zu haben? Im Grunde kann man den Plot, die Story in
eine Kurzgeschichte packen. Der mimetische Spielraum der Handlungen ist nicht sehr groß. Und das merkt man dem Text auch an. Es werden zahlreiche Vorträge gehalten und der Icherzähler Gottlieb
Elsheimer breitete dazu sein eigenes Wissen über die Komödie aus. Wir tauchen tief ein in den alten Text. Aber weder Hölle, Fegefeuer noch das Paradies sind aktuell greifbare Konzepte. Sie sind
reichlich aus der Zeit gefallen. Und auch wenn man – wie das Lewitscharoff immer wieder macht – die Welt als Inferno oder Fegefeuer begreifen kann, so ist das Irdische nicht mehr spiegelbar in den
Begriffen von Hölle, Inferno und Paradies. Diese metaphysischen Rückversicherungen sind verloren gegangen, von naturwissenschaftlichen Konzepten der Evolution und der Biologie überholt worden. Aber
das war schon zu Goethes Zeit so, als dieser sich mit dem mittelalterlichen Faust sein ganzes Leben beschäftigte. Faust interessierte immerhin, was die Welt im Innersten zusammenhält und kommt am
Ende darauf, dass es die Liebe ist. Und damit haben wir zumindest das Wesentliche auch von Dantes Komödie erfasst, denn es ist Dantes geliebte Beatrice, die ihn ins Paradies erhebt und ihm die
irdisch-überirdische Dichterkrone aufsetzt. Was dem Faust seine Margarete, ist dem Dante seine Beatrice. Doch das hat Sibylle Lewitscharoff nicht sonderlich ausgeführt. Ein wenig klingt es an in der
Beziehung zwischen Gottlieb und Eva. Und vielleicht ist das ja der Grund, warum Gottlieb als Einziger zurück bleibt. Er hatte keine Liebe, die ihn hinan zieht. Lewitscharoff lässt das offen.
Sie gibt uns keine Lösung an für das Problem ihres Erzählers. Aber Goethes Liebesbegriff ist schon ein ganz anderer als der von Dante. Denn bei Goethe ist nicht nur die Liebe zwischen Mann und Frau
gemeint, sondern als überhöhendes Konzept meint Goethe die Hingabe. Auch die Hingabe an ein Werk oder eine bestimmte Arbeit führt uns hinan. Das ist ein durchaus protestantischer Liebesbegriff, den
Dante noch gar nicht kennen konnte. Die Liebe zu den Menschen, die Hingabe an das Vaterland, die Lust am Komponieren eines Textes. Das war zu Dantes Zeit eher Sünde, Hoffart, fürwitziges Verhalten.
Das macht Dantes Werk in gewisser Weise modern, bzw. ist es ein Prototyp der Renaissance, wie sich Dante als Person erhebt. Gottlieb Elsheimer erlebt die Erhebung seiner Forscherkollegen und bleibt
selbst am Boden haften. Die in Zungen redenden und verzückten Forscher gehen ganz in Dantes Werk auf. Elsheimer wirkt dagegen blass, erdschwer, begeisterungslos. Gottlieb Elsheimer ist eher ein
Verwalter des Wissens. Und auch das macht den Text von Lewitscharoff problematisch, denn man merkt es dem Erzähler an. Er weckt nicht wirklich Begeisterung. Hätte uns Ulf Wirsing, oder Alois Wanner
die Geschichte besser erzählen können? Bestimmt. Aber sie konnten es ja nicht, da sie aufgefahren sind. Contrapasso bleibt die schlechteste Wahl übrig. Und damit spielt Lewitscharoff natürlich. Sie
hätte ihrem Erzähler aber mehr zumuten sollen. Denn dann hätte der Bescheidenheitstopos besser gewirkt. So bleibt es bei der Selbstdiagnose des Erzählers nichts als eine tumbe Nacherzählung habe
ich betrieben (Seite 231) – und dabei interessierten mich weder der Speiseplan noch die Mutterkomplexe des Erzählers. Was schade ist. Denn als Dante-Führer eignet sich dieses Pfingstwunder in
jedem Fall.
04. August 2020
Ein ganzes Leben
Von Robert Seethaler
Erschienen im Verlag Goldmann 2016
Robert Seethaler wurde mit dem Roman Der Trafikant aus dem Jahr 2013 einem größeren Lesepublikum bekannt. Schon das war ein besonders eingängig erzählter Text von dem 17jährigen Franz Huchel, der im Wien der 1930er Jahre ganz plötzlich erwachsen werden musste. Gegenüber dem Deutschlandfunk sagte Seethaler: „Ich hatte nie diese Eloquenz, nie diese Selbstüberhöhung, der Welt viel mitteilen zu können. Dementsprechend schreibe ich meine Bücher. Ich muss die Sätze eher zusammenzimmern. Da fließt nichts raus.“ Man könnte mit dem fälschlich Karl Valentin zugeschriebenen, aber aus einem Dialog der Smetana-Oper Die verkaufte Braut stammenden Spruch „Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“ antworten. Es ist eine Kunst, Sätze zu zimmern, als wären sie aus einem Guss, und es verschafft dem Leser viel Vergnügen.
Hier ist Seethaler erneut ein gut lesbarer, bilderreicher Heimatroman gelungen, der die einfache und erdige Lebensphilosophie eines unbelesenen Mannes ab ovo schildert. Zwar beginnt der Roman scheinbar in medias res mit einer Szene die an einem Februarmorgen 1933 spielt. Ein gewisser Andreas Egger transportiert den sterbenden als Hörnerhannes bekannten Ziegenhirten Johannes Kalischka in einer Kraxe den Berg hinunter. Aber es gelingt nicht, der Ziegenhirte entschwindet im Nichts des mit Schnee bedeckten Hangs. Wir Leser wissen nicht was geschehen ist und warum uns diese Szene überhaupt geschildert wird. Erst gegen Ende des Buches hören wir von dem Ziegenhirten noch einmal. Dazwischen schildert uns der Autor die Geschichte von Andreas Egger, der als Kind 1902 in einem nicht weiter benannten Bergdorf ankommt, von dem Bauern Kranzstocker aufgenommen und zum Leben geschunden wird, bis er Mitte der 1970er an einem Februartag mehr oder weniger friedlich an seinem Küchentisch verstirbt.
„Also ein Leben ist ein Leben. Und jedes Leben reduziert sich auf das pure Dasein. Das ist das, was mich interessiert. Der Kern des Daseins, wenn es den gäbe. Für mich war es wichtig, all diesen Zierrat wegzustreichen und nicht näher darauf einzugehen, wie Moden oder Zeitgeschehnisse, die einen nicht wirklich in der Seele berühren. Davon befreit bleibt nichts als das pure Leben. Da geht es immer nur um dasselbe: um Überleben, um Liebe, um Kraft, um Tod.“
So Robert Seethaler über das ganze Leben. Wenn Andreas Egger im Wirtshaus Zum goldenen Gamser sitzt, eine Schüssel Schmalzkrapfen isst und sich mit einem selbstgebrannten Krauterer wärmt, erlebt man ein Stück Idylle wie aus einem Freumbichler-Roman. Er wärmt sich die Hände am alten Kachelofen. Aber dann kommen ihm seine Hände plötzlich „schwer, nutzlos und dumm“ vor. Dann wieder schildert Seethaler wie Nebelfetzen den Berg hochkriechen, sich am Wildbach ein paar Kinder tummeln und auf ihrem Hintern den gefrorenen Wasserlauft hinunter rutschen. Doch dann rufen sie Andreas „Hinker, Hinker“ zu. Immer wieder spielt Seethaler mit diesen Hirten- und Schäferszenen, um sie kurz danach wieder aufzubrechen. Das hat Methode.
„Meine Prämisse ist, ja, die Menschen kommen damit klar. Es gibt so viele Menschen, die Verluste erfahren, schreckliche Ereignisse erfahren müssen. Fast alle Menschen werden einmal mit Tod, Krankheit konfrontiert. Ich glaube daran, dass man durchgehen kann, muss und unter Umständen sogar gestärkt aus solchen Ereignissen hervorgehen kann. Das ist nicht romantisierend, das ist die Vorstellung, die ich habe.“
So Seethaler in einem Interview. Sein Held Andreas Egger erlebt ein heute kaum noch
vorstellbar hartes Leben, eine arbeitsreiche Armut und doch! Nie, nie verbittert er. Vielmehr schlägt er unzählige Löcher in den Berg, der ihm in der Mitte seines Lebens alles nimmt, was er liebt. Im
März 1935 singt der Berg erst, bevor er Marie unter sich begräbt und Andreas einfach ausspuckt. Die nächsten 35 Jahre scheinen nichts weiter als irgendein Tun zu sein. Selbst der Krieg und seine
langjährige Kriegsgefangenschaft ziehen an Andreas vorüber wie die Jahreszeiten an einem Bauern. Zum Ende lebt er als Touristenführer und beendet sein merkwürdiges Leben erfüllt in einem Erdloch.
Tatsächlich äußert sich Andreas dahingehend, sein Leben als erfolgreich zu betrachten. Er hat geliebt, ein Haus gebaut, gearbeitet, nie ist er den Lastern des Trinkens oder der Hurerei verfallen. Er
war bis zum Ende ein karger, anständiger Mensch. Seine letzte Liebeserfahrung mit der Lehrerin war nicht sehr wohltuend. Aber auch das überbrückt Andreas. Ganz anders als der mindestens ebenso
bäuerlich karge amerikanische Held Stoner in dem gleichnamigen Roman von John Williams. Die Stoa die Williams schildert geht viel näher an die Verbitterung, lässt seinen Helden aber ebenso versöhnt
zurück. Andreas Egger ist weniger vielschichtig. Sein Nachdenken über die Welt ist nicht intellektuell (wie das von Stoner). Dennoch gibt es zwischen diesen beiden Helden Vergleichsmomente. „Die
Sterbenden sind egoistisch, dachte er, wie Kinder. Sie wollen ihre Zeit für sich.“ So äußerte sich Stoner am Ende seines Lebens, holte Lust und atmete die „Süße des Sommers“ ein. Stoner wie Egger
sind stoische Naturburschen.
Der Mensch mag sich wenden wohin er will, er mag unternehmen was es auch sei, stets wird er auf jenen Weg wieder zurückkehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So weiß es Goethe
in seiner Biografie „Ein Leben“ (Untertitel: Dichtung und Wahrheit) zu sagen. Goethe wusste – daher nennt er es Dichtung und Wahrheit – dass die Dichtung erst die Basis der Wahrheit ist. Man könnte
auch sagen „Verdichtung“, denn immer ist der Mensch ein geschichtliches Wesen, das sich selbst nur rückblickend erzählt. Und hier gelten immer poetische Gesetze, ob sie uns bewusst sind oder nicht.
Nehmen wir das poetische Gesetz von Seethalers Heimatroman ist es sehr passend, dass er als Autor die einfachste Form der Verdichtung wählte. Doch Vorsicht. Die novellistische Klammer der
Eingangsszene mit dem Hörnerhannes, dessen Leiche man gegen Ende des Romans aus den Bergen birgt, verweist von vorne herein auf nichts weiter als den kommenden Tod. Ist das Leben eine
Beschäftigungstherapie während wir auf den Tod warten? Sind unsere Träume, Hoffnungen, Wünsche nur verrückte Expositionen einer aus dem Tierischen gefallenen Entrückung? Mehr als das, sind sie das,
was wir haben. Was wir sind, sind unsere Träume und Hoffnungen. Und wenn man aus dem ganzen Leben von Andreas Egger eine Wurzel ziehen möchte, dann wäre dies, dass Andreas Egger eben kein Mensch war
wie der Kranzstocker, „der ein Leben lang sein eigenes Glück vor sich her geprügelt hat.“
Der nicht geschundene Mensch wird nicht erzogen, sagte vor 2300 Jahren der griechische Komödiendichter Menander. Ich weiß nicht recht, was ich von dieser Sentenz halten soll. Dennoch! Wenn
jemand gegen Ende des eigenen Daseins die folgenden Sätze sagen kann, dann – so stelle ich mir das vor – ist das schon ein Glück: „Er konnte sich nicht erinnern, wo er hergekommen war, und
letztendlich wusste er nicht, wohin er gehen würde. Doch auf die Zeit dazwischen, auf sein Leben, konnte er ohne Bedauern zurückblicken, mit einem abgerissenen Lachen und einem einzigen, großen
Staunen.“
Es wäre dennoch schöner (im Sinne der Kunst) wenn man sich zu so einem Satz nicht gar so sehr quälen müsste.
10. Juli 20
Die Bagage
Von Monika Helfer
Erschienen 2020 im Verlag Hanser
Bagage, ein Lehnwort aus dem Französischen Wort für Gepäck, nannte man im 17. Jahrhundert noch
den Tross eines Landsknechtsheeres, jene die das Gepäck der Soldaten trugen. Da dieser Haufen (oder auch Schar genannt) nicht sehr geachtet war, entwickelte sich im 18. Jahrhundert das Wort pejorativ
für Gesindel, Pack. Da kommt sie wieder, die ganze Bagage. So heißen Leute, über die man sich ärgert. Und so heißen auch die Moosbruggers, die fernab vom Dorf am Fuß des Berges irgendwo im Vorarlberg
in einem kleinen Haus leben. So weit weg vom Dorf, dass es sogar für den Postboten eine Zumutung ist, die er nur auf sich nimmt, um die schöne Maria anschauen zu können.
Für meine Bagage lautet die Widmung. Monika Helfer (die sich mit ihrem Ehemann Michael Köhlmeier einen Arbeitsplatz teilt) schreibt von ihrer Großmutter aus der Zeit, da ihre Mutter noch
nicht geboren war, am Anfang des Großen Krieges. Ihre Tante Kathe hat es ihr im Alter von 96 Jahren mündlich erzählt. Diese schmale Erzählung hat es dabei in sich. Die Geschichte sind viele
Geschichten von Maria und Josef (so sollte man seine Protagonisten nur nennen, wenn es wahr ist), von den Kindern Heinrich, Walter, Lorenz und dem vermeintlichen Kuckucksei Margarethe, Monika Helfers
Mutter. Früh muss der stille und tief schwarzhaarige Josef in den Krieg ziehen. Er lässt die Familie daher ungeschützt zurück und beauftragt den Bürgermeister und Büchsenmacher Gottlieb Fink damit,
auf seine schöne und von vielen begehrte Frau aufzupassen. Doch dieser Fink vergreift sich selbst mehrfach an der schönen Maria. Doch Margarethe ist nicht von ihm. Aber ist sie vom Georg aus Hanover?
Ihn lernt sie auf einem Markt kennen und plötzlich steht dann der Rotschopf vor ihrem Haus. Auch den Kindern (vor allem dem aufgeweckten Lorenz) gefällt der Mann. Das Dorf jedenfalls spekuliert und
dahinter verbirgt sich die typische Ablehnung, die Menschen widerfährt die irgendwie anders sind. Aus der räumlichen Distanz, aus der sozialen Distanz von Josef und aus den nicht genauer erklärten
Geschäftchen die den Bürgermeister mit Josef verbindet, nährt sich diese Ablehnung. Monika Helfer beschreibt die vielen kleinen Ereignisse mit einer lakonischen und selbst naiven Erzählerstimme.
Österreich hatte Serbien den Krieg erklärt, und Russland war Serbien beigesprungen, und der duetsche Kaiser war Österreich beigesprungen und hatte Russland den Krieg erklärt, und Frankreich war
Russland beigesprungen und hatte Deutschland und Österreich den Krieg erklärt, und Deutschland war in Belgien einmarschiert.(Seite 12)
Die oben zitierte Stelle könnte ein Zitat von Tante Käthe sein.
Ihr gelingt es auf erstaunliche Weise die Schwierigkeit zu überbrücken, die entsteht wenn der Autor einer Geschichte zugleich sein Erzähler ist. Der homodiegetische Erzählmodus gelingt vor allem,
weil die Geschichte wiederum von einer unsicheren Quelle (der alten Tante Kathe) mündlich tradiert ist.
So kann die Erzählerin immer wieder auch in den Zeiten wandeln. Auf einer Erzählebene befinden wir uns in den Kriegsjahren (1914-18) und auf der anderen Erzählebene sind wir in der nahen
Vergangenheit, novellistisch durch die schriftliche Wiedergabe der Autorin Monika Helfer, was sie eben von ihrer Tante erfuhr, spät erfuhr. Und noch länger wartete sie damit die Geschichte
aufzuschreiben, bis alle erwähnten Protagonisten real verstorben waren, um niemandem damit zu schaden. Die Schicksalshaftigkeit ist dabei ganz sparsam dargestellt und wirkt so noch beeindruckender.
Viele der erwähnten Figuren sterben früh. Unfälle, Selbstmord. Auch Monika Helfer Mutter wird nicht alt, stirbt nach kurzer und heftiger Krankheit und die Autorin wuchs bei ihrer Tante Kathe (die
aussah wie eine Indianerin) auf.
Die Armut hat die Familie fest im Griff. Daher sind sie auch abhängig vom Bürgermeister Fink. Doch verlieren sie nie ihren Stolz. Einmal organisiert der grade mal 11-jährige Lorenz im Dorf Vorrat.Dabei muss er in einer eisigen Nacht durch den tiefsten Schnee stapfen. Überhaupt ist Lorenz wohl die beeindruckendste Figur. Früh musste er erwachsen werden. Aber es scheint zu seinem Naturell zu passen. Während sein älterer Bruder Heinrich nur mit dem Vieh zurecht kommt und das sein Leben so bleiben wird, muss Lorenz den Vater ersetzen.
Mehrfach erwähnt Monika Helfer Die Kinderspiele von Peter Breughel dem Älteren um
1560 entstanden. Aus mittlerer Höhe blickt man auf einen Platz hinab. Doch man hat keinen idealen Standpunkt, um Einzelheiten zu erkennen muss man sich vom Bild entfernen. Das könnte man metaphorisch
sehen. Denn um Einzelheiten ihrer Bagage zu erkennen, brauchte Monika Helfer den historischen Abstand von über 100 Jahren. Die Kinder auf dem Bild unterscheiden sich nicht, sie haben alle Knopfaugen,
tragen die gleichen Kleider wie die Erwachsenen (was der Zeit des Barock entspricht in der Kinder nur kleine Erwachsene waren). Die über 91 Kinderspiele dieses niederländischen über einen Meter
großen und breiten Bildes sind die Üblichen. In Deutungen wird spekuliert, dass Breughel damit davor warnen wollte, das Leben mit kindlichen Spielen zu vergeuden.
Insofern beeindruckte mich, dass Maria letztlich nicht erwachsener wirkte als Lorenz. Es spielt eigentlich nur der Kleinste, Walter. Lorenz muss seine Mutter mit einem Gewehr vor dem Bürgermeister
verteidigen, ironischerweise ist dieses Gewehr ein doppelläufiger Fink-Stutzen aus der Werkstatt des Bürgermeisters selbst – ein Geschenk für Josef (für irgendein Geschäftchen).
Josef macht sogar im Krieg weiter seine Geschäftchen und kommt mit Geld vom Krieg zurück. Doch er kommt verändert zurück. Auch das ist grandios. Denn der schweigsame Josef hat plötzliche Redeanfälle
aus dem Krieg zurück gebracht. Nach dem frühen Tod von Maria folgt er ihr bald ins Grab. Und Kathe muss schon da die Familienpatronin spielen. Später macht sie es erneut mit den Enkeln ihrer jüngeren
Schwester Margarethe (dem möglichen Kuckuckskind).
Die beeindruckende, leise Erzählung liefert uns ein karges Bild von schönen Menschen (Josef und Maria), deren biblische Kargheit und Ungewissheit der Herkunft von Margarethe als Anagoge dient.
Das Umschlagsmotiv der blassen nackten Frau von Gerhard Richter hat mir persönlich nicht
gefallen. Marias Nacktheit und Schönheit ist nicht erotisch, sondern tugendhaft. Ihre Anziehungskraft ist sicher ätherisch (wie auf dem Bild), aber das Bild trifft die Figur bei weitem nicht.
Immerhin hat Maria bei aller Zartheit raue Handinnenflächen. Sie ist Ehefrau und Mutter – kein Sexualobjekt. So wie sie Gerhard Richter zeigt, hätte sie eher der Postbote gemalt, dessen stille
Verliebtheit zwar nicht unsympathisch war, aber auch nicht tugendhaft.
24. Juni 2020
Zazie in der Metro
Von Raymond Queneau
Erstmals erschienen bei Éditions Gallimard 1959
Besprechung nach der Übersetzung von Eugen Helmlé aus dem Jahr 1960
Eine etwas andere Besprechung. Denn womöglich ist schon das Be-Sprechen ein Metasprechen das
von seiner Struktur her viel zu ordentlich ist, um dem Antiroman gerecht zu werden. Zunächst: Da Eugen Helmlé ein verdienter Übersetzer war, unter anderem der Romane von Max Aub (aus dem Spanischen,
daher kenne ich ihn als Übersetzer), weil Helmlé sämtliche Texte von Queneau übersetzte und schlicht, weil ich diese Ausgabe schon lange im Bücherregal ungelesen stehen habe, verzichtete ich darauf,
die neue Übersetzung aus dem Jahr 2019 von Frank Heibert zu lesen. Ein gehöriger Nachteil, denn sowohl Anmerkungen und Nachwort des Neuübersetzers fehlen mir. Mündlichkeit, phonetische Orthografie,
Sprachspiele und Sprachmischungen die auf Mikroebene an Finnegans Wake erinnern, machen diesen Antiroman ohnehin schwer übersetzbar. So oder so hat man daran sein Vergnügen, oder eben nicht. Mühsam
zu lesen ist er auch sooderso. Denn die vielen Dialoge erinnern zum Teil an ein Theatermanuskript. Gestik wird nur in Klammern „Gebärde“ gesetzt und die verschiedenen Sprachstile sind nicht
an die Figuren gebunden. Die Geschichte ist „das Trugbild eines Trugbildes“ (Kapitel 8), und das kann man im Doppelsinn des Wortes „Trugbild“ verstehen. Der Traum eines Traums, ein Sprachinception.
Von Metropolis nach Babylon.
„Warum sagt man bestimmte Dinge und nicht was anderes“ fragt Zazie einmal ihren Onkel Gabriel. Er antwortet darauf: Wenn man das nicht sagen würde, was man zu sagen hat, würde einen keiner
verstehen. Aber Gabriel räumt ein, dass man dazu nicht gezwungen werden kann. Man könnte also jederzeit etwas anderes sagen. Vielleicht ist diese Szene am Eiffelturm geradezu der Schlüssel zum
ganzen Projekt. Der 1903 in Le Havre geborene Surrealist Queneau gehörte zu den ersten Unterzeichnern des Manifestes Collège de ’Pataphysique, das sich zur Pataphysik bekennt, einem
absurden Wissenschaftskonzept von Alfred Jarry. Ein Epiphänomen ist das, was zu einem Phänomen hinzukommt. Die ’Pataphysik, deren Etymologie mit epi (meta ta physika) zu schreiben
ist, ist die Wissenschaft von dem, was zur Metaphysik hinzukommt – sei es innerhalb, sei es außerhalb ihrer selbst – und die sich ebenso weit jenseits dieser ausdehnt wie diese jenseits der Physik
[…] Sie soll die Gesetze untersuchen, die diesen Ausnahmen unterliegen, und will das zu dem existierenden zusätzlich vorhandene Universum deuten. So Alfred Jarry in seinem dem Manifest zugrunde
liegendem Werk Heldentaten und Ansichten des Doktor Faustroll. Zu den Mitunterzeichnern gehörten Boris Vian, Eugène Ionesco, die Marxbrüder, Marcel Duschamp, Umberto Eco, Man Ray.
Dem Aberwitz und den Intentionen der Surrealisten kann man heute nicht mehr folgen. Vor allem weil so vieles davon Realität wurde. Jemand achtet auf seine Corona-APP um sich vor einer tödlichen
Erkrankung zu schützen, überquert die Straße und wird tot gefahren. Das ist Pataphysik vom Feinsten.
Zazie hat in Frankreich gewissen Kultstatus. Das liegt natürlich nicht am Roman, sondern am Film von Louis Malle und dem Kinoplakat mit dem Konterfei von Catherine Demongeot. Doch anders als Lolita
oder Pipi Langstrumpf ist Zazie ein Sprachkind. Denn es geht Queneau darum der adamitischen Sprache zu folgen, der eigentlichen Sprache, der Kindersprache. Wie sprechen wir ursprünglich? Was wollen
wir ursprünglich sagen? Ziehen wir einmal unsere Floskeln ab, unsere ganze anerzogene Kommunikation. Welche Sprache bleibt übrig? Was schon Walter Benjamin in seiner Berliner Chronik verfolgte (sein
ursprüngliches Sprechen / Denken als Kind wiederzufinden) versucht auch Queneau in diesem Roman. Die vielen Dialoge sind daher Programm. Sie dienen nicht der Wiedergabe von Gesprächen der Figuren.
Sie wurden geschrieben, ohne wirklich nachzudenken. Sofern das überhaupt möglich ist. Ohne dem Denken eine Zensur zu verpassen. Daher ist jede Übersetzung zum Scheitern verurteilt, ja jede
Übersetzung führt das ganze Projekt selbst ins Absurde. Man müsste es übersetzen ohne nachzudenken, ohne Zensur der Übersetzung.
Heute benutzen wir Sprache wie Technokraten. Wie ein Programm, das man schreiben kann und das dann tatsächlich zu bestimmten Tatsachen eine Aussage macht. Die Naivität mit der heute Sprache be- oder
genutzt wird steht im Widerspruch zur linguistischen Forschung. Die Diversifikation von Textlinguistik bis Psycholinguistik zeigt, dass Sprache keine einheitliche Systematik hat. Seit Chomsky spaltet
sie sich in generative Grammatik und Strukturalismus. Im Barock fragte man sich im Wesentlichen „wie soll ich sprechen?“. Woher die Sprache kam, war gar keine Frage. Sie kam von Adam. Das wusste man
damals noch (daher Benjamins Suche nach der adamitischen Sprache). Die Aufklärung fragte sich jedoch: Woher kommt es, dass wir sprechen? Ist es angeboren? Erlernt? Beides?
Zazie, ein Mädchen an der Schwelle des Erwachsenwerdens, steht an einer wunderbaren (im Wortsinn) Grenze. Sie spricht schon ganz so wie jeder Erwachsene. Sie begreift und denkt aber noch wie ein
Kind. Ihre Zoten (bist du hormosechsuell?) sind naiv und provokant zugleich. Der berühmte Kindermund fängt an zu begreifen, dass Erwachsene ihre Sprache benutzen, ja missbrauchen. Der Kerl, der Zazie
wieder zu ihrem Onkel zurückbringt und behauptet sie habe ihm die Bludschiens gestohlen ist ein Beispiel für die Sprachverwirrung. Er hat sich sogar seinen Namen nicht gemerkt und weiß weder Name
noch sein Alter. Sogar seine Rolle ist offen. Äußerlich gleicht er mit seiner Melone und seinem Spazierstock einem Polizisten, einem „Bullen“. Ich könnte es weiterdichten: Ein Polyp, ein
Bazifist, schon hier! Ein Bazi, der Zazie fisten will ist ja kein Pazifist. Er verursacht Polypen. Würde man heute so schreiben? Und weiß ein Kind was „fisten“ eigentlich ist. Vom Hörensagen?
Nebelhaft formt sich das heraus, bis all das sein Geheimnis verliert und nur noch Tabu ist. Am Ende ist Zazie einfach „älter geworden“. Sie wurde sprachentjungfert, defloresziert. Man kann, man darf
den Text nicht ernst nehmen. Hier geht es nicht um Glaubwürdigkeit. Selbst die zahlreichen Anspielungen sind mehr Spiel. Wenn ein Kind fangen spielt, dann fangen sie sich ja wirklich. Die guten
Bürger haben das ganz vergessen. Sie unterscheiden Spiel und Ernst, sie glauben Unterhaltung sei ein Spiel. Dabei sagte Schiller schon: Der Mensch ist nur da ganz Mensch wo er spielt und er spielt
nur da, wo er ganz Mensch ist. Zazies Spiel führt uns an der Nase herum. Die Figuren denken laut. Angenommen, wir würden uns alle immer auch zugleich denken hören, wir kämen aus dem Lachen nicht mehr
heraus. Hier hören wir jemanden denken, der vor 60 Jahren dachte. Vielleicht ist das nicht mehr so komisch, wie damals. Und es ist auch nicht rekonstruierbar. Situationskomik in Sprache zu
bringen ist nicht nur schwer, es hat auch eine geringe Halbwertszeit. Oft ist die Situationssprachkomik oder die Sprachsituationskomik von den komplexen Umständen des Hier und Jetzt abhängig. Wie oft
habe ich gelacht und konnte nicht mehr nachvollziehen warum. Und andersherum. Gestern (zum Zeitpunkt als diesen Text schreibe) hatte ich Geburtstag. Ich bin älter geworden. Mehr kann auch ich über
mein Leben nicht aussagen. Und mein Baby-Lachen ist verschollen. Meine Mutter kann es noch hören. Aber wusste sie damals, worüber, wodurch ich wirklich lache?
27. Mai 2020
Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden
Von Lori Gottlieb
Aus dem amerikanischen Englisch
von Elisabeth Liebl
Erschienen 2019 unter dem Originaltitel:
Maybe you should talk to someone
Das Cover im Original zeigt eine angebrochene Box mit Papiertaschenbücher und verweist damit auf ein Therapieereignis der Autorin bei ihrem Therapeuten Wendell
Was Sie hier lesen, ist keine Therapie, sondern eine Geschichte über Therapie: darüber,
wie wir heilen können und wohin uns das führt, schreibt die Psychotherapeutin und Journalistin Lori
Gottlieb im ersten Kapitel ihres ungewöhnlichen Buches, das nicht leicht einzuordnen ist. Die Erzählerin ist zugleich die Autorin, was im Normalfall für eine Autobiografie spricht. Doch die vielen
Fallgeschichten und theoretischen (aber immer verständlichen) Reflexionen machen es auch zu einer Art praxisnahen Lehrbuch über Psychotherapie. In den letzten 20 Jahren hat sich in Deutschland die
Verschreibung von Antidepressiva versiebenfacht. Sicher gibt es auch Menschen, deren psychische Erkrankung so schwer ist, dass man sie ohne Medikamente gar nicht therapieren könnte. Dennoch: 25
Millionen Packungen Antidepressiva gingen 2017 über die Ladentische deutscher Apotheken. In den USA – schreibt Gottlieb im Kapitel 36 – brauchen 26 Prozent der Amerikaner Psychopharmaka. Das Kapitel
in dem sie diesen Fakt erwähnt trägt den Titel „Bedürfnisgeschwindigkeit“. In alldem lag eine unausgesprochene Ironie. Die Leute wollten eine schnelle Lösung ihrer Probleme, die vielleicht
überhaupt erst im Gefolge ihres hektischen Lebensstils entstanden. Pillen sind da eine schnelle Lösung für uns Konsumenten. Und als ich diese Zeilen las, demonstrierten in München Tausende für
eine schnelle Lockerung der Corona-Regeln. Ein paar Wochen Ruhe halten die Menschen nicht mehr aus. Das schnelle Leben und seine Hektik scheinen wie der Rausch einen Suchtfaktor zu haben.
Fünfundvierzig Minuten in der Woche auf einer Couch liegen oder sitzen und über sich selbst reflektieren? Zu viel?
Die kluge Autorin ist in den USA deutlich bekannter, schreibt schon lange für The Atlantic oder dem New York Times Magazin über Gesundheitsthemen und hat ihre eigene Show im
Fernsehen, in der sie über aktuelle Gesundheitsthemen spricht. Und natürlich fehlte ihre Stimme auch nicht in Zeiten von Corona (nachzulesen im Spiegel in einem Interview vom 10. Mai 20 und
am 06. Mai in Welt+).
Gottliebs Geschichten von John, dem erfolgreichen Drehbuchautor der alle für Idioten hält und der dann nicht zusammenbricht, sondern aufbricht, als er vom Tod seines Sohnes erzählt, von Rita
deren Leben so schief gelaufen ist, dass sie es für hoffnungslos hält oder Charlotte und ihrem Suchtproblem oder die besonders tragische Geschichte von Julie und ihrer schweren Krebserkrankung, all
diese Geschichten wirken so echt und authentisch, weil Lori Gottlieb auch über sich ehrlich bleibt. Ob sie von ihrem Kinderwunsch erzählt und der Besamung oder von ihrem wandernden Uterus, das wirkt
nie lächerlich. Der Humor ist immer dabei und auch wenn es zuweilen echt rührselig wird (als sie mit Julie gemeinsam „scheiße, scheiße, scheiße“ brüllt), immer zeigt Gottlieb, dass Professionalität
nicht den Verlust von Menschlichkeit bedeutet, sondern im Gegenteil. Die berühmte Augenhöhe, die symmetrische Kommunikation kann natürlich die Komplementarität des Patient-Therapeut-Verhältnisses
nicht verschleiern, soll es auch nicht. Gottlieb erzählt in ihrem vielschichtigen Buch, dass eine gelungene Kommunikation nicht perfekt sein muss, sondern Präsenz und Bereitschaft signalisieren
sollte. Es ist schwer anderen Menschen zuzuhören, ohne sie gleich interpretieren zu wollen, da ja Sprache schon Interpretation ist und 80 Prozent unserer Sprache non- oder paraverbal. Aber wie
Gottlieb ihre Supervisorin einmal sagen lässt: wir haben zwei Ohren und einen Mund. Das hat einen Grund.
Ein Plädoyer dafür, sich die Zeit zu nehmen über Jahre mit einem ausgebildeten Therapeuten über sich selbst zu sprechen, setzt mehr voraus, als nur einen Begriff von Therapie zu haben. Unter dem
allumfassenden psychologischen Wort "Therapie" dem griechischen Wort für "Dienst, Pflege" (sprachlich urverwandt zu "tarnen, zudecken") subsumiert sich inzwischen ein Heilsanspruch gegenüber jedweder
gesellschaftlichen Abweichung. Die sozialpolitische und ökonomische Dimension einer Gesellschaft auf der Couch ist wohl nicht auf der Couch zu überblicken. Jeder siebte Suizidversuch geht
inzwischen auf Konflikte am Arbeitsplatz zurück, also 4 Millionen von insgesamt 30 Millionen Versuchen im Jahr.
Ich hatte zehn Jahre als Krankenpfleger in der Psychiatrie gearbeitet und erlebte dort von vielen Psychiatern eine spöttische Haltung gegenüber der Psychodynamik. Die Psychiater die es anders
bewerteten, hielten in der Uni-Klinik nicht lange durch. So wie auch Gottlieb schreibt, ist für einen Patienten gerade so viel Zeit um Blut abzunehmen und den Medikamentenspiegel zu bestimmen.
Neurotransmitter und eine grobe Nosologie erfassen die menschliche Dimension nicht im Geringsten. Das macht Gottliebs Buch so wertvoll. Denn sie beschreibt was sie sieht und empfindet. Nie hat man
das Gefühl einer theoretischen Lehrstunde beizuwohnen, immer ist man als Leser dabei und erlebt die therapeutische Reise als Abenteuer. Nach meiner Kündigung in der Nussbaumstraße (königlich
bayrische Psychiatrie) machte ich eine fast drei Jahre dauernde Psychoanalyse. Danach hatte ich nicht weniger Probleme oder war schlagartig ein glücklicher und verantwortungsbewusster Zeitgenosse.
Ich war nicht geheilt. Etwas anderes war aber geschehen. Irgendwann erfasste ich, dass ich das selbst tun muss. Das bedeutet aber nicht, dass das nicht wieder einmal einer Auffrischung bedürfte. Dazu
müsste ich aber entsprechende Symptome vorweisen, um die Notwendigkeit einer ärztlichen Verordnung zu erfüllen. Dafür bin ich zu gesund. Es selbst zu bezahlen, kann ich mir nicht leisten.
Ich könnte mir daher vorstellen, dass es mit einer Therapie so laufen könnte, wie mit einer Darmkrebsvorsorge. Immer wieder mal wird man zur Vorsorge zum Therapeuten geschickt. Schließlich muss man
John ja recht geben: Die Welt ist voller Idioten. Hinzugefügt: Die dringend therapiert gehören. Wenn man jedoch all die Pandemie-Pegida-Demonstranten zum Therapeuten schicken würde, hätten wir
wiederum das Problem, die Therapie zur Ideologie zu machen. Daher hatte ich während der spannenden Lektüre dieses Buches immer wieder darüber nachgedacht, wie das zu lösen wäre. Dass so viele
Menschen dringend eine Therapie bräuchten, bedeutet nicht, dass man sie dazu zwingen sollte. Aber mehr Möglichkeiten, mehr Angebote wären sinnvoll. Denn die Anzahl der Therapeuten mit Kassenzulassung
in Deutschland deckt nicht im Ansatz den Bedarf ab, der ohnehin schon existiert. Und weit, sehr weit davon entfernt den Bedarf der eigentlich existieren sollte. Transfette sind eine schlechte
Nahrung, Pillen eine schlechte Lösung.
Jedenfalls war an Gottlieb besonders sympathisch, dass sie nicht ideologisch wirkte, auch wenn sie keinen Hehl daraus macht, wie sehr sie für ihren Beruf brennt. Da Gottlieb immer wieder mit viel
Herz und ohne die geringste Überheblichkeit auf ihre Klienten zuging, traue ich mir zu behaupten, dass sie wirklich eine gute Therapeutin ist.
Der Fernsehsender ABC plant bereits eine Verfilmung (als Fernsehserie) und man kann sich
darauf freuen. Es ist dieses Stück Amerika, das ich liebe, jenseits der Rassisten und wirklich Irren (die leider nie zum Therapeuten gehen, sondern meist direkt über Los ins Gefängnis oder ins
Grab).
So ist meine Hoffnung, demnächst auf Netflix Gottliebs Couch noch näher kennenzulernen…
16. April 20
Bartleby, der Schreiber
Von Herman Melville
Erstmals erschienen 1853 in der Zeitschrift Putnam’s Monthly Magazine
I would prefer rather not to lautet die passive Widerstandsformel des berühmtesten Kanzleischreibers der Welt. Hermann Melville, sein Erfinder, lebte in den 1850er
Jahren auf einem Bauernhof bei Pittsfield im äußeren Westen von Massachusetts. Weit entfernt von der New Yorker Wallstreet also, wo sich die kleine Geschichte des blassen und merkwürdigen
Kanzleischreibers Bartleby abspielte.
Der namenlose Ich-Erzähler ist Anwalt einer Kanzlei und er beschreibt sich selbst folgendermaßen: Mag ich also einem Beruf angehören, dem landläufig ein zupackendes, hastiges, ja zuzeiten
aufgeregtes Wesen nachgesagt wird, so habe ich doch nie geduldet, dass dergleichen Regungen meinen Frieden störten. Er sei ein Anwalt ohne Ehrgeiz, sieht sich als vorsichtigen Menschen.
Der Icherzähler vereinigt damit einen Widerspruch ethischer Systeme. Hier Nietzsche, da Tolstoi. Der vornehme Mensch, so sagt es Nietzsche, „müsse seine Vorrechte und deren Ausübung unter seine
Pflichten rechnen.“ Tolstoi dagegen will dem Übel nicht widerstreben und Unrecht wehrlos dulden. Tolstoi verdammte die Juristen als „Leute die glauben, es gebe Umstände im Leben, unter denen ein
unmittelbares Verhältnis des Menschen zum Mitmenschen nicht notwendig sei.“
Genau diese Geschichte eines Widerspruchs erzählt uns Hermann Melville. Daher sind die letzten Worte „Ja, Bartleby! Ja, Menschheit!“ als ein Sieg des christlichen Gewissens zu betrachten. Ich möchte dazu den Rechtsphilosophen Gustav Radbruch zitieren.
Das Gewissen spricht: „So dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem
biete den andern auch dar, und so jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel.“
Aber das Rechtsgefühl erwidert: „Lasst euer Recht nicht ungeahndet von anderen mit Füßen treten. Wer sich zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, wenn er mit Füßen getreten wird.“ (Kant)
„Ich aber sage euch“, so hebt das Gewissen von neuem an, „dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel!“
Das Rechtsgefühl aber beharrt: „Lieber ein Hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll, als ein Mensch!“ (Kleist)
Und wiederum das Gewissen: „Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen.“
Und dagegen das Rechtsgefühl: „Der Kampf ums Recht ist ein Gebot der moralischen Selbsterhaltung.“(Jhering)
„Selig sind die Friedfertigen,“ sagt das Gewissen.
Aber das Rechtsgefühl: „Wer das Recht auf seiner Seite fühlt, muss derb auftreten; ein höfliches Recht will gar nichts heißen.“ (Goethe)
Der Riss, den das Christentum durch die sittliche Welt und das sittliche Leben des Einzelnen
verursachte ist seitdem das Problem, das auch Kants „robustes Gewissen“ nicht mehr vollständig kitten konnte. In gewisser Weise leidet Bartleby unter dem, was man Rentenneurose oder auch
Begehrungsneurose bezeichnet. Dabei handelt es sich um einen durch nicht verarbeitete Erlebnisse oder Konflikte verursachten Leidenszustand, der davon Geschädigte flüchtet sich in die Vorstellung er
hätte einen Anspruch auf Sicherstellung seiner Existenz. „Ich möchte lieber nicht“, ist in diesem Sinn eine Verweigerung des Rechts.
Die meisten Rezensenten achten auf Bartleby. Aber der Autor selbst lässt seinen Icherzähler ja schon am Anfang des Textes klarstellen: Bevor ich unseren Schreiber aber einführe, so wie er mir
zuerst vor Augen trat, empfiehlt es sich wohl, dass ich erst kurz von mir selber spreche, meinen Angestellten, meinem Büro und allem Drum und Dran – denn eine gewisse Aufklärung darüber ist
unentbehrlich für ein richtiges Verständnis der nachher vorzustellenden Hauptperson. Wir lesen den Text daher am sichersten, wenn wir ihn als Schilderung eines Konflikts zwischen zwei ethischen
Systemen betrachten. Dem Bedürfnis sein Recht zu bekommen und dem Bedürfnis, sich menschlich zu zeigen.
Die komplette Lebensverweigerung die Bartleby am Ende im Gefängnis zeigt, wo er sogar das Essen einstellt (Ich möchte lieber nicht essen), verweist doch eindeutig auf die Pathologie des
Melancholikers. Das ehrenhafte Mitgefühl des Erzählers scheitert immer wieder. Er möchte seinem Schreiber mit allen Mitteln helfen. Doch Bartleby möchte sich gar nicht helfen lassen. Er empfindet
seine Verweigerungshaltung als sein Recht. Es kommt bei psychisch Erkrankten oft vor, dass sich die Betroffenen nicht helfen lassen wollen, obwohl sie offenkundig leiden. Der Mangel an
Krankheitseinsicht hat nichts mit dem Leidensdruck zu tun. So mancher Melancholiker empfindet es als sein Recht, melancholisch zu sein. Natürlich ist der Auslöser für Bartlebys Erkrankung seine
Tätigkeit im Dead Letter Office, einer Sammelstelle für nicht zustellbare Briefe. Der Erzähler erfährt von diesem Gerücht und erklärt sich so das Verhalten seines merkwürdigen Schreibers.
Dieses Wissen verstärkt nur sein Mitgefühl, denn Bartleby ist als empfindsame Seele verwandt mit dem Teil des Erzählers, der den Frieden mehr schätzt als die Durchsetzung seiner Macht. Statt
machtvoll sein Recht durchzusetzen, lässt sich der Erzähler sogar aus seiner eigenen Kanzlei vertreiben. Während Bartleby die zur Neurose erstarrte Verweigerung verkörpert, ringt der Erzähler um
seine Haltung. Immer wieder gerät er in Versuchung, seinen unwilligen Schreiber anzubrüllen oder ihn vor die Tür zu setzen. Verzweifelt lockt er ihn, will ihn in Versuchung bringen, bietet ihm Schutz
und Sicherheit und jegliche Hilfe an, nur um abgewiesen zu werden. Immer wieder wird dadurch der Erzähler herausgefordert und um seinen geliebten Frieden gebracht. Der Berechtigungswahn des einen,
ist der Versündigungswahn des anderen. Der Erzähler ringt um seine Menschlichkeit und kann sie bis zum Ende verteidigen. Auch oder gerade weil er in seinem Versuch menschlich zu sein scheitert,
scheitert seine Menschlichkeit nicht. In dieser Dialektik muss man die Geschichte verstehen lernen. Es gibt Menschen, denen kann man nicht helfen. Gerade ihnen gegenüber muss man seine Menschlichkeit
bewahren.
All die Obdachlosen, all die Menschen die mit dem Leben gar nicht zu Recht kommen und nicht einmal in der Lage sind Hilfe anzunehmen, diesen Menschen immer wieder beizustehen ist die große
Herausforderung. Die Absurdität des Leidens, das nicht besiegt werden kann dennoch stets zu bekämpfen. Das ist die Menschlichkeit, die Hermann Melville eigentlich meint.
14. April 2020
Agatha Christie
– eine Biografie
Von Barbara Sichtermann
Erschienen im Osburg-Verlag 2020
In der aberwitzigen, aber auch brillanten Folge 209 (S4E7 / The Unicorn and the wesp)
der britischen Erfolgsserie Doctor Who taucht Agatha Christie am Tag ihres Verschwindens zu einer Dinnerparty von Lady Eddison auf, wo sich auch der zehnte Doctor befindet. Gemeinsam lösen
sie in Poirot-Manier einen bizarren Fall um einen außerirdischen Formwandler, der die echte Welt mit der Welt aus einem Agatha-Christie-Krimi verwechselt. Auf der Flucht vor einer mutierten
Riesenwespe verliert Agatha Christie ihr Bewusstsein und erleidet eine Amnesie. Der Doctor liefert sie 10 Tage nach ihrem Verschwinden im Harrogate-Hotel unbeschädigt ab. Die Folge glänzt dabei
natürlich mit vielen postmodernen Zitaten aus dem Werk von Agatha Christie.
Es ist naheliegend eine Biografie der berühmten Krimiautorin mit diesem Medienereignis im Dezember 1926 zu beginnen. Spannender ist dennoch die Folge von Doctor Who. Auch wenn sich die
Biografie von Barbara Sichtermann ganz flüssig liest und zuweilen auch unterhaltsam ist, so ist diese Biografie bestenfalls durchschnittlich. Mit Bernard Cricks Biografie über Georg Orwell, Heinrich
Manns Biografie über Churchill oder Richard Friedenthals Biografie über Goethe (von der Safranski seine Goethebiografie zu 75 Prozent abgeschrieben hat) ist sie nicht zu vergleichen. Aber ich
schätze, mit diesen Beispielen will sich die Autorin Barbara Sichtermann gar nicht messen. Der Philologe Friedrich Leo (1851-1914) sprach von zwei Formen der Biografie. Die erste ist literarisch
wenig anspruchsvoll und für Personen des Geisteslebens gedacht, die zweite, deutlich qualitätsvollere Form, für Politiker, Könige und Feldherren. Das ist dann doch eine ziemlich schlichte Einteilung.
Noch schlichter sah es der Althistoriker Arnaldo Momigliano (1908-1987). Er sah in einer Biografie nichts weiter als die Darstellung des Lebens eines Menschen von der Geburt bis zum Tod. Das nun
liefert die Alt-68erin Barbara Sichtermann, die sich in ihrem Leben im Wesentlichen mit der Frauenemanzipation beschäftigte. Und da finden wir auch die stärksten Stellen in der Biografie. Das
widersprüchliche Verhältnis einer erfolgreichen Autorin zu ihrer gesellschaftlichen Rolle als englische Dame. Diesen Riss oder Bruch in Christies Leben hat Sichtermann stark herausgearbeitet. Leider
gelingt ihr die sprachliche Umsetzung nicht immer. Besonders die häufigen nachgestellten Dialoge hatten einen entscheidenden Nachteil. In fiktionalen Texten dient der Dialog nicht dazu, inhaltliche
Informationen zu vermitteln, sondern zur Darstellung der Charaktere der Figuren und ihrer Beziehung zueinander. Doch Sichtermann nutzt in ihrer Biografie den Dialog immer wieder zur Vermittlung
inhaltlicher Informationen. Das ist für eine Biografie auch legitim. Das machte schon Satyros von Kallatis 300 Jahre vor Christus in seiner Euripides-Biografie. Doch ein Fehler unterlief
Satyros dabei nicht. Der sonderbare Fehler, der die Dialoge von Sichtermann komisch unglaubhaft macht: in kursiver Schrift zitiert sie immer wieder aus deren Autobiografie Christie selbst. Die
Dialoge sind aber erfunden. Dennoch in Ich-Form. Gibt es also zwei Agatha Christie? Oder ist nicht jedem sofort klar, dass die Dialoge erfunden sind? Und wozu dienen sie dann? Was sollen sie
bezwecken? Außer Gaukelwerk haben sie keine Bedeutung, denn jeder Leser durchschaut diesen Effekt. Es ist als würde ich einem Erwachsenen vom Weihnachtsmann erzählen in der Hoffnung ihn zum Staunen
zu bringen. Der Effekt verliert so an Wirkung. Er hat dennoch seine Berechtigung. Denn Sichtermann schrieb keine wissenschaftliche Biografie (wie Crick oder Friedenthal). Es gibt keine
Fußnoten, kein Quellenverzeichnis, lediglich eine sehr oberflächliche Auswahlbibliografie. Woher bezieht Sichtermann ihre Erkenntnisse über das Gefühlsleben von Agatha Christie und das Wissen um die
Fremdanamnese?
Agatha Christie kommt sogar in einer aktuellen Folge der Zeitreise-Serie Timeless kurz einmal vor (bei der Entführung eines Zeppelins). So kann man tatsächlich von einer Renaissance der
Queen of Crimes sprechen, wie Stefan Ahrens Anfang Februar in der Tagespost schrieb unter: https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/kultur/Agatha-Christie-Eine-milde-Form-der-Sozialkritik;art4881,205191
.
Nimmt man Sichtermanns Biografie nicht nur als Auftragsarbeit für das leichte Lesepublikum und ignoriert man die sprachlichen Schwächen, dann gibt es eine Passage in dem Buch, das wirklich ein großes Resümee zieht. Hier zitiert Sichtermann die Meisterin selbst: Es gilt, die Unschuldigen zu schützen, sie müssen in Frieden mit ihren Nachbarn leben können. Das ist eine Sicht auf das Recht die eines Gustav Radbruch würdig ist. Heribert Prantl nennt das „die Sicherheit im Recht“, und zitiert damit den großen Rechtsphilosophen Radbruch. Der Charme eines Kriminalromans ist damit immer verknüpft mit der Eleganz der Lösung. Selbstjustiz – wie in dem Roman Mord im Orient-Express – kann daher nie wirklich eine Lösung sein. Selbstjustiz ist Überrecht. Eine Art der Ultima Ratio und damit ein Hinweis auf versagendes Recht. Denn genau so geschah es im Roman. Die Polizei folgte der falschen Fährte und ließ den Täter entkommen. Barbara Sichtermann hat sicher keine Biografie geschrieben, die bleibenden Eindruck hinterlassen wird. Aber eines hat sie doch geschafft: Lust darauf Agatha Christie wieder zu lesen. Und das ist nicht das schlechteste Ergebnis einer Biografie. Wer weiß? Eine wissenschaftlich fundierte und perfekt recherchierte Biografie die selbst Anspruch auf Kunst erhebt, hätte womöglich sogar den gegenteiligen Effekt gehabt. So ging es mir zuweilen auch bei Safranski in seiner starken Goethe-Biografie (Freudenthal war noch besser). Wenn man Goethe wieder lesen wollte nach so langer Zeit, braucht es mehr als Goethe, nein, anders: weniger Goethe. Sichtermann hat immerhin die Frau hinter der Ikone der Literatur (Milliarden verkaufter Bücher!) sichtbar werden lassen, eine Frau die ein Kind hat, einen, zwei Ehemänner und persönliche Ansichten die sie zu einem Kind ihrer Zeit machen. Was ihr den Geist der Zeiten nennt, das ist der Herren eigener Geist in dem die Zeiten sich bespiegeln. Und trotz aller Patina einer Miss Marple oder eines Poirot, sie wurden zu Ikonen und haben sich in vielfacher Weise in der modernen Kriminalliteratur verbreitet.
Der entscheidende Unterschied zum großen Gegenpol, zu Sherlock Holmes von Sir Arthur Conan
Doyle ist die Methode der Induktion. Holmes deduziert in der Regel. Intuition ist für Holmes nur eine Folge von Eindrücken, die das Bewusstsein nicht schnell genug verarbeiten konnte. Doch Christies
Helden sind keine hochfunktionalen Soziopathen wie Holmes, sondern Menschen wie du und ich. Es wäre mal eine lohnende Doktorarbeit, die Unterschiede zwischen Holmes/Watson und Poirot/Hastings
herauszuarbeiten. Vermutlich gibt es das schon, nur weiß ich halt nichts davon.
Man könnte so weit gehen Induktion und Deduktion als Yin und Yang der Ermittlung zu sehen. Doch so einfach ist es nicht. Denn Christies Helden beobachten Menschen (gehen damit induktiv vor). Doyles
Held beobachtet Fakten (durchaus auch induktiv) und schließt aus ihnen. Doch für Fakten braucht es eben eine Grundtheorie. Holmes sieht immer den Zusammenhang, er sieht das Überrecht. Doyles Held
Holmes ist näher an der Selbstjustiz. Das wird auch öfter in den Romanen von Doyle thematisiert.
Abschließend war die Biografie unterhaltsam aber die poetischen Fähigkeiten der Autorin überschaubar. Die Quellenangaben für ein Sachbuch waren unterirdisch. Hier wäre mehr Sorgfalt eine Wertschätzung des Lesers gewesen.
"Die Freiheit besteht in erster Linie nicht aus Privilegien, sondern aus Pflichten."
Besprechung von 2010
Inzwischen habe ich die Pest vier mal gelesen. Das erste mal mit 19 Jahren. Jetzt (jetzt war von zehnJahren), ein viertel Jahrhundert später ist dieser Roman für mich immer noch eine Art Leitbild. Solidarität, Freundschaft und Liebe mögen die Sinnlosigkeit und Absurdität der Welt nicht aufheben, aber die Beachtung dieser Werte schafft eine mögliche Welt. Keine Utopie, kein Weltprojekt das in die Paradoxie der Selbstbezüglichkeit gerät durch die Proklamation von Idealen, die selbst nur Teil der vom Ideal aus gesehen verneinten Wirklichkeit sein können.
Das Wort „revolte“ übersetzt sich bei Albert Camus nicht mit unserem Revolution, Aufstand, sondern mit „zum unabwendbaren ja sagen“. Revolte ist von Solidarität nicht zu trennen, weil man Respekt vor dem Anderen hat, auch vor dem Verurteilten.
Solidarität, Freundschaft und Liebe sind keine abstrakten Ideen. Sie sind Teil einer wirklichen Welt und widersprechen der dialektischen Forderung Hegels nicht: „Was wirklich ist, ist vernünftig und was vernünftig ist, ist wirklich“.
Dieses „Ja“, diese grundlegende Affirmation zerstört die Wirklichkeit nicht, sie erhebt sie. Und sie ist eben kein bloßer Opportunismus: Schon von der Müdigkeit geplagt sagt Rieux, der Arzt der die Pest bekämpft in Camus’ Roman: „...bei allem handelt es sich nicht um Heldenmut. Es handelt sich um Anstand. Das ist eine Idee, über die man lachen kann, aber die einzige Art, gegen die Pest anzukämpfen, ist der Anstand.“
Was Rieux über die Pest sagt, das lässt sich auch über das Dasein sagen. Die Pest ist so absurd wie das Dasein. Man ist verurteilt. Die Pest schafft in Camus’ Roman nur eine Offenbarung. Allen Handelnden wird die Absurdität bewusst und sie ringen sich zu einem Anstand durch. Rambert flüchtet nicht, weil er sich seiner Geliebten gegenüber schämen würde und er es nicht zustande bringt, „allein glücklich zu sein“.
In der Szene, als Rieux das neue Serum an Othons Kind ausprobiert, und alle dem langsamen Sterben des Kindes zuschauen, dem vernichtenden Todesschrei des Kindes lauschen, und der anschließenden Auseinandersetzung zwischen Paneloux und Rieux, zeigt sich, dass die Pest sogar die Grenzen zwischen Glaube und Unglaube verwischt. Es spielt keine Rolle mehr, ob man an Gott glaubt oder nicht. Der Schmerz und der gemeinsame Kampf gegen diesen Schmerz wird zur großen Ökumene.
„Sehen Sie“, sagte er und vermied es, ihn anzusehen, „jetzt kann Gott selbst uns nicht trennen.“ (Seite 149 oben)
Gott selbst kann sie nicht trennen, weil das „Mitgefühl“ Teil der Wirklichkeit ist, weil die Solidarität mit dem Opfer eine logische Folge des Willens ist, die Welt wie sie ist zu sehen, und aus dieser wirklichen Welt heraus zu handeln.
Damit ist Camus weniger ein Existenzialist, als vielmehr ein Marxist. Der Arzt Rieux interpretiert die Welt nicht, er verändert sie. Denn seinem Beispiel folgen die anderen nach und nach. Vielleicht ist Albert Camus ein Marxist, der Nietzsche impliziert. Nicht die Herrschaft der Vernunft, sondern die Herrschaft des Willens dokumentiert das Handeln der Figuren in dem Roman. Was wirklich ist will ich, und was ich will ist wirklich. Etwas zu wollen, ist immer positiv und eine Freiheit zu etwas. Daher ist die Philosophie des Absurden keine passive Leidensphilosophie. Camus fordert einen hohen ethischen Massstab.
aHa
Nach dem Schweigen richtete sich der Arzt etwas auf und fragte, ob Tarrou eine Vorstellung von dem Weg habe, den man einschlagen müsse, um zum Frieden zu kommen.
„Ja, Mitgefühl.“
Obwohl das Schicksal über die ganze Stadt hereinbricht, sind die Figuren in dem Roman freier als man glaubt. Angenommen, alle Menschen in der Stadt wüssten, die Pest ist von Gott geschickt, und es wäre so, wie Paneloux es sagt, dass es sich um eine Bestrafung für ihre Sünden handelt. Welchen Sinn würde es nun machen, als Arzt die Kranken und Elenden zu behandeln? Welchen Sinn würde es machen, die Versorgung der Stadt zu planen, die Toten zu beerdigen? Selbst das Verschließen der Stadtmauern hätte keinen Sinn mehr. Der Strafe Gottes entgeht man nicht. Es bliebe noch die Selbstgeißelung, um Gottes Willen auszudrücken und in der Selbstbestrafung Gott zu besänftigen. Dieses Theodizee Problem ist das Kernproblem der Philosophie von Albert Camus. Nur der Atheismus ermöglicht dem Menschen damit ein Stück Freiheit. Freiheit ist hier also kein Luxusbegriff mehr, sondern ein Akt des Willens. Man müsste „Also sprach Zarathustra“ und „der Mythos von Sisyphos“ möglicherweise nebeneinander lesen.
„Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-Sagen. Ja, zum Spiele des Schaffens, meine Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-sagens: seinen Willen will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene.“
Die Verwandlung vom Kamel zum Löwen und letztendlich zum Kind, dieser Dreischritt Nietzsches bedeuten am Ende: Liebe zum Leben und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Camus fügt dem das „Mitgefühl“ hinzu.
„Unter den schwierigen Bedingungen, die die Stadt mitmachte, hatte sogar das Wort ‚Neuheit’ seinen Sinn verloren.
„Unschuld ist das Kind und ein Neubeginnen“ (aus Also sprach Zarathustra), heißt es noch bei Nietzsche. Nietzsche spricht noch vom „heiligen Ja-Sagen“, Camus aber: „...und er dachte wie er, dass diese Welt ohne Liebe eine tote Welt war und dass immer eine Stunde kommt, in der man die Gefängnisse, die Arbeit und den Mut leid ist und nach dem Gesichte eines Menschen und dem von Zärtlichkeit verzauberten Herzen verlangt.“ (Seite 297)
19. Februar 2020
Imperium
von Christian Kracht
erschienen 2012 im Verlag Kiepenheuer & Witsch
In dem schillernden Roman aus der deutschen Kolonial-Zeit der ersten Jahre des 20.
Jahrhunderts collagierte Christian Kracht in Pynchon-Manier zahlreiche Zeitgenossen hinein. So begegnet uns ein Simplicissimus-Redakteur der den Hauptprotagonisten August Engelhardt anzeigt und
dahinter verbirgt sich kein geringerer als Ludwig Thoma und dessen von ihm gelangweilter Frau Marion (Tänzerin). Der jüdische Junge den Aueken auf Helgoland unsittlich berührt ist kein geringerer als
Franz Kafka, der 1901 mit seinem Onkel Löwy im zarten Alter von 18 Jahren die Nordeney und Helgoland besuchte. Der Kapitän Slütter und seine geheimnisvolle Pandora sind einem Comic von dem Italiener
Hugo Pratt (Südseeballade/ Corto Maltese) entliehen, das Lied von den fünf jungen Mädchen kolportiert ein Lied von fünf Schwänen von dem pommerschen Pädagogen Karl Plenzat, der sich später den Nazis
anschloss. Die deutschen Pflanzer erinnern an Bilder von Otto Dix. Es ist ein literarischer Spaß in dem zahlreiche durchaus liebevolle Spinner auftauchen, wie zum Beispiel der sächsische
Schreibreformer Gustav Nagel, der einen Teil seines Lebens in einer Erdhöhle lebte und am Ende in einem Irrenhaus starb. Zwischendrin hatte Nagel noch eine Partei gegründet
(deutsch-kristliche-folkspartei) die 1928 auf 0.00 % Stimmen kam.
Der Spiegel-Journalist Georg Diez warf dem Autor nach Erscheinen des Buches eine faschistische Gesinnung vor. Diez hatte sich in seinem Artikel gar nicht zu dem Corpus Delicti, dem Roman
Imperium, geäußert, vielmehr mokierte er sich über einen zweifelhaften Briefwechsel zwischen Christian Kracht und dem Komponisten David Woodard. Die Beschäftigung mit Nueva
Germanica (einem Dorf in Paraguay, u.a. von Nietzsches Schwester mitbegründet) und der im Dschungel gescheiterten Eugenik, über totale Kunst waren Inhalte des Briefwechsels. Halbfertige Ideen,
fiktives, Spinnereien tauschten die beiden in dem Briefwechsel aus. Doch der Roman von Christian Kracht ist alles andere als faschistisch. Diez war offensichtlich unfähig die feine Ironie des
Mann’schen Erzählstils von Kracht zu lesen. Vielmehr war es so, dass Georg Diez mit Christian Kracht einmal in der gleichen Clique abgehangen hatte und noch eine offene Rechnung existierte. Doch als
ob solche Vorwürfe nicht schon reichten, meldete sich der Schriftsteller Marc Buhl, der ein Jahr zuvor ebenfalls einen Roman über August Engelhardt geschrieben hatte (Das Paradies des August
Engelhardt, Eichborn-Verlag) mit Plagiatsvorwürfen zu Wort. Der Literaturklub Sindelfingen widerlegte diese Vorwürfe eindrucksvoll.
In den 1980ern entdeckte der Briefmarkensammler Dieter Klein die schon ganz vergessene Figur des August Engelhardt und schrieb einen Beitrag für ein historisches Sammelwerk zur deutschen
Kolonialgeschichte. 2009 erschien eine Handbiografie zu Deutsch-Neuguinea in der Engelhardt ausführlich erwähnt wurde, 2010 erschien in der Zeitschrift Mare ein ausführlicher Artikel über die
Fruchtesser. Und auf Papua-Neuguinea starb zuletzt ein Deutscher 2012 an Unterernährung, weil er sich (Anorexia mirabilis) versuchte ausschließlich von Licht zu ernähren. Das Thema lag in der
Luft.
August Engelhardt kam 1875 in Nürnberg zur Welt und starb 1919 auf Kabakon im heutigen Papua Neuguinea. Engelhardt gründete dort den Sonnenorden. Man solle die Erlösung und die Unsterblichkeit
erreichen, wenn man sich ausschließlich von Kokosnüssen ernährt. Es gab dort zur deutschen Kolonialzeit Kokosplantagen. „Die Pflanzer … sahen ein zitterndes, kaum fünfundzwanzig Jahre altes
Nervenbündel mit den melancholischen Augen eines Salamanders…“
Dünn, schmächtig, langhaarig („mit langem Bart, dessen Ende unruhig über den kragenlosen Kittel strich“) ist dieser Engelhard, und der Erzähler fragt sich stellvertretend für die Pflanzer, was
es wohl mit diesem Manne auf sich hat. Dieser August Engelhardt, zart und wohl eher lebensuntauglich (was immer das bedeutet) flieht die moderne Welt.
Spätestens seit der schlimmen Katastrophe in Fukushima, ist die allgemeine Vorstellung, der Mensch zerstöre die Umwelt durch sein Handeln zum Allgemeingut geworden. Und es macht daher Sinn, einen
Roman zu schreiben, ein Portrait über einen frühen Anhänger der Lebensreformbewegungen (wir haben immer noch Reformhäuser), einen Roman zu schreiben über einen Antimodernen und dabei aufzuzeigen, wie
diese Technikfeindlichkeit und Modernitätsfeindlichkeit am Ende auch lebensfeindliche Motive transportiert. Kracht hat sich gut in den historischen Stoff eingearbeitet und wenn er von Albert Hahl
erzählt, dem Gouverneur von Deutsch-Neuguinea, dann erzählt er auch von dem Mitglied des so genannten Solf-Kreises, einer konservativen Elite die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt
war und dem Albert Hahl angehörte. Und die großen Deutschen kommen so oder so nicht gut weg. Sie werden als „bläßliche, borstige, vulgäre, ihrer Erscheinung nach an Erdferkel erinnernde Deutsche“
beschrieben. Oder kommt in der Schilderung von Richard Ungewitter, dem Begründer der deutschen FKK Bewegung, wirklich Bewunderung für den Mann auf, der die „Loge des aufsteigenden Lebens“
gründete und im Jahr 1923 eine Satzungsänderung für das Bekenntnis zur „Rassenhygiene“ einführte?
Nein. Die Beschäftigung mit dem Thema macht den Autor nicht automatisch zum Sympathisanten des Themas selbst. Dass Kracht seinen Protagonisten irgendwie mag, verhindert nicht, dass dieser durch die
Hölle marschieren muss. Zum Ende läuft alles aus dem Ruder und der Kokovore, Kokosnuss-Esser Engelhardt wird nicht nur zum Mörder, sondern sogar zum Autophagen, zum Selbstesser. Hier könnte man
vielleicht mit Roman Bücheli (NZZ) nach dem „ästhetischen und intellektuellen Mehrwert“ dieser „Spielerei“ fragen. Kracht erzählt „die deutsche Geschichte hinter den Aussteigern, die sie gemacht
haben, indem sie ihr entkommen sind, als der böse Schicksalszug einen Augenblick angehalten hat", beantwortet Elfriede Jelinek diese Frage.
Aber in der 2013 aufgeregt geführten Debatte über diesen Roman steckt immer noch diese German
Angst. Verkrampft und hysterisch begegnen wir der eigenen Geschichte. Dafür haben wir Gründe. Aber Kracht ist Schweizer und Sohn eines Springer-Imperators. Ein Millionärs-Kind will vor allem seinen
Spaß. Und ein Roman muss nicht immer einen Mehrwert haben (für den Verleger natürlich schon). Christian Kracht, Schweizer Schriftsteller, der einmal sagte Nick Hornby sehe aus wie ein Penis.
Christian Kracht, der einmal von dem BZ-Redakteur Franz Wagner gewürgt wurde, weil Wagner wollte, dass Christian Kracht für die BZ schreiben sollte, und Kracht meinte, er könne nicht auf Klopapier
schreiben. Er wurde vor allem durch Faserland bekannt, eine Art Roman, die durch Drogen- und Sexpartys führt und die Kracht den Ruf des Popliteraten einbrachte. Dann kam 1979 eine
Art Reisebericht, der den Protagonisten in ein vietnamesisches Gefangenenlager führt, wo er auch nicht mehr rauskommt. Schon war man mit dem Popliteraten wieder durch. Und die Presse rief: Ende der
Popliteratur. Der Roman Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten offenbart dann eine Dystopie in der Schweiz und Russland vereinigt sind, und ein afrikanischer Ich-Erzähler führt
die Menschen - als eine Art Messias - aus den Städten zurück in die Basthütten.
„Die Ästhetik der Moderne ist ein Irrtum“ hat Christian Kracht einmal in einem Interview mit Denis Scheck gesagt. In dem Interview erzählt er auch, dass er nach Argentinien gezogen sei und dort
Politiker werden wolle, um die Falklandinseln zurückzuerobern für die Argentinier.
Wie schon eingangs erwähnt: Ein literarischer Spaß auf hohem Niveau, mit einer heute altertümlich wirkenden Sprache, die dennoch passt, denn das war eben die Zeit der kolonialen Erzähler wie Thomas Mann, Gerhard Hauptmann, Ludwig Feuchtwanger. Sie haben alle so geschrieben.
14. Februar 2020
Fabian
Die Geschichte eines Moralisten
Von Erich Kästner
Erstmals erschienen 1931
in der Deutschen Verlagsanstalt, Berlin
Der 32jährige Doktor der Literaturwissenschaften Jakob Fabian schlägt sich als Werbefachmann (Propaganda) durchs Leben. Er ist alleinstehend und wohnt zur Untermiete in Berlin. Er geht oft in Tanzbars aus, kommt zu spät zur Arbeit und weiß im Grunde nicht wirklich, was er mit sich anfangen will. Erst als er Cornelia kennenlernt, scheint sein Leben einen Sinn zu bekommen. Doch dann verliert er seine Arbeit, seine Freundin Cornelia und seinen besten Freund Stephan Labude. Angewidert vom moralischen Verfall der Stadt, kehrt er in seine Heimatstadt zu seinen Eltern zurück. Doch auch hier findet er keinen Rückhalt und keine Ruhe. Er beobachtet ein Kind, das in einen Fluss fällt, springt dem Kind hinterher um es zu retten. Das Kind schafft es ans Ufer, aber Fabian ertrinkt. Er konnte nicht schwimmen.
Als der Roman erschien, war Erich Kästner (1899-1974) bereits ein berühmter Autor. Gerade mal 30 Jahre alt, war eines seiner bis heute berühmten Kinderromane (Emil und die Detektive) erschienen und zwei Jahre nach Fabian erschien sein wohl berühmtestes Werk: Das fliegende Klassenzimmer. Die – im Roman Fabian geschilderte - von künstlichem Nachtlicht durchtränkte, schillernde Epoche der Weimarer Demokratie hatte ihre Schattenseiten. Millionen Arbeitslose kämpften um ihre Existenz. Auch Kästner stammte aus einfachen Verhältnissen. Der gelernte Volkschullehrer schlug sich in den 1920ern mit Gelegenheitsarbeiten durchs Leben und viele dieser Erfahrungen spiegeln sich in dem Roman. Die Sprache zählt man allgemein zur Neuen Sachlichkeit. Doch der Witz und die Pointen der vielen Geschichten dieses Romans haben bis heute ihre Schlagkraft nicht verloren. Wenn der Journalist Münzer einfach einen Aufstand in Kalkutta erfindet um die Zeitung zu füllen (1928 erschienen 3356 verschiedene Tageszeitungen - davon 147 allein in Berlin), dann fühlt man sich an die Fake News des 21. Jahrhunderts erinnert. Was wir hinzudichten, ist nicht so schlimm wie das, was wir weglassen, kommentiert Münzer seine Lügen. Und auch sein Satz: Die bequemste öffentliche Meinung ist noch immer die öffentliche Meinungslosigkeit, lasst uns noch 90 Jahre nach Erscheinen des Romans aufhorchen. Denn die Mainstream-Presse fürchtet sich am meisten vor den Auswüchsen des Influencer-Journalismus der digitalen sozialen Netzwerke. Wir wollen, dass es sich ändert, aber wir wollen uns nicht ändern. Sollen mal die anderen machen. Auch diese Haltung kennen wir Heutigen gut.
Natürlich ist vieles in dem Roman nicht in die heutige Zeit übertragbar. Leider blüht in
Deutschland wieder der Faschismus und dass gerade in Thüringen die neorechte Partei der AFD einen Landesherrn krönt, erzeugt höchst ungute Parallelen. Fabian ist – wie der Untertitel klarmacht – ein
Moralist und er beobachtet den moralischen Verfall. Die sexuellen Entgleisungen einer Irene Moll spiegeln dies so wie die zunehmende Verrohung in den politischen Auseinandersetzungen. Folgt man der
Mainstream-Presse des 21. Jahrhunderts, dann haben wir auch dazu Parallelen. Der Blick auf die Realität geschieht dabei immer durch die eigene Brille. Daher könnte man es auch ganz anders sehen. Denn
immerhin war die Weimarer Republik in vielen Bereichen freier und freizügiger als die Berliner Republik und erst recht als die Bonner Republik. Wenn Fabian über seine sexuell ausgehungerte Vermietern
sagt: Früher war diese Sorte Damen fromm geworden, dann eskamotiert Kästner die Unterdrückung der Frau. Die vielen Schilderungen leichtfertiger Frauen sind der Zeit Kästners
geschuldet. Durch den ersten Weltkrieg waren die 1920er Jahre durch einen Überschuss an Frauen gekennzeichnet. Als Irene Moll verzweifelt ausruft, dass man Männerbordelle bräuchte, war ich
eindeutig auf ihrer Seite. Kästner beschreibt diese Szene jedoch als moralische Kritik an Irene Moll. Ein Männerbordell verursacht bei Fabian Brechreiz (S.141). Ein Frauenbordell scheinbar nicht. Mit
seinem alten Schulkameraden Wenzkat besucht er ein Bordell und die Prostituierte verliebt sich sogar in Fabian.
Als seine Freundin Cornelia ihren Körper einem Filmproduzenten anbietet, kommt die ganze Doppelmoral von Jakob Fabian zum Vorschein, zumal er die Nacht zuvor bei einer anderen –noch dazu einer
verheirateten Frau – verbrachte. Während sich alles um das liebe Geld dreht, verfällt die Moral der Menschen, sie werden (wie in dem Traum aus dem 14. Kapitel) selbst zur Ware und verheizt bis der
große Krieg ihnen den Rest gibt.
In schneller Folge verliert Fabian zunächst seine Arbeit und danach seine Freundin. Cornelia hätte seinem Leben einen Sinn gegeben. Er war gerade bereit dazu, endlich Verantwortung zu übernehmen. Da er aber kein Geld mehr hat, muss Cornelia die Chance am Schopf packen und heuert beim Film an. Die Karriere beim Film zwingt sie in die Prostitution. Fabian wendet sich von ihr ab. Als er auch noch seinen treuen Freund Labude verliert, der sich umbringt, bricht Fabian alle Seile ab. Der Tod von Labude ist völlig sinnlos, denn ihm wurde fälschlicherweise vorgemacht, seine Doktorarbeit wäre abgelehnt worden. Labude hatte fünf Jahre an ihr gesessen. In Wirklichkeit war seine Arbeit ein Meisterwerk. Metaphorisch bringt dies die Lebenssituation der damaligen Weimarer Epoche auf den Punkt. Es ist ein grandioser Witz der tödlich endet. Kästner konnte das noch nicht wissen. Aber er ahnte es und darauf zielt der Roman letztlich ab. Dass Fabian beim Versuch ein Kind vor dem Ertrinken zu retten, selbst ertrinkt ist ebenso ein grandioser Witz, da Fabian ins Wasser springt obwohl er gar nicht schwimmen kann. Die Vergeblichkeit aller Bemühungen, wenn zu leben bedeutet, dass man nur etwas weniger tot ist. Fabian wollte dieser Gesellschaft, dieser GmbH nicht beitreten. Er wollte wirklich leben. Er wollte nicht zur Ware werden und nicht auf seine Individualität verzichten. Die Zeit in der Kästner den Roman ersann war auch die Zeit von Alfred Adlers Individualpsychologie. Phasenweise wirkt der Roman von Kästner wie die erzählerische Ausarbeitung der Theorien Adlers. Adler ging von einer körperlichen und psychischen Kompensation und Überkompensation aus, wenn die eigentlichen Bedürfnisse nicht befriedigt werden können. Adlers Werk schuf die Grundlage für die Ideen der humanistischen Psychologie (Maslow, Frankl). In den 1920er Jahren waren Adlers Bücher die am meisten gelesenen psychologischen Texte. Vor allem sein Buch „Vom Sinn des Lebens“ war ein Bestseller und traf die damalige Lebenssituation der Menschen. Parallelen zur heutigen Sinnsuche sind natürlich da. Dass wir vor lauter Geld verdienen müssen nicht mehr leben, dass wir uns nach mehr Tiefe sehnen und spüren, dass es so nicht weitergehen kann, all dies sind Parallelen zum Lebensgefühl Jakob Fabians. Insofern ist es kein Wunder, dass der Rechtsruck (der ja auch in Kästners Roman eine Rolle spielt) auch bei uns und in ganz Europa sich wieder verbreitet. Sich einer Autorität zu unterwerfen jedoch, war Fabians Sache nicht. Doch es brachte ihm am Ende den Tod als Witz.
04. Februar 2020
Canto
Von Paul Nizon
Erstmals erschienen 1963 im Verlag Suhrkamp
Da schreibt sich einer tief hinein in die eingedickte Wortsuppe, schlägt mit dem Löffel Silberglocken aus dem Porzellan seiner Gedanken, ein eingemauerter und lichtverschluckter Romhocker, mauert sich aus zum Romgeher, gegen Rom Angeher. Der Schweizer Schriftsteller, der seit 1977 in Paris lebt sagt über sein Schreiben selbst: Schreiben ist Leben. Sein Thema ist immer nur Paul Nizon. Aufgrund seines 90. Geburtstages im letzten Jahr legte der Suhrkampverlag in unverändertem Druckbild sein Erstlingswerk „Canto“ von 1963 wieder auf. Es ist ein literarischer Gesang (Canto) eines Romstipendiaten, rondellhaft kreisend zwischen Grottaferra und Rom. Schon der Anfang des Textes legt fest, worum es geht: „Vater, nichts nennenswertes“.
Paul Nizon gibt freimütig zu, dass er „nichts zu sagen“ hat. „Schreiben, Worte formen, reihen,
zeilen, diese Art von Schreibfanatismus“ bezeichnet er als seinen „Krückstock“. Was er nicht wiederholen will – wie unzählige Autoren vor und nach ihm – ist das Erzählen. „Ohne Geschichtenstil. Ohne
Personenerfund. Ohne Hans. Trat auf die Straße. Zwölf Uhr und ein Lüftchen geht.“ Nizon ist nicht Hans. Was dann folgt ist ein spracherotisches, nein, ein sprachpornografisches Sprachmalen, das
Matthias Kußmann vom Deutschlandfunk an das Action Painting von Pollock erinnert. Der Egomane Paul Nizon kam 1929 in Bern auf die Welt und nach eigener Aussage kam er literarisch 1963 in Rom auf die
Welt. Der gelernte Kunsthistoriker verweigert sich einer Karriere in den Museen und wird zum aufopfernd hungernden Literaten. Sein – inzwischen Kultbuch gewordener – Erstling wurde aber von den
Rezensenten damals abgelehnt. Die Kritiker lobten den Umschlag von Fleckhaus und die Qualität des Papiers, erkannten eine „gewisse Sprachgewalt“ - aber anfangen konnte kaum einer etwas mit "Canto".
Die Franzosen lieben ihn. Es gibt eine große Ansammlung Sekundärliteratur zu Nizon. Das Selbstbewusstsein dieses Geschichtenverweigerers ist das Geheimnis einer Literaturmaschine, die solch ein
Bewusstsein immer wieder nötig hat. Der Leser von solchen inkohärenten Texten muss sich einfach fallen lassen und ganz auf Sprache aufschlagen. Es ist eine Art Poesie-Positivismus. Die Welt ist ein
Haus aus Sprache, sagte einst Heidegger. Und Nizon ist ein Bildhauer dieser Sprachwelt, zertrümmert den Sprachstein und gestaltet diesen neu in seinem Sinn. Dabei kommen natürlich großartig zu
lesenden Sprachbilder hervor. „Sind die Dinge den Worten entschlüpft, führen ein Stilleben außerhalb, leben für sich und für sich die abgestanden Worte fort“, heißt es auf Seite 49. Eine
„Lampenlichtfalle“ entsteht, eine „sündenentzündende Tankstelle“ wird gebaut. Und Gabriella „verbringt Zeit, die dann immerunbenutzt aus der Stimme klagt.“ Man kann das gut lesen, wenn Maria (wohl
ein Jugendliebe) mit „damenhafter Tagfeindlichkeit“ auftritt.
Nizon flaniert sprachmeißelnd durch seine Sprachwelt. Der Filter seiner Wahrnehmung ist nur Sprache. Zwischenzeitlich bilden sich dennoch unvermeidbare Ansätze zu einer schwach kohärenten Geschichte.
Der Stipendiat fühlt sich nicht wohl unter den anderen Stipendiaten, die sogar in seiner Gegenwart über ihn hinweg reden (S. 186). Von diesen Stipendiaten erzählt er ein wenig, ein wenig über seinen
Vater, der als junger Russe in die Schweiz kam und dort als Chemiker arbeitete. Man erfährt etwas von seiner Jugendliebe Maria, einem missglückten Kinobesuch. Sprachrealitäten mischen sich mit
Sprachträumen nahezu ununterscheidbar, da ja alles nur Sprache ist. Und das ist alles nur Nizonsprache, ein Sprachnizon. Der tritt auf, typisch mit Seidenschal locker gebunden und Jackett, alles
künstlerisch, graues und längeres Haar, künstlerisch. Ein Klischee. Das ist ein Spiegel in dem sich die sattaufgehobene Kulturelite blinkend betrachtet. Das war in den 1960ern, als noch geeifert
wurde und alle nach Geschichten gierten zu avantgardistisch. Daher wurden nicht mal 1000 Bücher verkauft, auch wenn Herr Unseld ihm schon Weltruhm prophezeite. Inzwischen hat Nizon diesen Weltruhm.
Denn inzwischen ist es keine Avantgarde mehr. Es gab in den 1950ern die Nouveau Roman, der in Frankreich besser Fuß fassen konnte, als in Deutschland. Eine Sprachkamera aufstellen und die Bilder
einfach durchreichen als eine Art Endlosschleife. So ist Nizon eine Art poetistische Fußnote des Nouveau Roman. Entscheidend an einem Roman ist nicht, was er darstellt, sondern wie er es darstellt,
lautete das Programm des Nouveau Roman (Nathalie Sarraute). Doch wenn man das Wie vom Was trennt, wird beides beliebig. Man kann über Rom und einen Romaufenthalt so schreiben. Man kann es aber
auch wie Goethe machen. Rom war gerade für die deutschsprachige Autorengemeinschaft stilprägend. Da ja alle Wege dorthin führen, führen auch alle Wege wieder hinaus. Rom hält nicht. Und es hält nicht
das Versprechen der Idee von Rom. Mein Vergnügen an dieser von Nizon erbauten Romsprachwelt hatte etwas von einem One-Night-Stand.
Manches verschlingt man ohne darüber nachzudenken, ob es einen Sinn ergibt. Es ist eine Art Sprachrausch, manisch und ideenflüchtig. Nizon hält nichts wirklich fest. Es erinnert an das automatische
Schreiben in dem das Sprachzentrum zensurenfrei explodiert. Was macht man eigentlich als Lektor damit? Ist Nizons Prosa überhaupt lektoral? Insofern erinnert die Sprache nicht nur an Pollock, sondern
auch an Art brut. Für einen Poetry Slam geeignet. Nah an der Lyrik und die Pinien sind „Schirme die im Sonnenfeuer stehen“. Die Kinder kommen in den Garten hinein, „alles hamstert noch Tag“. Es sind
schon treffende Bilder. Natürlich ist das Erzählen einer Geschichte ein alter Hut, ein klassischer Bogart aus schwarzer Wolle. Doch wenn wir am Ende des Buches anlangen, haben wir ein Fazit. Nizon
hat kein Fazit. Es folgt kein Schluss. Ein Gesang zeichnet sich durch seine Wiederholbarkeit aus. Immer wieder hörbar, variierbar. Rom ist daher auch keine Zeit, kein Land, kein Ding. „Alles
Einbildung. Alles Gekritzel und Kitzel an den äußersten Lenden des grauen sich wälzenden Laufs, aus dem wir Miniaturübersichten herausblenden und Katastrophenhelligkeiten; winzige Räume.“ (Seite
217). Wenn wir also eine Geschichte erzählen, kohärent, in sich geschlossen mit Anfang, Mitte und Ende, dann liefern wir auch nur eine Miniatur, hauen ein Stück Mauer aus der Romstadt heraus und tun
so, als sei das die ganze Welt. Die einzige ganze Welt die Nizon daher hinnimmt, ist Paul Nizon. Das mag man egoman nennen. Man kann es aber auch konsequent nennen. Denn alle Versuche nicht man
selbst zu sein (indem man eine Geschichte von Hans erzählt) scheitern entweder daran, dass man doch selbst Hans ist, oder einen austauschbaren Klischee-Hans erschafft. Die Literaturindustrie hat
einen Klischee-Nizon erschaffen und Nizon nur sich selbst umrundet. Ein größeres Missverständnis als dieses kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
01. Januar 2020
Eine Experten-Revue in 89 Nummern
Von Hans Magnus Enzensberger
Erschienen 2019 im Verlag Suhrkamp
Ich erinnere mich an den Schreibtisch meines Vaters. Ein wuchtiger Tisch dessen Rückenseite
mit einer Vitrine ausgestattet war. Darin standen all die Pilsgläser, die mein Vater auf seinen Handlungsreisen gesammelt hatte. Mein Vater war ein Sammler und Pilsglas-Spezialist. Warum auch immer.
Diese für einen Lesekreis denkbar ungeeignete artistische Darbietung mit loser Rahmenhandlung (Wikipediadefinition von Revue) in 89 Nummern, ist eher eine Reise in 89 Tagen durch
die Arbeitswelt der lebenden und ausgestorbenen Spezialisten. Man kann es in einer Woche schaffen mit zwölf Nummern am Tag. Doch jede einzelne Nummer regt auch zur Nachrecherche an mit der man dann
einen Arbeitstag verbringen könnte. Bei der Nummer XXVIII fand ich zusätzlich heraus, dass Henry Mayhew der Gründer der Satire-Zeitschrift Punch war, gemeinsam mit dem Xylografen Ebeneser
Landells. Berühmt ist die Zeitschrift vor allem durch satirische Darstellungen von Thomas Huxley (den Großvater von Aldous Huxley nannte man „Die Bulldogge Darwins“) und Bischof Wilberforce, als
diese einen bis heute andauernden Streit zwischen Kreationisten und Evolutionisten losbrachen. Kernstück des Streites war ein Nervenbündel, der Hippocampus des Menschenaffen, der dem des Menschen
selbst verblüffend gleicht. Ergänzen könnte man die Nummer auch noch durch das Essay „Abroad in England“ aus dem Jahr 1930. Der Autor war Aldous Huxley. Er reiste durch Nordengland und
veröffentlichte in The Pall Mall Gazette einen Artikel über die Armut der dortigen Bergarbeiter. Pall Mall ist eine Straße in London wo vor allem Gentlemen wohnten.
Oder die Revue-Nummer XI über Heinz von Foerster und dessen ethischen Imperativ (Handle stets so, dass deine Wahlmöglichkeiten größer werden). Diese Nummer regte mich dazu an, ein Essay über
die Singularität zu schreiben. Ich stellte fest, dass eine nicht-triviale Maschine zwar über eine Art Wahrnehmung, über Sprache und Gedächtnis verfügt. Aber sie kann nicht entscheiden, was sie
wahrnimmt und entwickelt auch keine Gedanken und Gefühle zum Wahrgenommenen. Wobei es auch sein kann - nach dem Motto von Cato: Hättest du geschwiegen, würde man dich weiterhin für klug halten -,
dass eine Turing-Maschine klüger ist als der Mensch und ihre Gedanken und Gefühle verschweigt. Was dann auch die Willensfrage klärt.
Enzensberger evoziert mehr, als dass er schreibt. Es ist ein Museum, vielleicht sogar im altgriechischen Wortsinn mouseîon, einem Heiligtum der Musen. Es sind Zeugnisse. Vor zwei Jahren gab
es eine Ausgabe von Lichtwolf (Philosophie-Magazin für den verarmten Geistesadel), dort ging es um „alte Berufe“. Beutelschneider, Exorzisten, Quacksalber, Seiler, Türmer bis zum Zensor.
Auch der Xylograf wird erwähnt, der mit Grab- und Rundstichel, Geißfuß und Hohleisen bis zur Motorsäge Holz verschönert. Und ach, all die neuen Berufe vom Roboterberater bis zum Abfall-Designer, dem
Aquaponik-Fischfarmer, einem Feel Good Manager, dem Customer-Experience-Designer. Auch hier wäre eine Revue lohnend.
Die Revue-Nummer XXXII wäre noch um den Kaffeeriecher zu erweitern. Immerhin stellte Friedrich der Große 1781 ganze 400 von ihnen bei sich in Lohn und Brot. Sie sollten vor allem in den Hinterhöfen
illegal gerösteten oder geschmuggelten Kaffee erschnüffeln. Immerhin gab es in Preußen 150 Prozent Luxussteuer auf Kaffee. Das waren Einnahmen die man sich erhalten wollte. Die Nummer XXXVIII
berichtet über das arme Leben von Karl Marx. Seine Schrift mit 1023 Fußnoten hatte laut Jubiläums-Ausgabe der Zeitschrift Z., für marxistische Erneuerung eine Erstauflage von 1000 Stück und ein Buch
kostete 3 Thaler und 10 Neugroschen. Der Wochenlohn eines normalen Fabrikarbeiters betrug in dieser Zeit 2½ Thaler. Ohne Buchpreisbindung wäre die kommunistische Revolution vielleicht schneller
gekommen. Aber im Gegensatz zur abstrakten Internet-Recherche reist Enzensberger auch immer wieder persönlich zu seinen Koryphäen und sammelt seine Spezial-Trophäen mit dem Charme eines Serenus
M. Brezengang, einem Pseudonym von H.M. Enzensberger (als Anagramm gebildet). Der Sohn eines Oberpostdirektors, begann seine nun schon jahrzehntelange Karriere als Radio-Essayist gemeinsam mit
Alfred Andersch und ist längst ein Kultfaktor. Er hat die Nase am Wind, sagte einst Habermas über ihn. Er gründete „Die Andere Bibliothek“, den Landsberger Poesieautomaten, erhielt bereits mit 33
Jahren den Georg-Büchner-Preis, war Suhrkamp-Lektor, Herausgeber des Kursbuchs, dem wichtigsten Organ der APO. Er schuf einen Baukasten zur Theorie der Medien im Sinne Brechts. Seine Kritik an den
Medien (Bewusstseinsindustrie) orientierte sich an T.W. Adornos Kritik an der Kulturindustrie. Enzensberger zufolge machten die Konzerne die Bürger zu vorhersagbaren, fröhlichen Konsummaschinen und
auf den Servern der Nachrichtendienste seien die Bürger vollständig kontrollierbare Menschen. Das klingt schon fast nach Huxley und seiner schönen neuen Welt. Dort sagt der Weltcontroller Mustapha
Mond: Als glücklicher, fleißig arbeitender, Güter konsumierender Zeitgenosse wäre man ohne Fehl und Tadel. Siebeneinhalb Stunden milder, minimal belastender Arbeit, dann die
Soma-Ration, unbegrenztes Kopulieren und Fühlfilme. Was wollen Sie mehr?
Heute gibt es Netflix, Amazon, Cipramil, Benzodiazepam und soziales Glück durch all die vielen Facebook-Freunde. Es ist insofern ein Lichtblick, dass man über 1000 Arten von Weberknechten und fast
700 Arten von Regenwürmern gezählt hat und dass es Menschen gibt, die das weiter tun. Denn Wissenschaft muss so frei sein, dass sie auch ganz unnütz ist. Keine Seuche ist verheerender, als die
Nützlichkeitsseuche. Wozu noch weitere Prim-Zahlen entdecken? Warum nicht? Theorie und Praxis sind – das wusste schon Adorno – in einer negativen Dialektik verschränkt. Es wäre für die Theorie eine
Verarmung, würde sie von der Praxis bestimmt und es wäre für die Praxis zerstörerisch würde die Theorie nicht bei Zeiten geändert. So ist der Experte nicht nur experimentierend, sondern vor allem
explorativ und exponiert sich exemplarisch extrem. So ist dieses Experten-Museum auch ein Baukasten, ein Setzkasten, auch eine Hammer-Rehwü verbirgt sich darin mit viel Slapstick auf den man sich
einen Reim machen kann.
Die Rezensenten waren weitestgehend überfordert mit der Spezialisten-Pinakothek. So fragt sich Lea Schneider von der selbst immer ideenloser werdenden SZ, ob es die Ideenlosigkeit des Verlags
war, oder die Hochachtung vor dem betagten Autor mit Narrenfreiheit, die so ein Buch möglich macht? Soo wunderbar erscheint der Rezensentin nämlich gar nicht, was der Autor hier versammelt, nicht so
ausgefallen, dass es nicht auf jedem Wiki Walk zu entdecken wäre. Als hätte Lea Schneider jemals nach der Pomologie gesucht, oder die tausend Käsesorten von sich aus ausfindig gemacht. Es ist nicht
nur eine Fleißarbeit. Denn die Kritik am Kapitalismus scheint immer durch. So werden die Parfümnamen instrumentalisiert und die Gerüche industrialisiert. Selbst das, was wir täglich riechen ist nicht
mehr natürlich, sondern ein Produkt. Statt über tausend Käsesorten oder tausendfünfhundert Apfelsorten liefert der Discounter eine lächerlich bescheidene Wahl. Tausendfünfhundert Apfelsorten würden
uns zwar überfordern. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Proktologe, der Pomologe, der Osmologe, der Omnibussologe (mein Kunstwort zur Revue-Nr. XXXVI), dass die Bierdeckelsammlerin
Frau Berg und all die schönen und nutzlosen Geister aus der Einbahnstraße der Industrie verschwinden, wie die Pilsglas-Sammlung meines Vaters. Es geht um eine Hommage an die Vielfalt und an die
Verschwendung. Es ist ein Stück Barock.
Rufen Sie einfach an unter
Arwed Vogel
++49 ( )8762 726121
oder
Bernhard Horwatitsch
017646130019
horwatitsch[at]gmx.at
...
oder
nutzen Sie unser