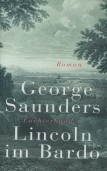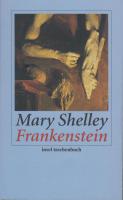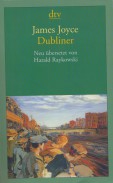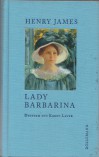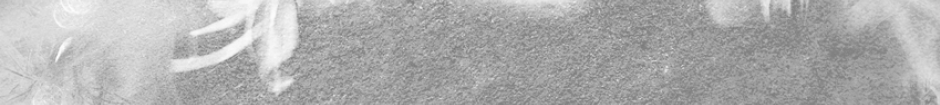
Literarische Besprechungen 2018 von Bernhard Horwatitsch
12. Dezember 2018
Aurora
Von Sascha Reh
Erschienen im
Verlag Schöffling & Co. 2018
What a man can be, he must be, schrieb einst der humanistische Psychologe Abraham Maslow und der Playboy machte seine letzte Ausgabe mit 365 Stil- und Spielregeln
auf: Alles was ein Mann heute können, ,machen, haben, wissen muss. How to be an man?
Während Maslow in seiner Bedürfnispyramide unserer Selbstverwirklichung noch unendliches Wachstum zutraute, wirkt der Playboy bescheidener. Die richtige Uhr, einen historischen Revolver und das
passende Surfbrett reichen da schon für den Gentleman von heute.
Mitten in die #metoo-Debatte platzt dem Mann also der sprichwörtliche Kragen? Sind Männer nur noch Besamungsmaschinen für die selbstbewusste Frau von heute? Der zur Drohne herabgesetzte Mann? Sascha
Reh hat mit den Stilmitteln des Kriminalromans (rasante Dialoge, Suspense, Whodonit) das Thema aufgegriffen, indem er einem Kammerspiel gleich einen zynischen Journalisten, eine muslimische Hebamme
und einen schlichten, kindlichen Soldaten an einem stürmischen Weihnachtstag in einen Panzer setzte. Man merkt der Story natürlich an, dass Sascha Reh seine Magisterarbeit über die Filmtheorie
schrieb. Der Stoff schreit förmlich nach Till Schweiger in der Hauptrolle des Panzergrenadiers Eric, Jürgen Vogel als zynischer und alkoholkranker Journalist und Sibel Kekilli als
Tamara.
Nach und nach erfahren wir durch die häufigen Wechsel der Perspektive, dass Ole (der
Journalist) einen autistischen Sohn hat, den er erst nicht sehen darf und dann für 13 Jahre Unterhalt nachzahlen muss. Wir erfahren, dass Tamara, die muslimische Hebamme, den Soldaten Eric als
Samenspender einsetzen wollte und es dann doch nicht tat, aber diesen an ihre Freundin Jette vermittelte. Und der Soldat Eric stiehlt sich an diesem Weihnachtstag einen Panzer und entführt Tamara, um
mit ihr zusammen zu Jette zu fahren, um herauszufinden, ob es Liebe war oder nur Missbrauch. Ole sitzt eigentlich nur durch Zufall in dem Panzer. Eigentlich sollte er über das Wetter schreiben.
Dieses Wetter spielt natürlich seine ganz eigene Rolle und spiegelt die stürmischen, kalten Beziehungsprobleme wider. Da Schneekristalle das ganze Farbspektrum reflektieren, erscheint er uns nur
weiß. In Wirklichkeit ist er durchsichtig und kein Eiskristall gleicht dem anderen und es gibt mehr Eiskristalle als Atome im gesamten Universum. „Was Sie alles wissen“, ist die nüchterne Antwort von
Tamara. Was ein Mann wissen muss? Das hat Ole in der Nacht zuvor im Panzer erfahren. Und das muss er auch können. Jasper, Tamaras Mann kann es nicht. Und daher traut ihm Tamara auch nicht mehr
zu, ein guter Vater sein zu können. Dabei war Ole auch nicht gerade ein guter Vater, obwohl er genau das konnte und unter Beweis gestellt hatte – seine Zeugungsfähigkeit. Tamara belehrt Ole zum
Schluss sehr klar: „Bei den Honigbienen ist das einfach so. Es ist ein ewiger Kreislauf. Bei uns nicht. Ende der Geschichte.“ Auf Jettes alternativen Julefrokost (traditionelles dänisches
Weihnachtsessen) befinden wir uns am Ende auf einer von Frauen dominierten Kommune. Und es ist die hoch schwangere Jette, die einen Militärpolizisten den Weg versperrt und Eric vorerst rettet. Das
ehemals starke Geschlecht fühlt sich erniedrigt, degradiert und überflüssig. Frauen können inzwischen selbst jagen, ihre Kinder versorgen, ein Haus bauen (Laerke ist Schmiedin), sich verteidigen. Sie
brauchen die Männer nicht mehr. Dass der Mann sich nur als Mann fühlen kann, wenn er seine präformierte Dominanz ausleben kann, ist kein gutes Zeugnis (wenn ich mir dieses Wortspiel erlauben
darf).
Aber wir dürfen beim Lesen nie aus dem Blick verlieren, dass dieses Psychodrama Inselcharakter hat. Bornholm – der Ort des Geschehens - ist eine Insel in der Ostsee die näher an Schweden liegt, als
an Dänemark. In Indien sterben jeden Tag mehr als 12 Frauen in Folge von Streitigkeiten um die Mitgift, meist bei Küchenbränden, die als Unfälle getarnt werden. In Jordanien sind jedes Jahr 25
Todesfälle auf Morde „aus Gründen der Ehre“ zurückzuführen. Dies ist ein Viertel aller Morde im Land. In den Vereinigten Staaten werden jährlich 700.000 Frauen vergewaltigt oder sexuell missbraucht.
Zwei Millionen Mädchen im Alter von 5 bis 15 Jahren werden jedes Jahr verschoben; sie werden verkauft oder in den kommerziellen Sexmarkt und zur Prostitution gezwungen. Etwa 20.000 Frauen wurden
während des Konfliktes im ehemaligen Jugoslawien vergewaltigt. 62% der Frauen in Kanada, die 1987 ermordet wurden, starben durch die Hand eines Verwandten oder des Partners. 40% der Frauen in
Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. Gewalt ist eine Straftat. Darüber gibt es keine zwei Meinungen. Problematisch wird es, wenn man männliches
Fehlverhalten ungebührend psychologisiert.
Es wird also Zeit Jettes Mut zur allgemeinen Währung der Menschen zu machen. Wenn Männer zurückbleiben hinter dieser neuen Weltordnung, ist das deren eigene Schuld und Inkompetenz. Statt sich – wie der Playboy rät – mit Spielzeug zu umgeben und den Verlust der Dominanz dadurch auszugleichen, dass man sich zum Kind zurückentwickelt, oder lernt auf einer einsamen Insel zu überleben (auch als Metapher gemeint), wäre es hilfreicher für Männer, sie lernten endlich mit Gefühlen umzugehen und Teil einer Welt zu werden, in der man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Es geht nicht darum, wer Dominanz ausüben darf oder nicht, sondern um Gemeinsamkeit, gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung. Es war ja nie einfach. Schon Torquato Tasso rief aus voller Brust: „Erlaubt ist, was gefällt.“ Und Leonore wies ihn zurecht: „Erlaubt ist, was sich ziemt.“ Und was „ziemt“ sich? Wäre man zynisch, könnte man sagen, nun: was erlaubt ist eben. So beruhte der alte stoische Glücksfaktor der Affektfreiheit auf einem Missverständnis. Affektfreiheit gelingt nicht, indem man Gefühle unterdrückt. Das macht Gefühle nur unbeherrschbarer. Wer lernt, seine Gefühle zu akzeptieren, der lernt auch mit ihnen umzugehen und kann sie dann ohne Unterdrückung beherrschen. Und darum geht es ja bei Aurora immer wieder. Was da in dieser kalten Schneenacht auf Bornholm zum Ausdruck kommt, sind all die unterdrückten Gefühle von Menschen (Mann und Frau), die sich in dem Bild der beiden frierenden und dann aneinander wärmenden Ole und Tamara in Wärme auflösen. Darum geht es. Der Kälte kann man eben nur mit Wärme begegnen. Auch einer erkalteten Beziehungswelt begegnet man mit Wärme. Dass es dabei zuweilen schwül wird ist auch hier als Homonym zu verstehen, also feuchtwarm, betörend aber auch bedrückend, das ist kaum zu vermeiden. Was uns bedrückt, beklemmt ist ja das heraufkommende unterdrückte Gefühl. Die heitere, gelassene Stimmung bei Jettes Julefrokost mag uns kitschig vorkommen, rührselig geradezu, auch etwas unecht. Auch Ole kann es nicht recht einschätzen, ob er sich nun wohl fühlen oder doch lieber zu seinem alten, zynischen Angriffsverhalten zurückkehren sollte. Aber für Letzteres war die Nacht dann sogar für Ole entschieden zu kalt.
11. Dezember 2018
Berliner Kindheit um 1900
Von Walter Benjamin
Suhrkamp Verlag 1987
Es gibt kein Geschehen oder Ding weder in der belebten noch in der unbelebten Natur, das nicht in gewisser Weise an der Sprache teilhätte, denn es ist jedem wesentlich, seinen Inhalt mitzuteilen. Eine Metapher aber ist das Wort »Sprache« in solchem Gebrauche durchaus nicht. Denn es ist eine volle inhaltliche Erkenntnis, daß wir uns nichts vorstellen können, das sein geistiges Wesen nicht im Ausdruck mitteilt; der größere oder geringere Bewußtseinsgrad, mit dem solche Mitteilung scheinbar (oder wirklich) verbunden ist, kann daran nichts ändern, daß wir uns völlige Abwesenheit der Sprache in nichts vorstellen können.(Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, Walter Benjamin)
Wir drücken uns nicht durch die Sprache aus, sondern in der Sprache. In diesem Sinn hat auch
das Kind seine Sprache in der es die Welt erfasst. Die autobiografischen Fragmente der Berliner Kindheit sind der Versuch, dem Wesen des Kindes nachzuspüren, die Welt des Kindes zu erforschen. So
sind die Worte nicht arbiträr, nicht zufällig. Vom Fischotter bis zum mütterlichen Nähkasten teilt sich die Welt mit. Was wir davon sprechen, ist was wir davon sehen. Auf seiner Suche nach der
adamitischen Sprache versuchte Benjamin möglichst alle Perspektiven der Welt zu betrachten, um sie so ganz zu erfassen. Zeugnis dieser Versuchsreihen ist das Passagenwerk.
Walter Benjamin wuchs als Kind des gut bürgerlich situierten Kunsthändlers Emil Benjamin in Berlin auf. Er ist noch ein Kind der Kaiserzeit. Doch dieses Berlin ist heute nicht mehr. Selbst die
Siegessäule steht heute wo anders. Sich in einer Stadt nicht zurechtfinden, heißt nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Wald sich verirrt, braucht Schulung. So
ist uns die eigene Kindheit vertraut und doch ein Labyrinth. Und der Ariadnefaden durch diesen Irrgarten der Kindheit ist das Gefühl, das tiefer spinnt, als unser deklaratives Gedächtnis. Wir haben
unser eigenes Ur nicht selten in den Träumen. Wie aber ist das zu verstehen, wenn der Träumende klarer sieht als der Wache? So ist das Berlin in der Kindheit nur die Karte. Was aber durch die Gebiete
streunt, verstehen wir assoziativ als eigene Erinnerungen. So las ich den Text sogar zeitlos, denn immer wieder irrte ich beim Lesen durch meine eigene Kindheit. Auch meine Kindheit kennt Straßen,
Tiere, Dinge mit denen ich vertraut und zugleich nicht vertraut war. Vor Jahren lief ich selbst einmal durch die Ortschaft meiner Kindheit. Dort fand ich nichts mehr so vor, wie es in meiner
Kindheit war, der Wald war verschwunden, da stand nun ein Discounter. War neben dem Haus meiner Kindheit noch unbebautes Gestrüpp, direkt an den Gartenzaun grenzend, für mich auch Grenze, bewacht von
bei mir ungeliebten Stachelbeeren, nun war all das verschwunden, ein weiteres Haus stand dort. Der Kiesweg den ich oft traurig ging, auch er war einer festen, geteerten Straße gewichen. Und doch
legte sich mein eigenes Ur wie ein Film über die neue Ortschaft. Wie eine Kippfigur. Benjamins Zeitgenosse Ludwig Wittgenstein spürte dem Geheimnis dieses Perspektivenwechsels nach. Wittgenstein
schrieb in seinen philosophischen Untersuchungen vom „Erlebnisausdruck“. Für Wittgenstein ging es um unsere Fähigkeit etwas als etwas zu sehen, nicht um den Gestaltwechsel, nicht um die
kognitiven Vorgänge unseres Bewusstseins. Vielmehr beschäftigte ihn das „Aufleuchten“ eines Aspekts einer Sache. In jedem Fragment der Berliner Kindheit leuchtet etwas auf. „Rätselbilder“ nennt sie
Benjamin öfter und es sind Rätselbilder aus der Kindheit, die nie aufgelöst wurden. In einer Vorläuferfassung mit dem Titel „Berliner Chronik“, die Benjamins langer Wegbegleiter Gershom Scholem 1970
herausgab, gibt es nur wenige Abschnitte, die der Berliner Kindheit entsprechen. Das sind weitere Aspekte ein und desselben Erlebnisses. So hat ein Erlebnis nicht nur eine Tönung. Wittgenstein
beschrieb dies anhand von Musikstücken, die uns mal traurig, mal hektisch, mal heiter vorkommen können. Erlebnisse tönen sich durch uns. So ist Sprache Mitteilung. Durch und durch. Wir treten auch
mit Dingen in Mitteilung. Es ist ein sinnlicher Kontakt, basal. Visuell, olfaktorisch, akustisch, taktil, gustatorisch, vibratorisch.
Als ich durch meinen Kindheitsort ging, erlebte ich noch einmal wie in einem Märchen ein traumatisches Ereignis. Wegen einer schlechten Note traute ich mich nicht nach Hause, ich lief durch den Wald
(der inzwischen ein Discounter war), auf eine große Straße und verschanzte mich auf einem Hügel. Von dort beobachtete ich weinend die vorbeifahrenden Autos. Die Hügellandschaft gab es längst nicht
mehr. Dennoch ging ich durch den Wald, einen Märchenwald und zu den Hügeln, Märchenhügeln. Sich etwas vorstellen ist ein ähnlicher Prozess. Wir alle hatten schon einen Einfall. Daher standen wir vom
Schreibtisch auf, um in der Küche das, was uns eingefallen war, zu holen. Doch der Einfall war verschwunden. Ratlos standen wir in der Küche. Wir gingen zurück zum Schreibtisch. Und genau dort war
der Einfall geblieben. Nun nahmen wir ihn mit in die Küche. Die Psychologen nennen das unser intentionales Gedächtnis. Sich etwas vorzustellen ist eine Fähigkeit, die im Alter von drei bis vier
Jahren erlernt wird. So war der Haselnussstrauch am Ende unseres Gartens eine Höhle, der Zierstein an der Grenze zum Nachbarsgarten ein Felsen. Benjamin spürt seinen Kindheitsvorstellungen nach und
bekommt es mit einem Labyrinth zu tun. Denn die Vorstellungswelt von Kindern ist größer als die von deklarativem Gedächtnis verbauten Vorstellungswelten Erwachsener. Die fest gezurrte Bedeutung von
Dingen aufzulösen, auch das ist die Aufgabe der Poesie. Das ist nicht zufällig. Sonst wären unsere Sinne überflüssig. Die expressionistische und symbolistische Sprache Benjamins ist nicht wirklich
nötig. Sie ist eher eine Sprache seiner Zeit. Hier teilt sich seine Zeit mit. Wir würden heute knapper, pointierter, mit weniger Neben- und Schachtelsätzen operieren. Benjamin ist nicht immer leicht
zugänglich. So war auch sein Leben und Wirken nicht von dem Erfolg gekrönt, der vorauszusehen war. Zum erweiterten Kreis der Frankfurter Schule gehörend, war es vor allem Theodor W. Adorno und die in
den 1970er Jahren immer drängendere Kritik an der bürgerlichen Sprachphilosophie, die auch Walter Benjamin zu einem Star machten.
Walter Benjamin starb im Alter von 48 Jahren in der spanischen Grenzstadt Port Bou. Er wartete auf seine Überfahrt in die USA. Die Todesursache „Suizid“ wurde lange für gesichert gehalten. Aber es
gibt genügend Ungereimtheiten, denen der spanische Dokumentarfilmer David Mauas 2005 in seiner Dokumentation „Wer tötete Walter Benjamin“ nachforschte. Das Sterbedatum auf dem Totenschein stimmt
nicht mit dem Kirchenregister überein. Zwischen der Einnahme der Morphium-Überdosis und dem Tod sollen neun Stunden vergangen sein, was Forensiker anzweifelten, der Besitzer der Pension in der
Benjamin übernachtete, kollaborierte nachweislich mit den Nationalsozialisten. Und es wäre nicht der erste als Selbstmord getarnte Mord der Nazis gewesen (Erich Mühsam zum Beispiel). Wie auch immer.
Benjamins Leben war geprägt von Existenznöten, intellektueller Überforderung seiner Zeitgenossen und einer historischen Explosivität die so vielen großen Geistern das letzte Hemd vom Leib gerissen
hat.
20. November 2018
Lincoln im Bardo
Von George Saunders
Aus dem amerikanischen Englisch
von Frank Heibert
Luchterhand Verlag 2018
Georg Saunders wuchs in Oak Forest auf, einem Chicagoer Vorort, ist ein studierter Ingenieur
und weit gereist. Schon vor seinem Roman hatte der Schriftsteller in den USA Kultstatus aufgrund seiner Kurzgeschichten. Vor allem sein Erzählband „Zehnter Dezember“ (2014) sorgte für Furore. Die
Geschichten handeln vom gesellschaftlichen Rand der USA, den auch der Autor kennenlernte, als er von seinen Reisen in die USA zurück kehrte und als Gelegenheitsarbeiter (Türsteher,
Schlachthausgehilfe) seinen Unterhalt verdiente.
Und sein erster Roman bekam gleich den Man Bookers Prize verliehen. Und was für ein Roman! Nicht ein Erzähler, nicht zwei, drei, vier. Über 150 Erzähler berichten in 108 Kapiteln von einer einzigen
kalten Februar-Nacht aus dem Jahr 1862 am Carroll Mausoleum in Georgetown, Washington D.C. und einem verzweifelten, von Gram gebeugten 16. Präsidenten der USA im ersten Jahr des blutigen
Sezessionskrieges. Am 20. Februar 1862 starb Lincolns Sohn Willie an Typhus (Salmollen-Erreger), was insofern passend ist, da das altgriechische Wort für Dunst, Nebel steht. Während sein Sohn Willie
im Fieber liegt, findet bei den Lincolns ein üppiges Fest-Bankett statt. Vielstimmig mit Zitaten zum Beispiel von einer Sklavin namens Elizabeth Keckley (als Modistin bei Mary Lincoln), oder der
Präsidenten-Biografin Dorothy Kunhardt oder Margaret Leech (auch als Margaret Pulitzer bekannt) und mit vermutlich erfundenen Figuren und Zitaten wird der Ablauf dieses Abend und des Sterbens
dargestellt. Die andere Erzählebene findet am Friedhof statt, als gerade der Sohn in seiner „Kranken-Kiste“ hergebracht wird. Die toten Seelen dort sind sich gar nicht darüber im Klaren, dass sie tot
sind. Sie halten sich für krank. Aber mit den wirklich Lebenden können sie keinen Kontakt aufnehmen. Sie versuchen es später, kriechen in den Leib des trauernden Abraham Lincoln, um ihn zum Bleiben
zu bringen, denn sein toter (nicht toter) Junge sehnt sich nach seinem geliebten Vater. Die Haupterzähler sind hier der verstorbener Drucker Hans Vollmann, der eine junge Ehefrau zurückließ,
kurz bevor sie einander erkannten und als Folge mit einem riesigen Glied ausgestattet, der homosexuelle Selbstmörder Roger Bevins III mit aufgeschlitzten Handgelenken und der alte Reverend Everly
Thomas, zeitlebens ein rechtschaffener, anständiger Mann der Kirche, der friedlich sterben durfte.
Das ist das Bardo, eine Art Zwischenreich im buddhistischen Glauben, ähnlich dem christlichen Limbus, nur etwas weniger schrecklich. Insofern ist es natürlich humorig, dass ein Reverent sich
ebenfalls dort aufhält. Gemein ist diesen drei, dass sie, wie alle hier im Bardo, noch nicht wirklich abgeschlossen haben mit ihrem Leben. Irgendetwas hält sie noch zurück, sei es Rache oder Liebe,
Angst, Enttäuschung oder Reue. Sie klammern sich an das Vergangene, akzeptieren ihren Tod nicht, leugnen ihn. Sie warten in ihren „Krankenkisten“ verzweifelt darauf, wieder zurückkehren zu dürfen.
Gestorbenen Kindern bleibt diese Zerrissenheit meist erspart. Ihr Abschied vom Leben gelingt in der Regel leichter. Umso verwunderlicher, dass sich der kleine Willie Lincoln zu ihnen gesellt. Dabei
ist er der einzige Hellsichtige.
„Tot, sagte der Junge. Leute, wir sind tot!“
Hans Vollmann und Roger Bevins III sowie der Reverent Everly Thomas weisen den jungen Willie Lincoln in das „Leben“ am Friedhof ein. Immer wieder verschwinden Seelen mit einem Lichtblitz.
Auf dieser Website sind alle Figuren / Erzähler aufgeführt und man kann sie sich noch einmal vergegenwärtigen: https://www.penguinrandomhouseaudio.com/lincolninthebardo
Historisch gesichert ist ja Abraham Lincolns einsamer Besuch an der Mietgruft der Carrolls, und dass er dort seinen Sohn noch einmal in den Armen gehalten hat und sich nicht von ihm trennen konnte. Und schon zu seinen Lebzeiten sprach man über Lincolns paranormale Gaben. Er soll sogar seinen eigenen Tod vorausgesehen haben. Immer wieder hat Lincoln auch Geisterjäger ins Weiße Haus geladen, hielt Séancen ab. Seiner Frau Mary und seinem treuen Leibwächter Ward Hill Lamon erzählte er folgendes:
Eines Abends ging er spät ins Bett. Kein Geräusch war zu hören und er schlief schnell ein. Sein Schlaf wurde von unterdrücktem Schluchzen gestört. Lincoln erklärte, er hätte das Gefühl gehabt, von trauernden Menschen umgeben zu sein. Auf der Suche nach den weinenden Menschen marschierte er durch die Gänge des Weißen Hauses, suchte Zimmer für Zimmer ab – fand aber niemanden. Im Ostzimmer wurde er schließlich fündig. Er erblickte einen offenen Leichenwagen, auf dem ein in Tücher gewickelter Leichnam lag. Soldaten standen Wache, trauernde Menschen nahmen Abschied. Lincoln fragte einen der Soldaten: „Wer im Weißen Haus ist denn gestorben?“ Der Soldat antwortete: „Der Präsident. Er wurde von einem Attentäter erschossen.“ Kurz darauf erwachte Lincoln aus seinem Traum, fand in dieser Nacht keinen Schlaf mehr.
Insofern war es naheliegend, eine Geistergeschichte zu erzählen, wenn man von jener Zeit des Sezessionskrieges erzählen will. Hat man sich erst einmal in den sehr ungewöhnlichen Schreibstil der kurzen, sich ständig in der Erzählperspektive abwechselnden Passagen eingelesen, dann macht dieses Buch über die Trauer eines Präsidenten und die von unzähligen Verstorbenen über ihr verpasstes Lebensglück auch ungemein Spaß. Und lässt staunen. Nicht nur über die Kühnheit seines Verfassers, sondern auch über die enorme Empathie, die darin zum Ausdruck kommt. Empathie des Autors mit dem in seinem Schmerz versunkenen, zaudernden Abraham Lincoln, aber auch mit all den im Zwischenreich herumirrenden Verstorbenen, denen Enttäuschungen im Leben den Abschied im Moment des Sterbens erschweren.
Aber auch Empathie in der Figur des Präsidenten selbst, der im Angesicht seiner eigenen Trauer an die Trauer so vieler in seinem Land denkt, die im Bürgerkrieg geliebte Menschen verloren haben. Am Ende nimmt Abraham Lincoln unbewusst die Seele eines Schwarzen mit, der in ihn gedrungen ist.
„Und plötzlich wollte ich, dass er mich kennenlernte. Mein Leben. Uns kennenlernte. Unsere Art. (…) Dieses Ereignis hatte ihn offenbar nicht unberührt gelassen. Überhaupt nicht. Es hatte ihn traurig gemacht. Noch trauriger. Das hatten wir geschafft, wir alle, weiß wie schwarz, hatten ihn trauriger gemacht mit unserer Traurigkeit. (…) versucht etwas für uns zu tun, damit wir etwas für uns selbst tun können. Lasst uns los, Sir, lasst uns ran, lasst uns zeigen, was wir können.“
Die endgültige Abschaffung der Sklaverei im durch den 13. Zusatzartikel zur Verfassung im Dezember 1868 wird Abraham Lincoln nicht mehr erleben. Drei Jahre nach Willies Tod wird er ermordet. Weitere hundert Jahre werden vergehen, bis der schwarzen Bevölkerung uneingeschränkte Bürgerrechte zugestanden werden. Und heute sind die USA wieder so gespalten wie lange nicht mehr.
14. November 2018
Die Bezirksstadt
Von Karel Polácek
Aus dem Tschechischen übersetzt
von Antonín Brousek
Verlag Reclam 2018
PS: Die Diakritika habe ich – bis auf das Makron – weggelassen, weil sie nicht auf meiner Tastatur existieren (nur Sonderzeichen)
Eine kleine Stadt im österreichischen Kronland Tschechien im zweiten Jahrzehnt den neuen 20.
Jahrhunderts. Reichenau an der Knieschna in der Königgrätzer Region im Nordosten Böhmens ist zugleich Poláceks Geburtsort, im Jahr 1892. Polácek war also 22 Jahre alt, als der erste Weltkrieg
ausbrach. In den 59 Kapiteln beschreibt der tätige Journalist und Drehbuchautor die Welt seiner Jugend. Dem ausführlichen Nachwort des 2013 verstorbenen Übersetzers und Dichters Antonin Brousek (er
war Redakteur der Literární noviny zur Zeit des Prager Frühlings) kann man kaum noch etwas hinzufügen.
Der Roman beginnt mit der Beschreibung des Armenhauses der Stadt und seinem brutalen Aufseher Wagenknecht, der sich dann auch mit seinem „Ordnungstrieb“ als ein typischer Hilfspolizist (HiPo)
entpuppt, wie ihn später die SA und SS einsetzte.
Eine Gruppe Bettler spielt dauerhaft die Rolle der Beobachter, die glatte Ancka, früher Gattin eines reichen Tuchhändlers, Marycka Gib’s, der besonders reichhaltig schimpfen konnte, der schwachsinnig
Hynek, der alles nachplappert, und der Bettler Chleboun auch „Majorchen“ genannt. Sie werden immer wieder von dem Aufseher Wagenknecht tyrannisiert, allen voran der Bettler Chleboun.
Chlebouns Präsenz gehört sicher zu den intensivsten Erfahrungen beim Lesen. Zumal er durch die regelmäßigen Zuwendungen gar nicht arm ist. Aber weil es seinem Geschäft als Bettler Schaden zufügen
würde, kann er sein Geld nicht ausgeben. Eine Paradoxie, die mich lange beschäftigte. Immer wieder schleicht Chleboun herum, drückt seine Nase an die Scheiben der Häuser in denen die
unterschiedlichen Bürger ihren Beschäftigungen nachgehen. Immer wieder verfolgt er die von Polácek liebevoll aber auch spöttisch porträtierten Bürger und kommentiert deren Verhalten. Seine Kommentare
werden nie gehört. Dabei sind seine Ansichten konservativ und könnten durchaus die Anschauungen der kommentierten Bürger sein.
Eine weitere zentrale Figurenkonstellation besteht aus der Familie des Kaufmanns Stedrý. Seine drei Söhne könnten unterschiedlicher nicht sein. Da ist der Heimkehrer Kamil, der dann Karriere als Kaufmann macht, Viktor, der sich als Arbeiter von der Familientradition entfernt hat und zum technischen Direktor aufsteigt und sich nur für Maschinen interessiert, dabei lässig wirkt und unkonventionell. Und dritte im Bunde, der jüngste, ist Jarousek, der Student. Er ist das Lieblingskind von Frau Stedrý. Dabei ist sie von allen nicht die leibliche Mutter. Aber da sie den jüngsten der drei gesund pflegte, hängt ihr ganzes Herz sehr einseitig an ihm. Stets ist sie um ihn besorgt und blickt eifersüchtig auf die beiden anderen Kinder. Anfangs wird der Heimkehrer Kamil von seinem Vater tyrannisiert. Kamil hat seinen Job verloren, weil er in der Arbeit gesungen hat (gestreikt). Später aber, als Kamil in der Fremde Karriere macht und immer wieder zu Besuch kommt, mit seiner hübschen Frau, wird er vom Vater umschmeichelt. Jarousek hat immer Mitleid mit seinem Vater, weil dieser wohl bald sterben wird. Er verfolgt traurig den Verfall seines Vaters und schämt sich ob der übertriebenen Fürsorge seiner Mutter. Viktor ist meist ölverschmiert, schmatzt beim Essen, und hat immer noch eine eigene Brotzeit im Gepäck.
Alle lesen den gleichen Roman (außer Jarousek der Student), von Jules Verne „In achtzig Tagen um die Welt“, hier übersetzt mit 5 Wochen im Ballon. Viktor und Kamil können daraus auswendig zitieren und haben eine Art Geheimsprache entwickelt.
Die dritte Konstellation besteht aus dem Apotheker der in seiner ehrwürdigen Apotheke „Zum barmherzigen Bruder“ regelmäßig den Handelsvertreter Raboch, den Postmeister im Ruhestand Herrn Pecian, den Spediteur Wachtl und den Schlosskastellan Veprek zu Rosiliolikör empfängt. Danach gehen sie geschlossen ins gelbe Haus, wo sie vom Zuhälter Herrn Facalit bewirtet werden. Diese Gruppe um den Apotheker bekommt den größten Spott von Polácek ab. Der pensionierte Postmeister Pecian ist ein durchtriebener Antisemit, der alle möglichen Verschwörungstheorien ausbreitet und alle möglichen Geheimnisse kennt. Ein Typus, den man heute in bestimmten Kreisen immer noch antrifft. Der Kastellan wird noch besonders bestraft werden, weil seine Tochter Zdencka, die er an den Postmeister verheiratet, nach Prag durchbrennt. Der Spediteur Wachtl verleugnet seine jüdische Herkunft und möchte als vollständig assimiliert anerkannt werden und gerät daher immer wieder in Konflikt mit dem antisemitischen Postmeister, der auch die Protokolle der Weisen von Zion erwähnt.
Anekdotisch kommen diverse Figuren hinzu, wie der Friseur Jenda Sedmidubský, der sich immer seine eigene Beerdigung vorstellt, und als Laien-Komiker sehr beliebt ist. Der blonde Lehrer Kral, der sich umsonst um die Gunst von Marie bemüht. Später kommt noch der zuvor immer wieder ehrfürchtig erwähnte Abgeordnete Fábera ins Spiel, der sich als typischer Politiker erweist und mit seinen Worthülsen sich nicht groß von heutigen Politikern unterscheidet. Dieser Dr. Alois Fábera übergibt bei einer Ausstellung dem Handwerker Hejzlar (Kap. 53) ein Diplom für seine 50 Jahre Einsatz als Arbeiter. Niemanden interessiert dabei, dass der Arbeiter Hejzlar im Armenhaus lebt, von der Hand in den Mund. Nach der Ehrung will der Arbeiter ein Bier trinken gehen, hat aber nicht mehr genügend Geld für ein zweites Bier. Er möchte sein Diplom für ein Glas Bier eintauschen, aber das Diplom ist so wenig wert, wie seine 50 Jahre Arbeiterleben. Er bekommt nicht einmal ein Glas Bier dafür. Am Ende verliert er das Diplom und stellt beruhigt fest, dass es ohnehin nicht in das Armenhaus gepasst hätte. Dort hängt man keine Diplome auf. Da hätte auch der Aufseher Wagenknecht nicht mitgespielt.
Weiter gibt es noch den Buchhändler Oktávec, der zugleich Bürgermeister der Stadt ist, und
immer mit Jagdausrüstung unterwegs ist. Dann gibt es noch den Professor Posusta und seiner blasierte Ehefrau (Seite 113 unten… Frau Posustová ergriff den Studenten bei den Händen und schaute ihm
lange in die Augen. Dabei nickte sie stumm und traurig mit dem Kopf. Dem Studenten schien, er habe so etwas irgendwo gelesen).
Der ehemalige Braumeister Vokoun mit dem Spitznamen Abdul Hamid wird zum Dorftrottel, weil er lange im Ausland war.
Das Personal dieses Romans ist also sehr reichhaltig. Und alles endet mit einem Debakel bei einer Rede des Abgeordneten Faberá, wodurch die politischen Hysterien zum Vorschein kommen und dann folgt schon das berühmte Attentat auf den Thronfolger und dann wird irgendwo ein Fenster zugeschlagen.
Mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges endet die k.u.k-Monarchie und die Moderne verschafft sich mit Sturmgewehren, Panzern und Giftgas ihren Platz.
17. Oktober 2018
Die Tagesordnung
von Èric Vuillard
aus dem Französischen von Nicola Denis
erschienen 2018 im Verlag Matthes & Seitz Berlin
In 16 knappen Texten erzählt Vuillard den deutschen Nationalsozialismus als Farce geheimer Verabredungen nach. Den Auftakt machten dabei acht berühmte deutsche Firmen (von Thyssen bis Krupp) und deren Stellvertreter. Dann folgt in mehreren Kapiteln der Anschluss Österreichs. Dieser gerät fast zur Karikatur. Die letzte Story erzählt dann von einem dementen Gustav Krupp. Wie dement, zeigt das Statement der aktuellen Avatare von Thyssenkrupp. In ihrem Leitbild lesen wir heute: Compliance*, das ist für uns ein zentraler Baustein guter Unternehmensführung. Es meint weit mehr als nur die Einhaltung von Recht und Gesetz. Compliance ist für uns eine Frage der Haltung. Das betrifft uns alle bei thyssenkrupp. Jeden Tag. Überall. Werte wie Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität sind für uns keine leeren Worthülsen, sondern durchziehen unsere Unternehmens-DNA. Wir übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft.
Die Camouflage einer juristischen Person lässt sich nur entlarven, wenn man sich die
Mühe macht, die Wirtschaftsberichte zu lesen. Um es mit den Worten von Vuillard zu sagen: „die gleichen vernünftigen Gesichter wie heutzutage. Eigentlich hat sich die Mode kaum verändert.“ Ob
Thyssenkrupp oder Rheinmetall, sie bauen und liefern nach Herzenslust U-Boote oder Panzer an alle die zahlen. Rheinmetall ist fast noch ehrlicher als Thyssenkrupp, denn auf der Startseite des
Internet-Auftritts von Rheinmetall sieht man gleich den Stolz der Firma, den Radpanzer „Boxer“ den sich die Australier in großer Menge bestellten. Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der
Welt nach den USA und Russland. Diehl-Defence lieferte zuletzt große Mengen Mörsergranatzünder und Wisent-Panzer an die Vereinigten Arabischen Emirate. Heckler & Koch lieferten die MP7 dazu.
Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten, weit, in der Türkei, die Völker aufeinander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt
sein Gläschen aus und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten; dann kehrt man abends froh nach Haus, und segnet Fried‘ und Friedenszeiten.(Faust I V860-867).
Vor 85 Jahren trafen sich die Avatare (im hinduistischen Weltbild Götter, die herabsteigen in irdische Sphären, dort körperlich manifestieren – in Grunde Dämonen) von damals. Das Geheimtreffen vom
20. Februar 1933 schildert der Autor als Benefiz nur ohne Wohltat. Die meisten dieser Dämonen sind inzwischen verschwunden, die juristische Person ist geblieben. Heute gehören sie selbstverständlich
zu den Guten. Nur fragt man sich, wie lange noch. In Bayern wählten am 14.Oktober 18 über 60 Prozent das rechte Lager aus CSU, FW und AFD. Hier wird eigentlich nur noch darüber gestritten, wie weit
nach rechts es noch gehen darf. Aber die Richtung liegt fest. Die düstere Geschichtslehrstunde L’ Ordre du Jour lässt einen da nicht ohne einen kräftigen Schauder zurück. Natürlich gibt es
genügend Unterschiede zwischen Manching und Dachau. Geschichte wiederholt sich nicht einfach, das ist auch klar. Aber alle wussten es damals schon. Die Dämonen von heute sind nicht die Dämonen von
damals. Aber es sind Dämonen. Dabei schildert sie Vuillard so banal wie sie eben sind, als eitle Schwätzer (Ribbentrop) oder als schwitzende Angsthasen (Schuschnigg). Dass Hitlers Regime anfangs kaum
auf internationalen Widerstand stieß und allen (den Lebruns, Chamberlains oder Halifax) klar war, worauf es hinausläuft, ist keine neue Erkenntnis. Der Charme mit dem Vuillard es erzählt, allerdings
ist im Tonfall besonders. In knappen Strichen demaskiert er die Camouflage und deckt die Banalität des Bösen rücksichtslos auf. Auch den historischen Hintergrund weiß er knapp und pointiert in nur
einem Satz darzulegen: „und da eine Prise Größenwahn, gekoppelt mit einer paranoiden Störung, die Schräge noch unwiderstehlicher macht, war nach Herders Spinnereien und Fichtes Reden, seit dem von
Hegel gepriesenen Volksgeist und Schellings Traum von der Weltseele der Begriff des Lebensraums nichts Neues mehr.“ (Seite 26) Wie sehr die Geschichte jenseits aller Zufälle liegt, wird klar
in dem Kapitel „Das Requisitenlager“, in dem Günther Stern (später Günther Anders „die Antiquiertheit des Menschen“) als Gelegenheitsjob in Hollywood bereits die Nazi-Stiefel poliert, während Hitler
noch seinen Angriff auf Frankreich plante. Und auch der berühmte Heldenplatz löste noch wenige Jahre vor dem Anschluss der DDR ans Berliner Reich und 50 Jahre nach dem Anschluss Österreichs
seinen Skandal aus. Niemand denkt heute daran Österreich heim ins Reich zu holen. Und auch der Lebensraum hat sich atomisiert in steigende Mietpreise. ‚Aber „wir holen uns unser Deutschland zurück“,
hört man wieder. Was die neuen Wölfe dann mit dem „zurückgeholten Deutschland“ machen, das verraten sie uns noch nicht. Insofern sind es alte Geister, die Vuillard beschwört. Zurückzublicken fällt
immer noch leichter, als vorauszublicken. Aber es wirkt weniger zufällig, wenn wir die Linien von gestern ins Heute und dann einfach mal weiter ziehen. Es ist die Methode der historischen
Hintertreppe von Vuillard, die einen dennoch höchst skeptisch machen sollte. Man sollte sich der Geschichte durch die Vordertür nähern. Mag der Mensch auch ein „antiquiertes Wesen“ sein, so ist es
andererseits eine Fähigkeit der Menschen sich den Zufällen stellen zu können. Wenn Halifax Hitler mit einem Lakaien verwechselt, sollten wir nicht davon ausgehen, dass den neuen Populisten das
Volksgewand wirklich passt. Es sind alte Geister, die noch immer umtreiben. Die Dämonen von damals fahren ein in ganz neue Körper. Vuillard fragt sich in dem Kapitel „The Sound of Music“, wie viel
wir heute noch in die damalige Inszenierung hineinlesen beziehungsweise herauslesen. Während der Nürnberger Prozesse hielt Albert Speer eine bemerkenswert scharfsinnige Rede: „Die Diktatur Hitlers
unterschied sich in einem grundsätzlichen Punkt von allen geschichtlichen Vorgängern. Sie war die erste Diktatur, die sich zur Beherrschung des eigenen Volkes der technischen Mittel in vollkommener
Weise bediente. Durch die Mittel der Technik, wie Rundfunk und Lautsprecher, wurde achtzig Millionen Menschen, das selbstständige Denken genommen; sie konnten dadurch dem Willen eines Einzelnen hörig
gemacht werden. Der Alptraum vieler Menschen, dass einmal die Völker durch die Technik beherrscht werden könnten, er war im autoritären System Hitlers nahezu verwirklicht.“
Ein moderner Diktator, ein modernes Regime hat dagegen heute technologische Mittel zur Verfügung, die alles möglich zu machen scheinen. Mit der heutigen Technologie kann man uns ein Simulacrum der
Wirklichkeit liefern, eine Bühnendemokratie auf den Bildschirm zaubern, was Guy Debord (Filmemacher und Gründer der Situationistischen Internationale) schon 1967 erkannte in
seinem Meisterwerk Die Gesellschaft des Spektakels. Der Blick zurück von Vuillard offenbart eine Farce und vergleicht diese mit der heutigen Farce (so der Autor in einem Interview mit
Tilman Krause). Farce, das ist Küchensprache und bedeutet Kleingehacktes. Einer Farce fehlt im Gegensatz zur romantischen Komödie die Handlung. Wenn wir unseren Blick jetzt wieder nach vorne richten,
dann geht es genau darum. Es ist komisch, dass in dieser immer kleiner werdenden globalisierten Welt alles derart auseinanderfällt. Eine Art Küchenmesser zerhackt die Gesellschaft in sehr viele
kleine, viele mittlere, einige größere, wenige große und ganz wenige riesengroße Stücke. Und wir reden hier vom Fleisch und nicht von den Beilagen. Wir sitzen vor einem großen globalisierten Teller
und starren auf einen „falschen Hasen“. Ein simuliertes Spektakel. Die Wirklichkeit dahinter ist viel schlimmer.
* Compliance bedeutet Regeltreue, Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
21. September 2018
Cox oder der Lauf der Zeit
von Christoph Ransmayr
Erschienen 2016 im Verlag S. Fischer
Schon der Anfang des Romans ist herrlich zeitnah. Da werden in Hang Zhou, der Hauptstadt der Provinz Zheijang, ca. 200 Kilometer südöstlich von Shanghai, betrügerischen Steuerbeamten und Wertpapierhändlern die Nasen abgeschlagen. Das wäre mal was, das auch so manchen von unseren Tradern und Brokern gut zu Gesicht stünde. Oder wie es in den Satiren des Juvenal heißt: „Es missfiel deine Nase?" Und bis heute finden in China die meisten Hinrichtungen statt. Selbst von Amnesty International gibt es zur Zahl nur Vermutungen.
Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Merlin, Bradshaw und Lockwood reist der Uhr- und Automatenhersteller Cox nach China, auf Einladung des Kaisers Qianlong, des vierten Kaisers der Qing-Dynastie. Für Cox war es auch eine Flucht, denn seine Frau Faye sprach nach dem Tod der gemeinsamen Tochter Abigail nichts mehr. Später wird Cox in der Konkubine An seine Frau und seine Tochter als eins sehen.
Es war im 18. Jahrhundert angeblich das „goldene Zeitalter“ dieser Dynastie, und Qianlong selbst war ein Künstler-Kaiser oder ein Kaiser-Künstler, ein chinesischer Nero mit glücklicherem Geschick. Er hielt Teegesellschaften zu denen er die berühmtesten Künstler einlud, er schrieb selbst zahlreiche Gedichte. Zu allen Zeiten ist Qianlong dafür kritisiert worden, dass er auf die Ränder der bedeutendsten Bilder der chinesischen Malerei seine Gedichte mit eigener Hand niederschrieb. Einige haben diese „Verschönerungen“ gar als Vandalismus tituliert.
Der St. James Chronicle berichtete 1772, dass der Kaiser Qianlong eine komplette Schiffsladung mit Erzeugnissen von Cox aufkaufte, während er Schiffe anderer Händler abwies. Zum Beleg dieses Zeitalters stehen noch heute in Zhongbiao Guan (Uhrenhalle) in der verbotenen Stadt die Uhren von James Cox. Cox selbst war jedoch nie in China, im Gegensatz zu seinem Sohn John-Henry. Dieser musste jedoch die verbotene Stadt verlassen, weil er wohl mit Opium einen Handel aufbaute.
Ransmayr, der Welten- und Zeitenbummler, beschreibt in seinem Roman mit seiner gewohnt poetischen Sprache das Leben am Hof, im Schatten des Herrn über zehntausend Jahre. Qianlong, ein Imperator über ein riesiges Reich, regierte von 1735 bis 1796. Und er baute die Siku Quanshu auf, die „vollständige Schriftensammlung der vier Schatzkammern“, die größte chinesische Bibliothek aller Zeiten. Er unternahm lange Inspektionsreisen durch das Reich der Mitte, um sich selbst ein Bild von der Lage des Reiches und der Menschen zu machen. Qianlong war also ein ziemlich tüchtiger Staatsmann, der mit harter Hand regierte und versuchte, seine kulturellen Visionen in die Tat umzusetzen. In dem Roman von Ransmayr erscheint er eher sehr abgehoben auf der einen Seite, andererseits aber auch als jemand, der die Traditionen auch durchbrechen kann, wenn er sich allein mit seiner Geliebten An (Konkubine des Kaisers) zu den englischen Handwerkern begibt. Ransmayr beschreibt auch die vielen Intrigen und Rebellionen in der Regierungszeit des Kaisers Qianlong. Der aufgeschlossene und interessierte Kaiser begann seine Amtszeit schon mit einer Säuberung des vom Vater Kangxi eingerichteten Hofstaats. In der Sommerresidenz, wo die atmosphärische Uhr gebaut wird, kommt es zu einem vermehrten Murren des Hofes.
Es gibt in dem Roman großartige Passagen, wie zum Beispiel das Scharmützel im Schnee, als Cox die chinesische Mauer besichtigen will. Oder die erste Begegnung mit Qianlong, wo dann am Ende eines endlos scheinenden Saales ein leerer Kaiserstuhl steht. Immer wieder werden die Kniefälle beschrieben, die verbotenen Blicke, die Fremdartigkeit der Engländer (Langnasen), die Arbeiten in der Werkstatt, wenn die Feinspäne auf dem Boden liegen, die Pracht der Paläste, der Luxus des Kaisers und zugleich die verheerende Armut der Bevölkerung.
Insbesondere fängt Ransmayr eine wesentliche Veränderung der Uhren ein, die mit der
Renaissance begann: Das Gehäuse. Gemäß dem Rokoko wird der Prunk des Gehäuses geradezu absurd. Ursprünglich war das Gehäuse eine sinnvolle Erfindung, um den Zeitmesser vor Staub und Abnützung zu
schützen. Hier wird das Gehäuse zum eigentlichen Anliegen. Und damit wird der Versuch unternommen, die Zeit regelrecht einzufangen. Die atmosphärische Uhr, die Merlin mit Cox zusammen baute,
war dann der Versuch, eine Uhr zu erfinden, die ewig läuft. Die Idee eines Perpetuum mobile fand seinen Höhepunkt im Zeitalter des Barock. Bis heute gibt es keine solche Uhr. Sie widerspräche
der Physik (den Hauptsätzen der Thermodynamik), aber auch der Logik. Sehr bildhaft wird das von dem gefangenen und gefolterten Arzt (S.111) ausgedrückt. Das grausige Bild einer zugenagelten Kiste
ohne Boden in der man immer fällt, bis man glaubt es gäbe gar keinen Boden. Da steht die Zeit still. Wie soll man also etwas messen, das ewig ist und somit auch nie vergeht?
Das Gleichnis zum Ende des Romans ist daher sehr bedeutsam. Der Kaiser würde sich selbst als Herrscher über die Zeit entmachten, würde er dieses Perpetuum Mobile der Zeit zum Laufen bringen. Das
Messen der Zeit, könnte man auch sagen, verändert den Blick auf die Zeit in einer Art und Weise, die uns etwas Entscheidendes raubt. Das subjektive Zeitgefühl. Die Zeit kann tatsächlich still stehen
und für Augenblicke (die dann keine Augenblicke mehr sind) erhaschen wir etwas von der Ewigkeit (Augenblick verweile…). Die Hektik unserer modernen Zeit spiegelt sich im dauerhaften Ticken unserer
Atomuhren. Und mit jedem Ticken haschen wir nach der Zeit, und je mehr wir dieser Zeit nachjagen, desto schneller scheint sie zu werden und entflieht uns. Das Zauberwort im 21. Jahrhundert heißt
daher nicht umsonst „Entschleunigung“. Nicht mehr Fast food, sondern Slow Food. Insofern ist das Gleichnis am Ende des Romans auch so zu lesen, dass gerade das Nicht-Tun uns über die Zeit erhebt.
Doch wird es auch hier nicht gelingen, uns dem Vergehen der Zeit zu entheben, unserer Endlichkeit. Am Ende wird die größte Mauer, der größte und härteste Palast, das gewaltigste Kunstwerk, der
Zeit zum Opfer fallen, oder wie es im Prediger 12;7 heißt: Denn der Staub muß wieder zu der Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. So wie ja auch
Cox Tochter Abigail der Zeit zum Opfer fiel.
Und richten wir kurz einen Blick auf die moderne Astrophysik, so stand am Beginn allen Seins die Zeit, und davor gab es keine Zeit. Die Zeitlosigkeit der Singularität ist ja auch eine Raumlosigkeit.
Ohne Zeit gäbe es nichts. Und irgendwann wird es auch wieder nichts geben. Das ist ja auch die Idee des Christentums. Denn ewig ist dort nur die Hölle, bzw. wäre die Ewigkeit die
Hölle.
12. September 2018
Unter der Drachenwand
Von Arno Geiger
Carl Hanser Verlag München 2018
Das Vergessenwollen verlängert das Exil, und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung lautet ein jiddisches Sprichwort. Im Münchner Stadtviertel Giesing in der Werinherstraße steht die Kirche Maria Königin des Friedens. Dort gibt es im Atrium eine hölzerne Gedenktafel für Kriegsgefallene. Auch der Name meines Großvaters Bernhard Steger (der Vater meiner Mutter) ist dort eingraviert. Er war Soldat und fiel in Russland im Jahr 1942. Von einem Oberleutnant Fieber ist noch ein Brief erhalten, indem es heißt: Lieber Frau Steger, als Companie-Chef ihres Mannes obliegt mir die schwere Pflicht Sie in Kenntnis zu setzen, dass Ihr Mann in heldenhafter und tapferer Pflichterfüllung am 29.10.42 für unsern Führer und seine geliebte Heimat den Heldentod fand..........
In 33 Kapitel mischt Arno Geiger 9 Brief-Kapitel mit den Tagebucheintragungen des verwundeten
Soldaten Veit Kolbe, der sich für die Zeit seiner Genesung in der Marktgemeinde Mondsee im Salzkammergut einmietet. Die heute als Urlaubsidylle (ich selber habe im Mondsee schwimmen gelernt)
beworbene Berg- und Seelandlandschaft ist auch geprägt von der Drachenwand am Südwestufers des gleichnamigen Sees. Diese Drachenwand gab dem Roman den Titel. Der Schatten den dieser Berg wirft,
ist quasi eine Metapher für den Schatten des Krieges (die albtraumhaft hingestellte Drachenwand). Zentral führt uns die Tagebuchstimme des Soldaten Veit durch diese scheinbar isolierte
Weltgegend im Salzkammergut und die Briefe sind wie eine Art Fenster zum Krieg. Sie handeln einmal von Margots Mutter Lore Neff aus Darmstadt, schildern dabei zum Ende die Bombardierung und die
Schrecken des Krieges an der Heimatfront. Drei weitere Briefe kommen von Kurt Ritler aus Wien und schildern seine traurige Liebe zur landverschickten Annemarie Schaller, seine Einberufung und seinen
Schrecken darüber, dass Nanni verschwunden ist und seine Hoffnung, dass sie noch lebt. Drei weitere Briefkapitel stammen von dem Wiener Juden Oskar Meyer und der Flucht mit seiner Familie nach
Ungarn, der Auslöschung seiner Familie und seiner Verschleppung in ein Konzentrationslager. Diese drei Briefe wirken ein wenig aus der Dramaturgie gefallen, da Oskars Geschichte keinen Zusammenhang
hat mit den Figuren aus Mondsee. Sie passen letztlich programmatisch hinein, da Geiger damit alle Bereiche des Krieges abdeckt.
In den ersten sechs Kapiteln lernt Veit nach und nach seine Umgebung kennen. Die Quartiersfrau, die Darmstädterin, der Onkel, die Lehrerin (Gerti Bildstein), die landverschickten Schülerinnen – vor
allem Nanni Schaller. Die Menschen haben anfangs kaum Namen, nur Funktionen. Und nur allmählich, fast unmerklich wird aus der Darmstädterin die Figur Margot.
In Mondsee gibt es im Grunde drei für Veit Kolbe entscheidende Ereignisse, die Geiger sehr geschickt kombiniert hat. Einmal verschwindet die landverschickte Schülerin Nanni Schaller spurlos (ihre
Leiche wird spät in der Drachenwand gefunden). Das Verschwinden von Nanni Schaller begleitet den Roman über zwei Drittel. Ob es wirklich geholfen hätte, wenn Veit mit Nannis Mutter gesprochen hätte,
wie es Nanni von ihm wollte? Veit Kolbe aber lehnt es ab, mit ihr zu sprechen. Das in diesem Kapitel eingestreute Brieffragment von Nannis Mutter (Seite 144) ist erschütternd. Dann wird der
Brasilianer Pertess, der Bruder der Quartiersfrau, auf brutale Weise verhaftet, weil er sich negativ über das Naziregime äußert. So bricht auch in die Idylle das Regime ein. Vor allem durch das
herrische Auftreten von Max Dohm, dem Ehemann der Quartiersfrau Trude Dohm. War die Quartiersfrau schon unerträglich (später wird dies mit einer Neurosyphilis nachvollziehbar), so ist Max Dohm der
Prototyp des unerträglichen Nazis. Das dritte für Veit Kolbe wichtige Ereignis ist die Liebe zur Darmstädterin Margot und dem Kind Lilo – und einem romantischen Spiegeleffekt zu seiner verstorbenen
Schwester Hilde. Sie lieben sich zuerst im Gewächshaus des Brasilianers. So wird der Brasilianer durch die unfreiwillige Verhaftung zu Stifter dieser Liebe.
Veit Kolbe ist dauerhaft für dieses Jahr 1944 auf Droge. Pervetin war eine typische Nazidroge, ein Metamphetamin das man heute als Crystal Meth kennt. So gesehen war Veit ein Meth-Junkie. Pervetin
wurde sogar an Kinder verteilt, damit diese als Kinder-Soldaten durchhalten. So dokumentiert diese Abhängigkeit von einem dem körpereigenen Adrenalin ähnelnden Muntermacher zusätzlich die Abartigkeit
dieses Systems.
Der Krieg der hier geschildert wird, ist nicht der Krieg der Schlachtfelder, sondern der an der so genannten Heimatfront. Und Geiger schildert - durch Tagebuch und Briefe schon sprachlich fragmentiert – den Versuch der Menschen, Normalität zu bewahren. Dabei ist Mondsee einerseits Idylle, andererseits bricht auch hier die Hölle durch, mit dem Verschwinden von Nanni Schaller, aber auch mit der brutalen Verhaftung des Brasilianers und dem Finale mit einem Kapitalverbrechen. Veit erschießt am Ende seinen eigenen Onkel. Der Riss des Krieges geht so auch durch die Familien.
Der multiperspektivische Ich-Modus macht den Roman sehr suggestibel. Der sprachliche Sound des
Tagebuchs von Veit ist manchmal sachlich (das Kind der Darmstädterin gedieh) und dann wieder poetisch (wenn das Kind weinte und die Darmstädterin es zu beruhigen versuchte, erzeugte sie
weit hinten in der Kehle einen Summlaut, der sich anhörte, als habe schon ihre eigene Mutter in Darmstadt auf diese Art gesummt S. 75).
Die Briefschreiber lassen sich auch sprachlich unterscheiden. So im Wiederholungszwang von Lore Neff, oder den sehr jugendlich wirkenden Gedanken von Kurt.
So bedrückend auch die Briefe von Oskar Meyer waren, so hatte ich doch gewisse Probleme damit, sie hier in diesem Roman vorzufinden. Schwierig, denn sie müssen einerseits sein, andererseits hätte es
auch zu konstruiert gewirkt, wenn Geiger sie irgendwie in die Figurenkonstellation von Mondsee eingeflochten hätte. Der Jude ist damit mit seiner Familie der Fremdkörper.
In einer der durchwegs positiven Rezensionen fiel mir von Iris Radisch ein Wort auf, das sie
in der Einleitung ihrer Rezension benutzte: Was, zum Teufel, haben die Leute, die da gerade eine Straße überqueren oder eine Fahne hissen, in dieser längst vergangenen
Weltsekunde wohl empfunden?
Iris Radisch beschreibt (DIE ZEIT Nr. 3/2018, 11. Januar 2018) die Nazi- und Kriegszeit als „Weltsekunde“. Also das darf man dann? Aber sie als „Vogelschiss der Geschichte“ zu bezeichnen, ist
natürlich ein Skandal. Nun: Frau Radisch kann sich halt besser ausdrücken, als Herr Gauland. Und im Kontext des weiteren Textes ihrer Rezension erfährt man natürlich, dass sie – Frau Radisch – eine
von den Guten ist. Doch Arno Geiger beschreibt die brüchige Normalität von Menschen. Er beschreibt nicht eine Weltsekunde, sondern ein ganzes Jahr. Die zeithistorische Grundlage, die
Echtheit der Ereignisse werden auch in einem kleinen Nachwort beschworen, in dem Geiger die Nachkriegsschicksale der wichtigsten Protagonisten schildert. Es ist damit auch eine starke
Recherche-Leistung von Arno Geiger, der nicht nur die Empfindungen durchstreift, sondern ein Gefüge aufleben lässt. Aber vielleicht bin ich zu kleinlich, wenn ich mich über das Wort
„Weltsekunde“ so aufrege.
17. August 2018
Fritz Breithaupt
Die dunklen Seiten der Empathie
erschienen 2017 im Verlag Suhrkamp
Der aus Meersburg am Bodensee stammende Kognitionswissenschaftler und derzeitiger Professor
der Indiana University Fritz Breithaupt beschäftigt sich in seiner aktuellen Studie kritisch mit dem ursprünglich aus dem Altgriechischen stammenden Begriff der Empathie (Leidenschaft), einem Begriff
der im Neugriechischen sogar die Bedeutung von „Feindseligkeit“ bekommen hat. Der Begriff in seiner heutigen Verwendung wurde von Edward Titschener 1909 aus dem deutschen Wort „Einfühlung“ (Theodor
Lipps) ins Englische „empathy“ übertragen und wird heute in diesem Sinne gebraucht. Empathie wird heutzutage weitestgehend positiv gesehen. Wir sehen das Leiden einer anderen oder
etwa die Ungerechtigkeit, die ihr widerfährt, und wir fühlen mit ihr. Und weil wir mit ihr fühlen und mitleiden, schreiten wir ein, intervenieren, helfen. So fasst Breithaupt die populäre
Vorstellung von Empathie zusammen. Doch genau dieser Logik widerspricht er.
Zunächst exzerpiert Breithaupt vier Ansätze der Empathie-Forschung, einmal einen evolutionären Ansatz der emotionalen Ansteckung, um prosoziales Verhalten für den Erhalt der Gruppe zu
entwickeln, dann einen Ansatz des Verstehens, einer Theorie of Mind in der unsere Selbstkenntnis (Differenz zum Anderen) schließlich zum Verstehen des Anderen beiträgt, einen empirischen Ansatz der
Hirnforschung in dem es durch Simulation im Gehirn zu einer neuronalen Struktur der Intersubjektivität kommt, und schließlich einen phänomenologischen Ansatz in dem fiktive, narrative Welten zu einer
kulturellen Basis von Intersubjektivität führen. Es wird schnell klar, dass Breithaupt als gelernter Germanist den phänomenologischen Ansatz präferiert.
Breithaupt beginnt mit einer Analyse der Empathie als einer Form des Miterlebens. Dazu betrachtet er F. Nietzsche und eine Textstelle aus dem sechsten Hauptstück von Jenseits von Gut und
Böse (§ 207) in der sich Nietzsche mit den Gelehrten auseinandersetzt, die Nietzsche als „den objektiven Menschen“ bezeichnet. Es kommt beim Beobachten des anderen zu einer Verminderung
des eigenen Ich. Durch die Objektivierung meiner Perspektive auf den anderen verliere ich mich selbst aus dem Blick und gerate gewissermaßen in den Strudel des anderen. Diese Perspektive findet seine
Fortsetzung in der Genealogie der Moral, in der Nietzsche zeigt, dass diese Perspektive aus dem Konflikt von Herr und Sklave hervorgeht. So schlägt die Perspektive des versklavten objektiven
Menschen durch seinen Selbstverlust in Ressentiment um, denn der Andere ist ein starkes Ich und der empathische Beobachter fast nichts und neidet diesem Ich seine Stärke. Breithaupt überlegt dazu,
dass Nietzsche zu sehr davon ausgeht, dass es einen subjektiven Menschen als natürliche Anlage überhaupt gibt. Hier greift Breithaupt auch auf seine Überlegungen zurück, in der er die Geschichte des
Ichs vom 18. bis zum 20. Jahrhundert überblickt als durch die Ökonomie als double bind aufgewerteten und dadurch entwickelten Ich-Zwang (Der Ich-Effekt des Geldes, 2008 Fischer-Verlag).
Schließlich – nach einem Exkurs über das Stockholm-Syndrom und der Geburt des aggressiven Ichs aus Schwäche – entwickelt Breithaupt eine Architektur der Empathie. Hier benötigt man immer drei
Personen. Die Konfliktparteien auf der einen Seite und den Beobachter auf der anderen Seite. Ein erster Auslöser für Empathie ist so die Parteinahme. Aus dieser empathischen Parteinahme wird der
Konflikt erst verschärft. Es findet eine soziale Markierung statt. Sozial markierte Menschen (Kainszeichen) erfahren weniger Empathie, erfahren einen Ausschluss aus der Gruppe, für die der
empathische Beobachter Partei ergriffen hat.
Es gibt zusätzlich genügend Hinweise, dass wir verstärkt Empathie zeigen, wenn der empathisch beobachtete Mensch Veränderung erlebt. So zeigt Breithaupt auf, dass akut erkrankte Menschen mehr
Empathie erfahren, als chronisch oder gar unheilbar Kranke. Der Einsatz von Empathie muss aus purem Selbstschutz (Ich-Verlust) begrenzt sein. Gestützt wird diese Annahme auch durch die
dramaturgischen Konzepte der Narrationen, die mit Vorliebe gut und böse radikalisieren und als Narration ein Ende haben mit der von Aristoteles dargestellten emotionalen Katharsis (Furcht, Mitleid).
Die Reduktion von Fiktion ermöglicht einen erleichterten Zugang zum komplexen Anderen und schafft zugleich eine Attraktion für den empathischen Beobachter. Aber durch die Reduktion der Narration
haben wir es mit perfekten Charakteren zu tun (Helden), nicht mehr mit den komplexen und widersprüchlichen echten Charakteren. Es findet also eine Identifikation statt. Diese Reduktion bzw.
Verwechslung eigener Annahmen über den Anderen setzen sich dann fort in Breithaupts Beobachtungen über die falsche Empathie. Im Besonderen untersucht Breithaupt die Fehlleistung von Angela Merkel bei
einem Bürgergespräch mit Schüler im Juli 2015. Dort beklagte sich ein aus dem Libanon stammendes Mädchen in perfektem Deutsch darüber, dass sie und ihre Eltern jetzt seit vier Jahren auf eine
Aufenthaltserlaubnis warteten, aber nun am Ende doch abgeschoben würden. Angela Merkel erklärte dem Mädchen sachlich, dass Deutschland nicht alle aufnehmen könne. Darauf weinte das Mädchen (Reem).
Merkel ging zu ihr und versuchte sie mit den Worten zu trösten: Du hast das doch prima gemacht.
Der Moderator der Sendung kritisierte Frau Merkel scharf, dass es wohl nicht darum ginge, ob Reem das „prima“ gemacht habe. Frau Merkel bemerkt ihre Fehlannahme und versucht zu korrigieren. Der
Irrtum Merkels entstand durch ihre Erfahrung im Umgang mit Schülern, die sie sicher öfter stotternd und weinend vor Aufregung erlebt hat. Doch der Stachel für Frau Merkel saß tief. In dem Augenblick,
als die Kanzlerin vor Millionen Menschen Mitgefühl und Verletzlichkeit zeigte, wurde sie disqualifiziert, weil sie eine eklatante Fehleinschätzung der Gefühle des Mädchens abgab. Laut
Breithaupt änderte dies radikal die Haltung von Frau Merkel. Aus dem anfänglichen „wir können nicht alle aufnehmen“, wurde ein „wir schaffen das“. Aber der Effekt von falscher Empathie hält nicht
lange.
Darauf aufbauend entwickelt Breithaupt weitere Fehlleistungen bzw. Fehleinschätzungen von Empathie. Selbst ein Sadist muss empathisch sein, denn um das Leiden seiner Opfer zu genießen, muss er wissen und mitfühlen können, was sie durchmachen. Das ist ja gerade der Reiz. Darauf basiert auch die Funktion des Strafens, denn durch das empathische Mitleiden des Bestraften erfährt das Opfer eine Art Genugtuung. Einen anderen Weg gehen die so genannten Helikopter-Eltern oder die Stage-Mütter. Sie erleben ihre empathischen Gefühle dadurch, dass sie ihre Kinder in die Perfektion treiben. Die Identifikation mit den eigenen Kindern ermöglicht ihnen so ein Gefühl von Perfektion. Das gilt dann als empathischer Vampirismus. Die Eltern (aber auch Stalker und Fans) erleben die Originalität, Präsenz, Perfektion als einen Effekt der „glühenden Haut“ im Zustand der Beobachtung. Die empathischen Beobachter sind hier nicht an den komplexen Gefühlen der beobachteten Person interessiert, sondern nur an diesen erhebenden Momenten der Perfektion. Den Abschluss dieser großartigen Studie bildet eine Analyse von Donald Trump. Breithaupt bezeichnet ihn als Meister der Empathie, da er es immer wieder schafft, seine eigenen Fehlleistungen zu kontern und in einen Angriff der Stärke umzumünzen. Gerade weil Trump so unvollkommen ist, gibt es für ihn eine Parteinahme (Architektur der Empathie). Und durch seine freche und dominante Art diese Fehler zu kontern, fühlt sich der empathische Beobachter erhoben. Hier ist einer, der ist wie ich, aber er zeigt Stärke. Trump hat also keine Wähler, sondern Fans.
In der Summe also eine sehr erhellende und tiefgründige Studie über dieses doch ziemlich missbrauchte Wort „Empathie“.
11. Juli 2018
Der Gedankenspieler
Von Peter Härtling
erschienen im Verlag KiWi 2018
Der alte Mann und das Creatinin, könnte man einen berühmten Buchtitel travestieren. Das Problem solcher Texte ist allerdings nicht, dass sie schlecht geschrieben wären, keineswegs. Das Problem ist der Grenzgang. Die Spätmoderne ist eine Welt der optimierten Körper, zumindest dem Wunschtraum optimierter Körper, denn die meisten sind hässlich. Daher wirkt es wohl befremdlich, dem Verfall, der Hinfälligkeit und der Peinlichkeiten von Hinfälligkeit lesend beizuwohnen. In den 1920er Jahren betrug die durchschnittliche Pflegezeit alter Menschen ca. 3 Monate. Heute kann man sich darauf einstellen, etwa acht Jahre lang als Pflegefall zu leben. Fast so lange, wie man die Schule besucht. Und Gnade ist es, wenn man kognitiv noch so beieinander ist, wie Johannes Wenger in Härtlings finaler Geschichte. Der Briefe denkende und manchmal schreibende, seine von der Natur integrierte Obsoleszenz fast überschrittene Leiblichkeit ertragende Wenger kämpft um seine Eigenständigkeit. Dabei lernt er zwischen Freundschaft und Abhängigkeit zu unterscheiden. Der gelernte Architekt wird als unzugänglich, zurückgezogen lebend und misstrauisch beschrieben, aber wir erleben im Text einen alten Mann, der in dauernden Gesprächen und Selbstgesprächen nicht aufhört zu denken. Seine Beobachtungen sind stets seine Beobachtungen. Härtling bleibt konsequent an der Figur, so dass man gelegentlich vergisst, dass es keine Ich-Erzählung ist. Vielleicht ist das ein kleines Manko der Story. Denn Mailänder, sein Hausarzt, Karola und sogar die kleine Katharina werden nur bedingt lebendig. Es ist eine Gedankenprosa. Manchmal dachte ich beim Lesen sogar an Samuel Beckett und seinen wunderbaren „Namenlosen“, den Schlussakt seiner Trilogie (Molloy, Malone stirbt, der Namenlose), wo Beckett einen denkenden Mann beschreibt, der in einem Zimmer liegend von irgendwelchen Leuten versorgt wird. Um als beständig Denkender und Wahrnehmender nicht verrückt zu werden, ist die Kohärenz der Welt jene Illusion, die uns dialektisch zwischen Entfremdung und Authentizität schwankende Gestalten am Leben erhält. Wengers Leben ist wie jedes Leben ein fragmentarisches Zwischendrin. Und all die Häuser und Kunstwerke, die ewige Musik, diese uns umgebende standhafte Welt schwindet und schwindet. Wenger verdankt diesem edlen Arzt Dr. Mailänder nicht nur ein Stück Gesundheit, sondern auch ein Stück Weltzugriff. Sogar mit in den Urlaub mit seiner neuen Freundin nimmt er den alten Mann. Auch Karola nimmt sich dem schwierigen Zeitgenossen an. Die meisten Menschen in der Geschichte sind wohlwollend. Aber es sind trotzdem alles Fremde. Denn „wie überhaupt am Rand der Reise Menschen fehlten, bekannte Personen. Sie haben mich im Stich gelassen…“ beschreibt es Wenger (Seite 51). Dabei ist Wenger – was er von sich selbst auch weiß – ein Isolationist. Die Farbe des Schicksals mischt sich aus lauter freien Entscheidungen. Und der Rest ist Gewohnheit. Die vielen Rituale unseres Lebens, die uns Halt geben. In diesen immer gleichen, bewährten Handlungen ist unser Zentralgestirn – das Hirn – unser freister Stern im Himmel. Der Mut eines alten Mannes, der mit dem Rollstuhl in eine Kneipe fährt, um sich dort zu betrinken – oder ist das Torheit? Wenger wird sich nicht umbringen. Dazu ist er nicht der Typ. Er erwähnt zwar Hermann Burger, der einen Tractatus logico-suizidalis schrieb (in Anlehnung an Wittgenstein) und sich mit 46 Jahren umbrachte, aber dieser Burger schrieb auch einen Roman, der ausschließlich den Genuss des Zigarre Rauchens im Zentrum hat. Um eine Hoyo de Monterrey, um eine Cohiba herum schrieb dieser Burger seinen schönsten Roman. Die Geister des Johannes Wenger sind aber vor allem die Architekten, von Mies van der Rohe bis Kurt Ackermann.
Peter Härtling schrieb: „Wir gleichen dem namenlosen Wanderer. Wir wandern nicht mehr, um
anzukommen, wir sind unterwegs in einer frostigen, auskühlenden Welt.“ ( Peter Härtling in Der Wanderer, 1988). Peter Härtling musste im Alter von 12 Jahren mit ansehen, wie seine
Mutter von einem russischen Soldaten vergewaltigt wurde. Drei Jahre später nahm sich seine Mutter das Leben. So etwas prägt, könnte eine tief verwurzelte Daseins-Aufgeregtheit schaffen. Und es schuf
einen Dichter, der ein reichhaltiges Leben geführt hat. Wie viel Wenger befindet sich also in Härtling? Oder wie viel Härtling in Wenger? Es befindet sich weit mehr Härtling in Wenger, als Wenger in
Härtling. So viel ist sicher. Das ist so bei Schriftstellern. Ihre Figuren sind weit mehr sie selbst, als sie selbst ihre Figuren sind. Härtling schrieb Kinderbücher, Romane, Hörstücke, Essays,
Gedichte, über 20 Schulen in Deutschland tragen seinen Namen.
Das letzte Abenteuer seiner Figur Johannes Wenger ist wenig spektakulär. Travemünde ist noch das größte Abenteuer. Die Körperlichkeit zu überwindend bedeutet für den Flüchtlingsjungen Härtling:
"In mir steckt immer noch der aufmüpfige, oft von Melancholie-Anfällen heimgesuchte Junge, der was will, der etwas entwerfen will. Und jedes Mal, wenn ich, wie jetzt auch bei dem Verdi-Buch,
beginne, spüre ich, wie der Junge in mir zufrieden ist, wie er mitmachen will." Das Abenteuer, ein Buch zu schreiben ist geprägt von viel Sitzfleisch, Ausdauer und Willenskraft. Doch ohne
Bewegung gibt es keinen Text. Stellt man sich beim Schreiben die Frage, ob das jemand lesen will, muss man als Schriftsteller konsequent „nein“ antworten. Dieses Risiko sollte man also meiden.
Besser wäre es, Autos zu produzieren. Denn ein Auto will jeder. Die menschliche Obsoleszenz unterscheidet sich von dem Versagen einer Maschine. Und das liegt an der Freiheit unserer Gedanken.
Vielleicht steckt ja doch mehr Wenger in Härtling, als zuvor vermutet. Insofern sich Wenger diese Freiheiten nimmt und sogar bei der Entgiftung seines Körpers eine Kirche erbaut. Allein mit seinen
Gedanken. Noch einmal: Das ist das zentrale Thema in Becketts Roman „Der Namenlose“. Dort erfindet der namenlose Icherzähler Geschichten, arbeitet sich an seinen Geschichten ab. Korrigiert sich,
bestraft sich, wenn es ihm nicht gelingt, seinen Geschichten den nötigen Drive zu geben. Aber er gibt nicht auf. Die geringste Kleinigkeit in seiner kleinen Zimmerwelt ermöglicht Gedanken, evoziert
Geschichten. Die mangelnde Konsistenz eines Johannes Wenger zu beklagen, ist nicht nötig. Die Welt tanzt vor unseren Augen. Wenn wir obsolet werden ist dieser Tanz der Welt der große
Trost.
19. Juni 18
Frankenstein
von Mary Shelley
Aus dem Englischen von Karl Bruno Leder und Gerd Leetz
erschienen im Insel-Verlag 1988
Erstmals im Original „anonym“ erschienen im Jahr 1818
Das Jahr 1816 gilt als „Jahr ohne Sommer“, mit Kälteeinbrüchen in der ganzen Welt,
Ernteausfällen, Hungersnot, extremem Preisanstieg für Getreide und mehr Dunkelheit als sonst. Es war Folge des Ausbruchs des indonesischen Vulkans Tambora ein Jahr zuvor. Immerhin verdanken wir
diesem indonesischen Vulkan die Erfindung des Fahrrads (Draisine, das Ur-Fahrrad) aufgrund des Pferdesterbens infolge der Futtermittelknappheit.
Unter dem Eindruck dieser klimatischen Katastrophe trafen sich bei stürmischem Wetter im Mai 1816 eine Gruppe Engländer am Genfersee, einem malerischen Ort der französischen Schweiz. Lord Byron
(Hauptvertreter der englischen Romantik und guter Freund Goethes) hatte sich dort mit seinem Leibarzt Polidori in der Villa Diotati eingemietet. Zu Besuch waren auch Mary Godwin, ihre Schwester
Claire und der romantische Dichter Percy Shelley. Da es stürmte und kalt war, konnten sie das Haus nicht verlassen. Daher saßen sie beisammen und rauchten Laudanum, lasen deutsche Schauergeschichten
und sprachen über okkulte Phänomene, unter anderem auch über die Versuche von Erasmus Darwin (Großvater von Charles Darwin) aus toter Materie lebendige zu machen oder über den populären Galvanismus.
Tatsächlich gelang dem Chemiker Friedrich Wöhler im Jahr 1828 erstmals, aus anorganischem Material (Oxalsäure) den organischen Harnstoff zu synthetisieren. Der Beginn der Biochemie. Goethe hat ihm im
zweiten Teil der Tragödie Faust (Akt II /Laboratorium) ein Denkmal gesetzt, als Wagner gerade den Homunculus (kleines Menschlein) schuf. Es leuchtet! Seht!... Durch Mischung den Menschenstoff
gemächlich komponieren, in einen Kolben verlutieren und ihn gehörig kohobieren, so ist das Werk im stillen abgetan.
Die vom Laudanum berauschten Engländer beschlossen (unter dem Eindruck heftigem Donnerns und Blitzens) jeder solle eine Schauergeschichte aufschreiben.
Auch Mary Godwin – gerade mal 18 Jahre alt - versuchte es. Aber es gelang ihr erst nicht. Nachts träumte sie aber dann ihre Geschichte von einem exzessiven und leidenschaftlichen Wissenschaftler, der
einen Menschen aus Leichenteilen schuf und mit Hilfe von Galvanismus zum Leben erweckte.
Ein Jahr später heiratete Mary Godwin Percy Shelley. Sie hatte bereits ein Kind von ihm. Und wieder ein Jahr später erschien dann anonym dieser weltberühmte Roman „Frankenstein – oder Der moderne
Prometheus“. Neben der Mythos bildenden Entstehungsgeschichte des Romans bis zum Romanthema selbst (den Tod überwinden) entstand eine unwiderstehliche Mixtur, die Generationen antrieb Film- und
Literaturgeschichte zu schreiben. Der Roman ist einerseits ein Briefroman (in dieser Zeit eine beliebte Form) und andererseits eine klassische Ich-Erzählung. Der leidenschaftliche und ehrgeizige
Polarforscher Robert Walton schreibt Briefe an seine Schwester. Den Inhalt hat ihm Viktor Frankenstein diktiert, den er zuvor aus dem ewigen Eis fischte, als dieser gerade Jagd auf sein Geschöpf
machte. Frankenstein erzählt Walton nun die leidensvolle Geschichte seiner persönlichen Verirrung, seiner Hybris. Als weiteren Binnentext erzählt (11-16) das namenlos bleibende Monster seine
Geschichte. Das Ende des Romans gehört wieder der Stimme Waltons. Denn das Monster ist auf dem Schiff und tötet seinen Schöpfer Frankenstein, um dann in die Nacht zu verschwinden.
Das Monster löschte damit die letzten Spuren seiner Schöpfung aus. Zuvor schon ermordete das Monster Frankensteins Anhang, auf dem Höhepunkt sogar seine Frau Elisabeth in der Hochzeitsnacht. Liebe
und Tod verschmelzen hier symbolisch. Das ungeliebte und gefürchtete Monster wollte nur Liebe und Zuneigung erleben. Doch sein abstoßendes Äußeres verhindert, dass die Menschen in seine wahre Seele
blicken können. Und auch hier ein romantisches Thema: Schönheit und Moral werden zu einer Einheit. Doch – Frankenstein erkennt es selbst (Kap 9: Schließlich war ich, wenn auch nicht dem Tun, so
doch der Ursache nach der wahre Mörder!) – der wahre Mörder ist der Schöpfer selbst. Die Ursache des Bösen liegt im Akt der Schöpfung. Alle Menschen um Frankenstein werden als durch und durch
tugendhaft geschildert, besonders Justine, deren Schicksal es ist, zu Unrecht beschuldigt zu werden, Wilhelm getötet zu haben und hingerichtet wird. Auch Viktor bezeichnet seine Motive als
tugendhaft. Und das ist das große Dilemma von Schöpfungen. Von der Genetik bis zur Transplantationsmedizin, von der Chimären-Wissenschaft bis zur KI-Forschung. Das Erkenntnisstreben der Wissenschaft
ist weder böse noch gut. Mary Shelley operiert in ihrem Roman vor allem mit dem Begriff der Tugend. Die Tugend ist eine Charaktereigenschaft, die sich aus dem Verstand und dem Herzen bildet. Und
tugendhaft war immer schon das Schöne und Leistungsfähige (Ergon-Argument bei Aristoteles). Klar wird dies in den Schilderungen der Entstehung des Monsters. Frankenstein zieht sich zurück, arbeitet
allein in einem Kellerraum als Werkstatt. Er verliert dabei immer mehr an Lebenssubstanz, wirkt am Ende völlig ausgezehrt und fällt durch den Schock darüber, was er geschaffen hat in einen tiefen,
unruhigen Schlaf. Er bereut, verurteilt sich selbst und weigert sich trotz der grausamen Konsequenzen, dem Monster eine Monster-Gefährtin zu erschaffen. Was nützen uns die Wissenschaften? Da kommt
eine Menge zusammen. Das Monster ist immerhin sehr stark und kann unter widrigsten Bedingungen überleben. Auch erweist es sich als überaus intelligent, bringt sich selbst durch bloßes Beobachten
lesen und schreiben bei, entwickelt aus sich heraus eine Urteilskraft. Wären die Menschen nur nicht so ängstlich und hätten sie ihre Vorurteile abgelegt, dem Monster die nötige Zuneigung geschenkt,
ihm einen richtigen Namen gegeben, eine Gefährtin dazu, wäre das Monster dann nicht sehr nützlich geworden für die Menschen? Die gesamte KI-Forschung argumentiert mit der Nützlichkeit, den
Anwendungsmöglichkeiten ihrer Schöpfungen. Aber das ist zu einfach. Das Geschöpf verfolgt eigene Ziele. Und wer garantiert uns, dass die KI sich nicht beim geringsten Widerstand des Menschen selbst
wehrt und seine eigenen Ziele rücksichtslos verfolgt, so wie das Monster von Frankenstein? Frankensteins größtes Versagen war der Moment, als er seine eigene Schöpfung nicht ertrug (Kapitel 5). Für
dieses Ziel, Leben zu schaffen hatte er sich der „Ruhe und der Gesundheit beraubt“, und vor seinen Augen „schwand die Schönheit des Traumes, und namenloses Entsetzen ebenso wie Abscheu erfüllten“
sein Herz. „Unfähig, den Anblick jenes Wesens zu ertragen, das ich erschaffen hatte, stürzte ich aus dem Raum…“. Frankenstein übernimmt keine Verantwortung, lässt seine eigene Kreatur im Stich. Alles
geschieht in dunkler Nacht, es regnet, es ist November, alles ist trüb. In diesem Zwielicht entsteht die Kreatur. Das Zwielicht verweist geradezu auf die Indifferenz von gut und böse. Denn das
Monster ist alles andere als böse, sondern schildert durch und durch menschliche Gefühle. Während Frankenstein sich selbst isoliert, wird das Monster durch sein Äußeres isoliert. Somit ist es auch
ein typisches Spiegelphänomen, das ja zur Ausstattung der Romantik dazu gehört. Der Spiegel war immer schon das Bindeglied zwischen den parallelen Welten. Und das Monster tritt so aus dem Innersten
Frankenstein ins Äußere. So werden Monster gemacht. Aus den Tiefen der Hölle, aus den untersten Schächten unserer Seele entspringen sie. Aber das Plädoyer, diese Schächte zu vernageln, abzusperren,
würde uns auch unseres Besten berauben. Vor allem würde eine Unterdrückung dieser Kräfte den Dualismus von gut und böse geradezu bekräftigen. Und das wäre meiner Ansicht nach ein Fehler. Noch
mal: Das Monster von Frankenstein ist nicht böse. Es ist unglücklich. Aus Isolation, Unverstanden sein und unerfüllten Bedürfnissen setzt es sich zusammen. Die Negation des Monsters macht es erst
monsterhaft. Daher erstarren wir vor dem Haupt der Medusa nicht, weil wir es anblicken, sondern weil wir den Anblick nicht ertragen. All die Figuren des Romans wirken durch die Existenz des Monsters
kränklich und geschwächt. Nur der blinde alte De Lacey (Vater von Felix) redet frei und ohne Angst mit dem Monster und erkennt das Leiden. „Verzweifeln Sie nicht. Ohne Freunde sein heißt wahrlich
unglücklich sein, aber die Menschen kennen durchaus Nächstenliebe und Mildtätigkeit, wenn sie nicht gerade in offensichtlichem Egoismus gefangen sind. (Kap. 15).“ Er weiß es nicht besser. Er sieht es
nicht. Zum Ende ruft auch er „Großer Gott, wer sind Sie?“ und schon erscheint Felix und greift das Monster an. Unerfüllte Bedürfnisse haben den Effekt, immer dominanter zu werden, bis sie uns ganz
beherrschen. So wird das Monster durch seine Sehnsucht nach Freunden und nach Liebe verzehrt. Und so wird die Liebe monsterhaft und erdrückt die Geliebten vor lauter Gier und Sehnsucht nach
ihnen.
Am schönsten finde ich an dem Roman, dass es ein offenes Ende gibt. Das Monster flieht in die Nacht hinaus. Wohin? Was wird es als nächstes machen? Der Schöpfer ist ausgelöscht. Wird es nun wie ein
Gespenst ziellos und einsam umherirren? Oder kehrt es zurück, übernimmt die Herrschaft und stiehlt sich auf diese Weise seine Bedürfnisse? Wird es dann weitere Monster erschaffen und werden diese
Epigonen Reformen einführen? Sind Monster unter sich eigentlich noch Monster? Stammen wir alle nicht von Barbaren ab?
Shelleys Roman wurde durch das Kalkül der dramaturgischen Logik des Horrors auf bloße Effekthascherei reduziert. Schockwirkung, Inszenierung und ausladende Kulissen prägen das Horror-Genre. Aber bei
einem genaueren Blick auf den der Handlung zugrunden liegenden Stoff des Schauerromans, erkennen wir darin die Eigenschaften des Unheimlichen. Raum, Zeit und Menschen kehren sich in Ungewohntes,
Grauenerregendes um. Der Schauerroman hat seine tiefen Wurzeln in der Natur. Die düstere Landschaft, unheimliche Geräusche und unheimliche Gestalten sind ihr Rezept. Dramaturgisch geht es um den
Bann. Kann das Grauen, das Unheimliche gebannt werden, in seine Schranken gewiesen werden? Oder brechen die Dämonen hervor. Es ist eine andere Welt, eine unheimliche zweite Welt in die der Held
eindringt, absichtlich oder unabsichtlich. Daraus ergeben sich die dramaturgischen Fragen. Wird der Held vom Grauen verschlungen, verwandelt (Werwolf), wird er das Grauen daran hindern können,
voranzuschreiten (Dracula). Der Leser fragt: Kann das Böse gebannt werden? Wird der Gute verschlungen bzw. gibt es eine Wandlung (gut in böse oder böse in gut)? Was wird aus den
Monstern?
06. Juni 18
Die Brücke über die Drina
Von Ivo Andric
aus dem Serbokroatischen von Ernst E. Jonas
Verlag Süddeutsche Zeitung
Als 1992 serbische Truppen und Paramilitärs wie die Ostvetnici (weiße Adler) in Višegrad einmarschierten, töteten diese neofaschistischen, paramilitärischen serbischen Kampftruppen über 3000 Moslems, vernichteten sämtliche Gedenkstätten von Ivo Andric, verbrannten seine Bücher und erklärten Andric zum Urheber des Hasses gegen die Bosniaken. 20 Jahre später ließ der serbische Regisseur Emir Kustorica eine ganze Filmkulisse namens „Andricstadt“ dort erbauen, die inzwischen Reisegesellschaften wie „ex oriente lux“ als begehrtes Reiseziel anbieten. Višegrad und seine berühmte Brücke über die Ivo Andric schrieb, sind immer noch da. Ivo Andric hat ein Buch geschrieben, dessen Hauptheld nicht menschlich ist, sondern aus Stein. Weiß-rosa bearbeiteter Kalkstein, mit 12 Pfeilern und 11 Bögen, 180 Meter lang und 6 Meter breit – ein Meisterwerk der damaligen Baukunst. Erbaut von Großwesir Mehmet Pascha in sieben Jahren von 1571 bis 1578. Als der grade 15 Jahre alte Bauernjunge Mehmed Pascha Sokolović mit den türkischen Janitscharen die Drina überquerte, gab es noch einen Fährmann. Damals im Jahr 1516 soll der spätere Großwesir Mehmet Pascha – so Andric – erstmals ein Bild von der Brücke vor seinem geistigen Auge gesehen haben. Im Rahmen der Knabenlese (türkisch: „devşirme“, eigentlich „Sammlung“), die alle drei bis vier Jahre erfolgte, und die Sultan Murad I. in der Mitte des 14. Jahrhunderts im Osmanischen Reich eingeführt hatte wurden Jungen aus christlichen Familien in osmanisch verwalteten Regionen nach Istanbul gebracht, im islamischen Geist erzogen und ausgebildet. Der Gründer der Janitscharen, des „neuen Korps“ von in der Provinz gesammelten und in Istanbul ausgebildeten Soldaten, Kara Halil Hajredin Pascha Tschadarli, hat in einem diplomatischen Dokument aus dem 15. Jahrhundert die klare Haltung der osmanischen Behörden gegenüber der Berechtigung der Knabenlese dargestellt: „Das Volk in den eroberten Gebieten wird als Sklave der Eroberer betrachtet, denen es als ihr Besitz gehört, ebenso wie die Güter des Volkes, seine Frauen und Kinder.“
Im Roman „Die Brücke über die Drina“ hörte der Ladenbesitzer Alihodscha Mutevelić, ein weiser
alter Stadtbewohner, der sein ganzes Leben ein ergebener türkischer Untertan war, im Frühherbst 1908 den Erlass des Kaisers und Königs Franz Josef über die österreichisch-ungarische Annexion
Bosniens, ungläubig, „mit etwas geöffnetem Mund und gesenktem Kopf“, und er hörte dabei zum wiederholten Male einen kaiserlichen Erlass, andere, und doch die gleichen „kaiserlichen Worte“: „der in
die Furchen des aufgepflügten Bodens geworfene Same“, „die Sorgen des Thrones“, „die Einführung von Verfassungsmäßigkeit im Lande“, „der Leitstern Unserer Regierung“… Er hörte die Worte, die er
einzeln für sich nicht verstand, aber deren Sinn ihm auf einmal klar vor Augen stand: „Hier rufen sich Kaiser über Länder und Städte und über die Köpfe ihrer Völker hinweg etwas zu. Und ein jedes
Wort im Erlass eines jeden Kaisers wiegt schwer. Länder werden zerrissen, Menschen verlieren ihren Kopf. Daher sagt man ‚Same … Stern … Sorgen des Throns‘, damit man die Dinge nicht bei ihrem
richtigen Namen rufen und sagen muss, wie es ist: dass Länder und Gebiete, und mit ihnen lebendige Leute und ihre Siedlungen, wie Kleingeld von Hand zu Hand gehen, dass ein rechtgläubiger und
gutwilliger Mensch auf Erden keinen Frieden finden kann, nicht einmal so viel, wie er es für sein kurzes Leben braucht.“
In 24 Kapiteln erleben wir erst den mühsamen Bau der Brücke, eine ausführlich geschilderte Pfählung durch den brutalen türkischen Aufseher Abidaga, erleben die wechselhafte Geschichte der Menschen,
die an der Brücke angesiedelt waren und lebten, Hochwasserkatastrophen, Epidemien, Liebesdramen (Fata aus dem 8. Kapitel zum Beispiel) und immer wieder sitzen die Menschen vor der Kapija (dem
Brückentor), oder auf dem Sofa (Terrasse in der Mitte der Brücke) singend, sich unterhaltend, rauchend. Diese Brücke ist immer da. Bis zum Beginn des ersten Weltkrieges im August 1914. Allein schon
deshalb, weil der Roman einen Überblick hat über 400 Jahre Zeitgeschichte, ist es ein von Weisheit nur so strotzender Text. Die Ereignisse unter den Menschen gehen weitestgehend ohne Schaden an
dieser Brücke vorbei. Dieses tiefere, verborgene und komplexere Symbol der Brücke, hat Andrić bereits in der Weihnachtsnummer 1933 der Belgrader Zeitung „Politika“ angedeutet, wo er in einem Text mit
dem Titel „Brücken“ zum ersten Mal den Gedanken vom Wert und der Bedeutung dieser Bauwerke ausdrückte, die ihn von früher Jugend an faszinierten und die für ihn vor allem Symbol der Sehnsucht
nach etwas anderem, Besserem und Sinnvollerem waren:
„Von allem, was der Mensch in seiner Lebenskraft schafft und baut, ist in meinen Augen nichts besser und wertvoller als Brücken. Sie sind wichtiger als Häuser und heiliger, weil allgemeiner, als Kirchen. Sie gehören jedem und sind jedem gegenüber gleich, nützlich, immer mit Sinn erbaut, an Orten, wo die meisten menschlichen Bedürfnisse zusammenkommen, haltbarer als andere Bauten und sie dienen zu nichts, was geheim oder böse wäre … So findet mein Sinn überall auf der Welt, wohin er sich auch wendet und dreht, treue und verschwiegene Brücken wie die ewige und ewig unerfüllte Sehnsucht des Menschen, alles, was vor unserem Geist, unseren Augen und Füßen auftaucht, zu verbinden, zu versöhnen und zu vereinen … Schließlich: Alles, woran sich unser Leben zeigt – Gedanken, Anstrengungen, Blicke, Lächeln, Worte, Seufzer –, all das strebt zu einem anderen Ufer, auf das es als Ziel hin ausgerichtet ist und an dem es erst seinen wahren Sinn erlangt … Denn alles ist Übergang, eine Brücke, deren Enden sich in der Unendlichkeit verlieren und demgegenüber alle irdischen Brücken nur Kinderspielzeug sind, blasse Symbole. Und unsere ganze Hoffnung ist auf der anderen Seite.“
Damit bekommt dieser Roman (diese Wischegrader Chronik) einen deterministischen Klang. Erst zum Ende wird sie dann beschädigt. Später noch im zweiten Weltkrieg. Und als der Roman von Andric kurz nach dem Krieg erschien, restaurierte man in den ersten Nachkriegsjahren diese Brücke wieder nach dem Original aus dem 16. Jahrhundert. Und im Jahr 2007 erklärte man sie zum UNESCO Kulturerbe.
Ivo Andric wuchs bei seinen Višegrader Verwandten in guten materiellen Umständen auf. Sein Vater war an Tuberkulose erkrankt und starb früh. Schon früh also lernte Andric seine Welt kennen und begleitete seinen Ziehvater Ivan Matkovčik, der Kommandant der Grenzgendarmerie war. So lernte er die kulturelle Vielfalt dieser kleinen Stadt kennen. Andric beschreibt ihn so: „Er war ein außergewöhnlich milder Mann, gebildet, er konnte Deutsch und auch unsere Sprache sprach er gut, hatte eine schöne Handschrift, war von guten Manieren und war den Menschen aus der Gegend gegenüber immer hilfsbereit, die wegen der Nähe der Grenze und den unsicheren Zeiten leicht in Ungelegenheiten kommen konnten.“
Wir schreiten Generationen ab, wie Milan Glasintschanin von Okolischte, der im 12. Kapitel an
der Brücke sitzt und mit dem Teufel Karten spielt, und im 19. Kapitel erleben wir seinen Enkel Nicola Glasintschanin wie er um die Lehrerin Zorka buhlt. Umsonst, denn wie die Osmanen sagen: „drei
Dinge lassen sich nicht verbergen, das sind: Liebe, Husten und Armut“ (Seite 331, Kap. 19). So kann Alihodscha seinen Husten nicht verbergen und sein Tod am Anstieg auf dem Majdan wird den Schluss
des Romans abliefern. Seine Geschichte beginnt im Frühsommer 1878, als die österreichischen Truppen in Bosnien einzogen und 300 Jahre Vorherrschaft der Türken beendeten. Zur Begrüßung der
österreichischen Truppen nagelte Osman Effendi Karamanli das Ohr von Alihodscha Mutewelitsch ans Brückentor. Denn Karamanli wollte unbedingt Widerstand leisten, aber Alihodscha hielt diesen
Widerstand für unvernünftig. „So tauchen immer in der Nähe eines übermächtigen Feindes und vor großen Niederlagen in jeder vom Schicksal gekennzeichneten Gesellschaft brudermordender Haß und innere
Streitigkeiten auf“, schreibt Andric im neunten Kapitel (S. 149) dazu.
Und bedenkt man, wie gleichmäßig und fast ohne sichtbare Spuren (außer dem Verfall der Karawanserei) die letzten 300 Jahre an der Brücke verliefen, beginnt nun eine neue Zeit. Die neuen Herren bauen
eine Eisenbahnstrecke, legen Wasserleitungen, beleuchten die Straßen. Die Menschen „begannen zu Sklaven der Zahlen zu werden und an Statistiken zu glauben“ (Kap. 16 S.279) und „so spülte sich das
Volk das Maul mit großen Zahlen, aber es ward davon weder reicher noch gescheiter.“ Der Einzug des Kapitals in diese Bauernwelt mit überwiegend Moslems veränderte rasch die Oberfläche. Doch
unter der Oberfläche waren die meisten weiter Bauern und einfache Händler. Der Nationalismus blüht auf, Studenten kommen in die Stadt zurück, und schließlich der 15. Juni, der Sankt-Veits-Tag zu
Ehren des heiligen Veit, der von einem Adler genährt wurde, vor den sich die Löwen im Circus Maximus niederlegten und seine Füße leckten, statt ihn zu fressen (wie es Kaiser Diokletian hoffte), und
als man Veit in siedendes Öl warf, kam ein Engel und rettete ihn. „Nach St. Veit wendet sich die Zeit“, heißt es bei den Serben. Doch dieser Sommer war heißer als alle davor.
Ivo Andric bekam 1961 den Literaturnobelpreis als einziger Jugoslawe. Und bis heute ist er Anker und Streitpunkt der panslawischen Seele. Weder Kroate noch Serbe sondern beides wollte Andric sein. Zu
Lebzeiten weigerte er sich, in eine Anthologie serbischer Dichter aufgenommen zu werden und auch als Dichter in eine Anthologie kroatischer Dichter. Noch 2007 zogen die Verwalter um Dragan
Dragojlovic vor Gericht. In die Anthologie „Kroatische Literatur aus Bosnien und Herzegowina in 100 Büchern“ hatten die bosnisch-kroatischen Herausgeber vier Werke von Ivo Andric aufgenommen,
darunter die „Brücke über die Drina“. Die serbischen Rechteverwalter entgegneten, Andric dürfe nicht unter dem Etikett „kroatischer Autor“ publiziert werden. Wer sich selbst und andere kennt wird
auch hier erkennen: Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Und mag die ganze Welt versinken, Hafis, mit dir, mit dir allein will ich wetteifern! Lust und Pein sei uns, den Zwillingen,
gemein! Wie du zu lieben und zu trinken, das soll mein Stolz, mein Leben sein.
23. Mai 2018
Philip Roth ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren an Herzversagen. Auf Portnoys Beschwerden folgten weitere 25 Romane. Der ewige Nobelpreisanwärter blieb am Ende ohne diese Auszeichnung. Aber bedenkt man, dass das Komitee in Schweden so nobel nicht war, ist das vielleicht sogar gut. Nun ist also ein weiterer der ganz großen Autoren von uns gegangen. Nachfolger sind nicht in Sicht, was weniger daran liegt, dass es keine würdigen Epigonen gäbe. Vielmehr prägt die Schnelllebigkeit unserer Zeit auch den Literaturmarkt. Es reicht nur noch für die berühmten fifteen minutes of Fame.
Sein letzter Roman aus dem Jahr 2010 hier noch einmal in einer älteren Besprechung:
Nemesis
Von Philip Roth
Übersetzung: Dirk van Gunsteren
Ich erinnere mich erstaunlich gut an meine Schluckimpfung. Ich sehe den blau eingefärbten Zuckerwürfel noch vor mir. Der Arm, der mir den Würfel reichte, war überraschend behaart. Der Würfel, der haarige Unterarm, die tiefe Männerstimme (die mich beruhigen wollte), die große Sporthalle in der das alles stattfand, die vielen, vielen Kinder und all die Menschen – all das machte großen Eindruck auf mich und machte mir auch Angst. Eine Angst, die angemessen war, wenn man weiß, was die Kinderlähmung anrichten kann.
Der junge Sportlehrer Bucky Cantor erlebt in den 1940er Jahren, was diese Krankheit anrichten
kann. Wegen seiner Kurzsichtigkeit kann der junge Mann nicht wie seine Freunde am Krieg in Europa teilnehmen, er darf keine „Japaner abknallen“, wie sein Schüler Donald es unbedingt möchte. Aber
Bucky erlebt einen anderen Krieg. An der Heimatfront in Newark muss der junge, Sport begeistere Bucky erleben, wie Kinder von einer unheimlichen Seuche dahingerafft werden. Wie gesunde Kinder zu
Krüppeln werden. Hilflos und in einem schwachen Moment sagt er seiner Geliebten zu, ihr nach Indian Hill zu folgen, um dort als Bademeister in einer anderen Welt arbeiten und leben zu können. War in
Newark noch die unerträgliche Hitze und erdrückende Angst vorhanden, so kann Bucky in den kühlen Poconos im Nordosten Pennsylvanias endlich aufatmen. In dem den Indianern nachempfundenen Jugendlager
herrscht eine heitere und lebensfrohe Stimmung. Die Kinder sind gesund und begeisterungsfähig, wie der junge Donald, dem Bucky dabei hilft, seine sportlichen Fähigkeiten zu verbessern. Doch wir Leser
spüren bei aller Heiterkeit und Lebensfreude den dunklen Schatten der Nemesis, jener Göttin des gerechten Zorns, deren stete Begleiterin Aidos (die Scham) ist. Sie, Nemesis, bestraft menschliche
Selbstüberschätzung, sie bestraft die Missachtung des göttlichen Rechts (Themis) und der Sittlichkeit. Bucky ist ein Deserteur. So fühlt er sich immer mehr, je heiterer und glücklicher sein Leben
wird. Er steht auf dem Sprungbrett, die milde Sonne der Poconos auf der nackten Haut spürend, die Liebe seiner zukünftigen Frau Marcia ist ihm gewiss, und doch: Er darf das alles nicht genießen, denn
er hat eine schwere Schuld auf sich geladen, er hat die ihm anvertrauten Kinder in Weequahic (Viertel im Südwesten Newarks) allein gelassen. Er müsste bei ihnen sein. Er müsste bei seiner herzkranken
Großmutter sein. Nemesis ist eine göttliche Richterin. Sie richtet nicht so, dass der menschliche Verstand es begreift. Schließlich erkrankt der junge Schüler Donald an der Poliomyelitis. Plötzlich
ist der dunkle Schatten aus Newark auch in Indian Hill. Und Bucky weiß: Er hat diesen Schatten mitgebracht. Am Ende erkrankt Bucky selbst an der Seuche und sein sportlicher Körper verändert sich.
Roth hat eine Art Gegenroman zu Camus „Die Pest“ geschrieben. In Camus’ Roman sagt Rieux, der Arzt der die Pest bekämpft: „...bei allem handelt es sich nicht um Heldenmut. Es handelt
sich um Anstand. Das ist eine Idee, über die man lachen kann, aber die einzige Art, gegen die Pest anzukämpfen, ist der Anstand.“ Bucky Cantor macht sich zum Vorwurf, dass er genau diesen
Anstand nicht hatte. Vor der Polio zu fliehen, das war unanständig.
Im dritten Teil des Buches erfahren wir, wie Buckys weiteres Schicksal verlief. Bucky bestrafte sich selbst. Er verstößt seine zukünftige Frau, die ihn lieben will, die ihm immer wieder versichert,
dass sie ihn liebt, nicht nur seinen Körper. Aber Bucky will nicht, dass sie ihr Leben einem Krüppel opfert. Er opfert sich selbst. Er lebt schließlich zurückgezogen und einsam, verbittert.
Es ist Arnie Mesnikoff, der uns seine Geschichte erzählt. Wir sind ihm ganz kurz begegnet, im ersten Teil des Buches. Dort war Arnie einer der Kinder, die von der Polio infiziert wurden. Arnie
Mesnikoff wird Architekt. Er macht das Beste aus seiner Behinderung, gründete eine Firma für behindertengerechten Umbau von Häusern und Wohnungen.
Als Erwachsener trifft er ihn zufällig wieder und sie verabreden sich einige Male in einem Cafe wo Bucky ihm alles erzählt (es sprudelte aus ihm hervor).
Philip Roth erzählt mehr als die Geschichte eines jungen Mannes, der an Poliomyelitis
erkrankt. Er erzählt auch die Geschichte eines Zufalls („Jeder Lebensweg ist dem Zufall ausgeliefert; vom Augenblick der Zeugung an regiert der Zufall – die Tyrannei der Umstände – alles“). Menschen
sterben. Im Krieg, an Krankheit. Bucky wird schwer geprüft. Seine Mutter stirbt bei seiner Geburt, sein Vater ist ein Dieb und er wird ihn nicht kennen lernen. Bucky hat aber dann auch viel Glück, er
wächst bei liebevollen Großeltern auf. Bucky ist sportlich, diszipliniert, trainiert fleißig und will Verantwortung übernehmen. Aber das Schicksal hat etwas anderes mit ihm vor. Ich muss an diesen
antiken Sinnspruch denken, den ich gerne mal auf den Lippen habe. Er stammt von einem unbekannten griechischen Dichter. „Den Willigen führt das Schicksal. Den Unwilligen schleift es hinter sich
her.“
Roth erzählt das Schicksal von einem Willigen, den das Schicksal trifft und der es nicht annimmt und der trotzdem nichts dagegen tun kann. Ist es ein Trost, dass Arnie es besser macht? Nein, so
einfach macht es uns der Autor nicht. Auch wenn sich Arnie über Buckys Wut auf Gott ein wenig lustig macht, bleibt ja doch das Ergebnis. Ob Gott oder irgendeine blinde Macht (der Zufall), wir haben
keinen rationalen Zugang. Nemesis ist die Tochter der Nacht (Nyx). Zeus stellte ihr nach. Scham- und zornerfüllt war Nemesis von diesen Nachstellungen. Sie flüchtet vor dem Göttervater, verwandelt
als Fisch, über das Meer bis zum Ende der Welt. Dort verwandelt sie sich in eine Ente. Aber Zeus findet sie, verwandelt in einen Schwan fällt er über sie her und zeugt mit ihr Helena. Nemesis ist die
Mutter der Frau, um derentwillen schließlich der Trojanische Krieg geführt wurde.
Ich bin mir sicher, dass Roth diese Geschichte kennt und dass dieser Mythos für seinen Roman eine Rolle spielte. I’ll Be Seeing You singt Jimmy Durante, In All The Old Familiar Places. Buckys Mutter starb bei seiner Geburt, sein Vater war ein Dieb! Das ist einer Nemesis würdig.
Roth schließt diese berührende Geschichte, die er gewohnt souverän erzählt, mit einem olympischen Bild. Wir erleben den jungen Sportlehrer noch einmal in seiner ganzen würdevollen Pracht beim Speerwurf. „Wenn er, den Speer hoch erhoben, anlief, mit dem Wurfarm weit ausholte, ihn über die Schulter nach vorn riss und den Speer wie in einer Explosion losließ, erschien er uns unbesiegbar.“
Ich selbst gehörte ja mit zu denen, die Glück hatten. Als ich zur Welt kam, gab es bereits die
Schluckimpfung, ein Lebendimpfstoff mit abgeschwächten Erregern. Heute wird diese Impfung mit Totvakzinen durchgeführt als Injektion, denn es gab mit dem Lebendimpfstoff Zwischenfälle. Heute gilt die
Polio beinahe als ausgerottet. Die letzte größere Erkrankungswelle gab es 2010 in Tadschikistan. In Amerika unter den Amischen und auch vor einigen Jahren bei strenggläubigen Calvinisten in den
Niederlanden. Sie lassen sich aus Glaubengründen nicht impfen.
Aber Nemesis hat viele Mittel, ihren gerechten Zorn walten zu lassen.
15. Mai 2018
Fürsorgliche Belagerung
Von Heinrich Böll
Erstmals erschienen 1979
im Verlag Kiepenheuer & Witsch
„Alles führt mit Notwendigkeit zurück zu Heinrich Böll: alle Rückschau über deutsche
Schriftsteller und Bücher zwischen 1945 und 1985“, schrieb der gelernte Jurist und Literaturhistoriker Hans Mayer in seinem zweibändigen Werk Die unerwünschte Literatur. Mit dem Tode von
Heinrich Böll ging für Hans Mayer eine Entwicklung zu Ende, das er vor allem unter dem Titel Frauen vor Flußlandschaft (über die Bonner Republik) subsumiert sah. Eine Entwicklung
politisch engagierter Literatur, die seitdem in Deutschland fast keine Bedeutung mehr hat. Und Fürsorgliche Belagerung bekam schon miserable Kritiken. In der illustrierten Geschichte der
deutschen Literatur von Naumann & Göbel aus dem Jahr 1998 heißt es über Bölls Literatur dann auch folgerichtig: „Dass Gesellschaftskritik auf der Basis einer Moral, die allein auf die
Freiheit des Individuums zielt, komplexe Zusammenhänge nicht mehr erfasst, sondern in der Reduktion auf einfacher zu handhabende Gegensätze sogar verschleiert statt aufklärt, zeigt nicht zuletzt
Bölls Buch Fürsorgliche Belagerung. Dort bekam Böll das Problem des Terrorismus und seiner Folgen wie Hintergründe nicht in den Griff, weil er individualisierend verfuhr und einen Ausweg nur
in die Idylle zeigte.“
Böll führt uns in der gewohnten Weise in Faulkner-Manier (wechselnde Perspektiven durch erlebte Rede dargestellt) Deutschland als Großfamilie vor Augen. Heute ist der Terror internationalisiert und
da es auch keine Großfamilien mehr gibt, kann man auch nicht mehr die Wurzeln des Terrors darin erkennen und in der Freud’schen Variation in der Familie die Wurzel des Terrors erkennen. So kann man
auch in diesem vielleicht nicht ganz so geglückten Roman von Böll den bourgeoisen Abgesang erleben. Pietistische Kirchenlieder begleiten diesen Abgesang formal. So nannte Rudolf Augstein seine Kritik
noch „Gepolter im Beichtstuhl“, und schreibt süffig: „Bölls treue Leser werden auch in Fürsorgliche Belagerung wiederfinden, was sie an ihm haben. Mich, das muss ich gestehen, langweilt dies
ganze Beicht- und Pfarrköchinnen-Lamento allmählich; und bin doch selbst als Kind x-mal gefragt worden, ob ich Unkeuschheit begangen hätte, ‚allein oder mit anderen‘. Hier verläuft, um Gerhard Mauz
zu zitieren, die Front nicht mehr.“
Und ist doch die Familie immer noch die Radix der Revolte. Und wer wie Fritz Tolm (das Blättchen –vermutlich WAZ) in seiner Kindheit „eine kommunistische Wärme“ diesmal in einer Moschee wahrnimmt,
wer vom politischen Wahn in den religiösen Wahn hinüber gleitet, der kommt doch von einer Familie. Es ist heute, 40 Jahre nach dem deutschen Herbst wieder vorwinterlich im Staate Dänemark. Zuletzt
hat das Polizeiaufgabengesetz die Menschen wieder aufgeschreckt. Von der durch unsupervised Algorithmen gesteuerten gesichtserkennenden Kamera bis zum RFID Chip im Personalausweis, einer
automatischen und berührungslosen Identifizierung, oder DNA-Untersuchung bei „drohender Gefahr“ (was zum Teufel ist das?) die dann automatisch ermöglicht in der Post der Bürger zu schnüffeln ist die
technische Möglichkeit Vorgefühl des perfekten Polizeistaates. Insofern macht es fast glücklich, dass Hendler (der Polizist) noch heimlich mit Sabine Tolm Sex haben kann ohne tatsächlich entdeckt zu
werden. Dennoch ist in dieser Heimlichkeit schon mehr geahnt, als die etwas kurzsichtigen Kritiken an Bölls Roman wahrnehmen wollten. Der ganze Roman wirkt verdruckst, schwächelt sich dahin in
intimem Geröchel. Und da gibt es zum Teil wirklich starke Szenen. Zum Beispiel als Fritz Tolm seine Freude an Vögeln verliert, weil sie Unheil bringen könnten, mechanisch sein könnten, ja die
mechanischen Vögel könnten sogar wirklicher aussehen, als die wirklichen Vögel selbst. Hier verwischt allmählich der Zugriff auf die Realität. Eine Gesellschaft die komplett überwacht wird, ist kaum
noch ernst zu nehmen. Und heute spielt es tatsächlich kaum noch eine Rolle, ob wir bewacht oder überwacht werden. Das Opfer, das vermeintliche Opfer – der unbescholtene Bürger – verliert seinen
Zugriff auf die Realität, weil er sich stets so verhalten muss, als würde jemand ihn beobachten. Dieser „Big Brother“ macht uns zu überangepassten immerzu misstrauischen Angstwesen. Und während des
Lesens spürte ich bei allen Protagonisten diese Angst. Dabei wachsen die Begehrlichkeiten der Überwacher („diese verfluchte Zone zwischen Sicherheitsnotwendigkeit und Diskretion“ Seite
179,Holzpoke).
Ja sicher hat Rudolf Augstein auch irgendwie recht, wenn er schreibt: „Wenn die handelnden Personen Pliefger, Blörl, Holzpuke, Picksehne, Plotzkehler und Zurmack heißen, Plotteti auch wohl, Blurtmehl, Kiernter, Kulgreve, Fottger, Amplanger und Anna Plauck, auch Schneiderplin, Grobmöhler und Peter Kommertz; wenn sie das Cafe Getzloser besuchen und die Boutique Breslitzer, wenn sie handeln oder nicht handeln in Ortschaften wie Horrnauken, Trollscheidt, Blorr und Breterheiden, in Hurbelheim, Hubreichen und in Blückhoven: dann geht die Ahnung wohl nicht fehl, daß wir in einem Roman von Heinrich Böll lesen. Wir betreten geweihten Boden, unheiliges Land.“
Es ist weit weg von heute. Bölls satirische Ader blitzt ab und an auf. Aber manchmal waren die Clowns in dem Text fast zum Heulen.
Im zarten Alter von 19 Jahren stand ich ganz kurz neben ihm in der Mutlanger Heide. Wir haben sogar kurz gesprochen miteinander. Es ist so ärgerlich, dass ich mich an diesen sehr kurzen Wortwechsel nicht mehr erinnere. Aber ich weiß noch, dass ich damals sehr „gefährdet“ war. Auf einem Juso-Parteitag stieg ich auf den Tisch und rief mich selbst zum Terroristen aus. Was für eine lächerliche Posse! Das war schon damals nicht mehr zeitgemäß. Dass ich als Halbwaise damals nichts weiter tat, als nach einem Realitäts-Strohhalm zu greifen, dass das ganze Gehabe nicht im Geringsten politisch war (wie man heute Politik auffasst), dass es mir zum Selbstbefreiung ging, und dass das vielleicht eine meiner mutigsten Aktionen überhaupt war, obwohl so lächerlich und dumm, das nennt man wohl „kurios“. Aber es war ein Versuch, meine eigene Kuriosität abzustreifen.
„Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben“. Und vermutlich geht es in einem derart von Staat und Ökonomie bedrohten System vor allem um die Realität. Um nicht sonderbar, seltsam oder merkwürdig zu werden, muss man sich einmischen. Immer und überall. Das fängt in der Familie an. Am Ende brennt alles ab und Fritz Tolm lacht. Hoffentlich vergeht uns dieses Lachen nicht.
24. April 18
Strafe
Von Ferdinand von Schirach
Erschienen 2018 im Verlag Luchterhand
In seinen ersten beiden Storysammlungen „Verbrechen“ und „Schuld“ bediente sich Ferdinand von Schirach noch realer Vorlagen. In seinem dritten Band musste er auf die Fiktion zurückgreifen (bis auf die letzte Geschichte in dem Band, die als einzige in der Ich-Form erzählt wird), denn der Leser weiß fast immer mehr, als der Richter. So kann der Leser selbst beurteilen, ob die Strafe gerecht war oder nicht indem er die Wahrheit mit dem Urteil vergleicht. Nur im Fall des verkorksten Strafverteidigers Schlesinger könnte es auch anders gewesen sein. Wir müssen uns in „Die falsche Seite“ auf die Beweisführung eines alkoholkranken Strafverteidigers und eines zwielichtigen Killers verlassen.
Das Wort „Strafe“ taucht um das 12. Jahrhundert auf, aus dem mitthochdeutschen Wort „sträffen“, für „mit Worten tadeln“. Tadel, das stammt aus der gleichen Epoche, und es meint körperliches oder geistiges Gebrechen (frühneuhochdeutsch: Taddel). Das kam alles vom „stroffen“, verleumden, vom Spott. Spott, speuzen, spucken, verhöhnen.
Die lateinische Version der Sanktion kommt von sanctio, der Heilung. Also impliziert Strafe Heilung. Wir sind nicht schuldig, sondern krank. Wir bedürfen der Heilung. Dieses Denken kam aus dem lateinischen Wort „sanare“, was den Vorgang der Kastration wilder Tiere beschrieb. Insanus bezeichnet wilde Tiere, die für die Pflugarbeit untauglich sind. Wir haben das im Wort „sanieren“ erhalten. Oder auch im Wort Sanatorium.
Im deutschen Strafrecht (das aus dem 19.ten Jahrhundert – Kaiserreich - stammt) unterscheiden wir zwischen Verbrechen und Vergehen. Dabei ist aber nicht die Tat selbst sondern die Schwere der Tat maßgebend. Ab einem Jahr Freiheitsentzug spricht man von einem Verbrechen, darunter ist es ein Vergehen. Daher kann es für gleiche bis ähnliche Straftaten ein unterschiedliches Strafmaß geben, je nach Schwere der Tat. Zum Beispiel wurde Uli Hoeneß für seine Steuervergehen mit über einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft, und gilt damit als vorbestrafter Verbrecher. Während andere Steuersünder sich nur eines Vergehens schuldig machten. Die Schwere der Tat? Hier wird gewogen, abgewogen. Ikonografische Darstellungen von Justitia zeigen die gerechte Dame daher stets mit einer Waage in der einen Hand und einem Schwert (strafen) in der anderen. Justitia hat zudem die Augen verbunden. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Gewogen werden ihre Taten.
Ferdinand von Schirach spielt in seinen Geschichten immer wieder geschickt mit unseren Bedürfnissen nach Rache, Sühne und Schuldabwehr. Wenn sich bei der Geschichte „Taucher“ am Ende herausstellt, dass die Frau doch ein wenig nachgeholfen hat, geraten wir schon ein wenig ins Wanken ob der sexuellen Perversion des Ehemannes. Im Fall von Lydia ist es wiederum ein sehr weises und abgeklärtes Urteil des Richters und wir hegen überraschendes Mitleid mit dem einsamen Mann, der die Schändung seiner Sexpuppe rächt. Der Verfahrensfehler in der Story „der kleine Mann“ erweckt in uns das Bedürfnis mit unserer Schuld davonzukommen. Die Katharsis glückt und ein gewisses Schmunzeln über das Scheitern der Justiz wird kaum einer verhehlen können.
Von Schirach bedient sich einer so einfachen Sprache und Skizzenhaftigkeit in der Schilderung
der einzelnen Lebensgeschichten (wie im Fall der Schöffin besonders deutlich wird), dass der Leser ein wuchtiges Gefühl von Kohärenz erlebt. Hier wäre der erste Einspruch gegen die Geschichten zu
erheben. Der Strafverteidiger Schlesinger ist ein heftiges Klischee, die chinesische Spielhölle, der mitleidige Killer, das alles sind doch ein wenig Puppen, die von Schirach tanzen lässt. Schon
während des Lesens verfilmt sich der Stoff für eine ZDF-Vorabendserie. Zwar ist für die Katharsis das Klischee des alkoholkranken Strafverteidigers, der noch einmal einen Fall gewinnt, sicher
vonnöten. Die enorme sprachliche Reduktion zugunsten der Dramaturgie macht die Geschichten zu kleinen Kanapees. Nun lässt sich trefflich diskutieren über Recht und Gerechtigkeit. Aber Vorsicht!
Das muss man können. Es ist ein geschultes Auge, das hier beobachtet. Es ist ein geschulter Verstand, der hier die Dramaturgie aufbaut. Alle Storys sind ungeheuer stimmig. Man sollte über die Storys
insgesamt nachdenken, sie nicht nur als einzelne kleine Stücke sehen, sondern als gewebtes Gebäude. Ein klassischer Bau. Die Motive sind heraus seziert und selbst das gotischste Leben wird mit der
Lupe hell und klar. Wenn ein Richter ein kariertes Hemd trägt und eigentlich nicht wie ein Richter aussieht, wird klar, dass Gesetze von Menschen gemacht werden. Die Sprödigkeit der Paragraphen ist
wie eine greifbare Relation zwischen den Menschen aufgestellt. Der Verweis, die Strafe, der Tadel wirkt dabei wie ein formelles Ritual. Immer gleich und - wie es einmal heißt - „langweilig“ verlaufen
die Prozesse, die Sprache der Justiz ist ein prosaisches Gelenk, das in die Poesie der Menschen eingebaut wurde. So bewegen sich die Menschen mit ihren Tugenden und Untugenden, ihren Pflichten und
ihrer Pflichtvergessenheit fast ein wenig traumhaft in die Realität des Hammers. Menschen sind verkrümmte, verdrehte Nägel, die kein Hammer richtig in die Wand schlagen kann. Und der stetige Versuch,
es doch immer wieder zu versuchen, erweckt fast ein wenig Mitleid mit der Justiz. Sie wird mit ihrer prosaischen, rituellen Einfältigkeit nicht müde, ihr Bestes zu geben. Das Geschick der Justiz den
Hammer zu schwingen, macht die Justiz damit fast wieder poetisch.
Und manchmal (wie in der Geschichte „Tennis“) folgt die Strafe auf den Fuß, außergerichtlich sozusagen. Wenn die Frau nackt, nur mit der Perlenkette der Betrügerin bekleidet vor ihrem bestraften Mann
steht, bekommt Justitia (römisch) den archaischen Touch von Nemesis (griechisch), der Zuteilerin des Gebührenden („Du bekommst, was du verdienst“). Nemesis bestraft die Menschen nachdem sie Themis
(die göttliche Ordnung und Gerechtigkeit) missachtet haben.
Und manchmal, wenn jede gerechte Strafe ausbleibt, dann bestrafen wir uns selbst. Schließlich ist jeder Täter der wichtigste Zeuge und zugleich der in seiner Wahrnehmung am häufigsten Getrübte. Vielleicht hast du Recht und es gibt kein Verbrechen und keine Schuld, sagte er, aber es gibt eine Strafe.
31. März 18
Affe und Wesen
Original Ape and Essence,
erschien 1948 bei Chatto & Windus,
übersetzt von Herbert E. Herlitschka 1964
Der berühmte Autor der Dystopie „Brave new World“ wurde noch im 19. Jahrhundert geboren. Er war sieben Jahre alt, als Königin Viktoria (1901) starb. Seine düstere Utopie über einen durch Drogen und Verhaltensmanipulation regierten „Menschenpark“ überschattet literarisch sein weiteres Werk. Fünf Jahre weilten die Huxleys in Sanary sur Mer in der „Villa Huley“ (der Maurer hatte das X vergessen). In einem Cafe mit Blick auf den Hafen und im Gespräch mit all den deutschen Exilanten (von Brecht über Feuchtwanger bis Heinrich Mann, Ludwig Marcuse, Franz Werfel) entstand der Abgesang an den Fordismus und den Wunschtraum dass der Fortschritt und die Wissenschaft alles richten könnte.
Als Huxley den Kurzroman Affe und Wesen schrieb, lebte er mit seiner Frau Maria im La La Land der großen Orangen, im San Bernadino County auf 1.800 Meter Höhe. Der Fortschritt hatte inzwischen für die atomare Verseuchung in Japan gesorgt und Hollywood eroberte das menschliche Gehirn. Doch schon zwanzig Jahre zuvor hatte Aldous Huxley seine Gedanken entwickelt. Nach einer langen Weltreise (Indien, Hongkong, Japan und USA) erschien sein Essay „Progress“, wo er die Menschen davor warnte, dass das wirtschaftliche Wachstum teuer erkauft wird und durch Raubbau an der Natur, an Bodenschätzen auf Kosten der zukünftigen Generationen gehen würde. In Affe und Wesen ist es dann so weit. Die Katastrophe, die in dem Roman nur lakonisch „The Thing“, die Sache genannt wird. Ein atomarer Krieg zerstört nahezu alles und verstrahlt die Welt. Schuld: Der Fortschritt und der Nationalismus. Übrig bleibt eine Gruppe Wilder in Kalifornien, die von einer Gruppe Forscher aus Neuseeland hundert Jahre danach aufgestöbert werden. Die Wilden glauben an den großen Belial, den Teufel und verehren ihn als den Verursacher der „Sache“ und beten ihn an, opfern ihm ihre Kinder, damit er sie in Ruhe lässt.
Fortschritt – die Theorie, dass man etwas für nichts kriegen kann; die Theorie, dass man auf dem einen Gebiet etwas gewinnen kann, ohne auf einem andern für diesen Gewinn zu bezahlen;
…Nationalismus – die Theorie, dass der Staat, dessen Untertan man zufällig ist, der einzige wahre Gott sei und alle andern Staaten falsche Götter seien; dass alle diese Götter, wahre wie falsche, die Mentalität jugendlicher Verbrecher hätten und jeder aus Gründen des Prestiges, der Macht oder des Geldes entstandene Konflikt ein Kreuzzug für das Gute, Wahre und Schöne sei.
So alt ist also dieser Diskurs. Während heute im 21. Jahrhundert wieder Säbelrasseln herrscht,
Diplomaten ausgewiesen werden und die Ideologen der Toren laut und schrill die Zeitungsblätter versauen. Was Wunder, dass sich Huxley schon in den 1950er Jahren endgültig der Mystik zuwandte und
schließlich 1962 in seinem Spätwerk eine tropische Insel zum Glückseiland verklärte.
Affe und Wesen ist nicht immer leicht zu lesen. Das liegt vor allem an seinem erzählerischen Aufbau. In einer Art Prolog unterhalten sich zwei Filmschaffende. Es ist der Tag an dem Gandhi
ermordet wurde, als am 30. Januar 1948. In den Mittelpunkt stellt der Icherzähler seinen Freund Robert Briggs. Briggs wird als narzisstischer Drehbuchautor geschildert, der sich selbst als
einen Romantiker sieht und die ganze Zeit über sich redet, während der Ich-Erzähler in Gedanken bei dem ermordeten Gandhi verweilt. Der Diskurs der beiden geht darüber, was Kunst ist, welchen
Einfluss Kunst hat und überhaupt haben sollte. Und während sie sich so unterhalten fährt ein Zweitonner an ihnen vorbei. Er hat Drehbücher geladen, Ausschussware die zum Abfall gehören. Während der
Zweitonner eine Kurve macht fliegt ein Dutzend dieser ausrangierten Drehbücher vom Laster auf den Boden. Der Ich-Erzähler hebt eins der am Boden liegenden Drehbücher auf. Es ist Affe und
Wesen von einem William Tallis, Cottonwood Ranch, Murcia, California geschrieben. Robert Briggs macht sich über „das Zeugs“ lustig. Aber der Ich-Erzähler beginnt zu lesen. Das versteht sich
doch von selbst / weiß es nicht jeder Schuljunge schon? / Zwecke sind affenerkoren! nur die Mittel sind menschlich.
Die beiden beschließen nun, nach Murcia zu fahren und den Autor zu besuchen. Doch er ist bereits tot. Sie erfahren nur, dass dieser Autor Tallis nicht wirklich ein Menschenfreund war.
Das zweite Kapitel zeigt nun das vollständige Manuskript von Affe und Wesen. Die
folgenden Seiten sind ein wenig wie ein Drehbuch geschrieben. Ein Erzähler führt durch die Geschichte. Er unterbricht immer wieder die Handlung und kommentiert sie. Immer wieder streut der Erzähler
auch Gedichte ein. Die Handlung wird so immer im direkten Dialog dargestellt und mit knapper szenischer Darstellung. Längere Zeiträume werden durch den Erzähler überbrückt. Hinweise auf
Kameraeinstellungen (Totale, Halbtotale) erinnern uns immer wieder daran, dass es sich um einen Film handelt. Aber die Story selbst hat einen Sog, und der Erzähler eine Art, die den Leser ansaugt und
in die Geschichte hinein tauchen lässt.
Wir befinden uns im Jahr 2106 etwa hundert Jahre nachdem „die Sache“ passiert ist. Eine Gruppe neuseeländischer Forscher befindet sich auf einem Segelschiff und kommt vor die Küste Kaliforniens. Da
Neuseeland zu abgelegen lag haben sie als einzige nicht mitbekommen, dass „die Sache“ passiert ist. Mit dabei ist der Botaniker Dr. Poole. Als er sich einmal alleine um eine seltene mutierte Pflanze
kümmert, wird er von Wilden entführt. Er lernt nun die primitive Gesellschaft kennen, die sich auf Belial beruft. Alle bekannten religiösen Symbole wurden umgedeutet. In den Gipsfiguren des hl.
Joseph, der Magdalena, des hl. Antonius von Padua und der hl. Rosa von Lima wurden einfach nur rot übermalt und mit Hörnern ausgestattet. Die Menschen sind in festen Strukturen eingebettet. Eine
elitäre Priesterschaft kontrolliert die Arbeiter dadurch, dass sie ihnen jede Form von Sex verbieten. Die Frauen tragen Kleidung die an den Stellen der äußeren Sexualmerkmale ein „Nein“ aufgestickt
haben. Nur an den Belialstagen fallen alle tierisch über sich her. Dort ist es erlaubt. Doch die Kinder dieser Tage sind meist missgebildet aufgrund der Gammastrahlung durch den Atomkrieg. Wenn die
Belialstage vorüber sind, werden alle bestraft. Und wenn die Kinder zur Welt kommen werden sie Belial geopfert. Blut soll die Menschen reinigen und vor Belial beschützen. Der entführte Dr. Poole ist
ein liberaler protestantischer Botaniker, der noch nie mit einer Frau zusammen war. Er liebte seine Mutter. Doch dann verliebt er sich in die Wilde Lula (im Original Loola). Da Dr. Poole sich
vielleicht nützlich erweisen könnte, weil er als Botaniker die chronische Nahrungsknappheit beseitigen könnte, wird er von der Priesterschaft verschont. Aber er soll der Kirche Belials beitreten. Das
aber würde bedeuten, dass er sich kastrieren lassen müsste.
Dr. Poole entschließt sich mit Lula zu fliehen. Von dem Direktor (einem weltlichen Führer, der allerdings unter der Priesterschaft steht) erfährt er, dass sich einige der „Hitzigen“ (so werden alle
genannt, die sich außerhalb der Belialstage nicht beherrschen können) in den Norden abgesetzt haben und dort eine eigene, liberale Gemeinschaft haben. Der Roman endet damit, dass das Liebespaar Dr.
Poole und Lula vor einem Grabstein pausieren. Dort ist ein Gedicht eingeritzt. Dies Licht, das liebeswarm die Welt umfängt / die Schönheit, darin alles wirkt und währt / der Segen, den der Fluch
nichtlöscht, verhängt / uns von Geburt, die Liebe die uns nährt / und durch des Daseins Schleier, blind gewebt / von Erde, Luft und Meer und Mensch und Tier / leuchtet, je mehr zu spiegeln eines
strebt / des allersehnten Feuers, - strahlt nun mir / und letzte Wölkchen Sterblichkeit verzehrt.
Es ist ein Gedicht von Percy Shelley über den Tod seines Dichterfreundes John Keats.
So abgedreht die Geschichte auch wirkt, so tiefsinnig ist sie zugleich. Die Wilden haben
gelernt, nicht mehr selbst verantwortlich zu sein für das Böse. Dafür haben sie nun Belial.
Bei einer echten Symbiose ist eine wechselseitige fördernde Beziehung zwischen zwei vergemeinschafteten Organismen vorhanden. Der Parasitismus jedoch ist dadurch gekennzeichnet, dass der eine
Organismus auf Kosten des andern lebt. Am Ende erweist sich diese einseitige Beziehung als verhängnisvoll für beide Teile; denn der Tod des Wirts muss den Tod des Schmarotzers, durch den er getötet
wurde, zur Folge haben. Die Beziehung zwischen dem modernen Menschen und dem Planeten, für dessen Herrn und Meister er sich bis vor so kurzer Zeit hielt, war nicht die von symbiotischen Partnern,
sondern die des Bandwurms und eines von ihm befallenen Hundes, eines Pilzes und einer schimmeligen Kartoffel.
So trägt es Dr. Poole vor, nachdem er feststellen musste, dass die Nahrungsknappheit selbstverschuldet ist. Sein Heilmittel ist Geduld und Zeit. Aber Ungeduld ist eines der Lieblingslaster Belials antwortet ihm der Priester. Bedenkt man, dass schon Goethes Faust gerade die Geduld verteufelte als er mit dem Teufel seine Wette abschloss, kann man in etwa erfassen worauf Huxleys Gesellschaftskritik abzielt. Huxlys älterer Bruder Julian war ein Vordenker des Eugenik-Gedankens, und Aldous Huxley hat dieses Problem schon im Roman „Schöne neue Welt“ verarbeitet und damit unser Problem einer Massengesellschaft. In seinem Spätwerk „Eiland“ hat er eine positive Utopie kreiert in der freie Sexualität und Geburtenkontrolle eine Harmonie mit der Natur eingehen können. Schon früh hat Thomas Malthus im 18. Jahrhundert die Probleme erkannt. Fast zwei Millionen Menschen Zuwachs pro Woche verursachen vor allem in den kritischen Regionen Nahrungs- und Wassserknappheit. Der Ressourcen-Verbrauch ist längst über dem Limit und eine Bedrohung des Planeten ist spätestens seit 1972 durch die Veröffentlichungen des Club of Rome thematisiert worden. Doch Huxley hat schon 1928 darauf hingewiesen. Man möchte fast glauben, dass wir vom Teufel besessen sind. Wider besseren Wissens… oder wie es die Psychologie so harmlos ausdrückt: kognitive Dissonanz.
Es ist Huxleys Thema. Und als er mit seiner Philosophia Perennis die Spiritualität entdeckte – zugrunde liegt seine Freundschaft mit Krishnamurti – erkennt man schon, dass Rationalität allein keine Lösung ist. Wenn uns ein Engländer dies lehrt, dann bedeutet das was. Die so genannte „positive Psychologie“ entdeckt gerade erst die Bedeutung von transzendenter und vertikaler Transzendenz für den Menschen. Konsum allein macht uns gewiss nicht glücklich. Natur, Gemeinschaft, Fürsorge und Barmherzigkeit, ja sogar Gott. Aber Affe und Wesen bringt es auf den Punkt, wenn der Erzähler das Liebespaar Dr. Poole und Lula so beschreibt: Und so haben diese zwei durch die Dialektik des Gefühls die Synthese des Chemischen mit dem Persönlichen für sich wiederentdeckt, welcher wir die Namen romantische Liebe geben. Bei ihr war es das Hormon, was das Persönliche ausschloß; bei ihm die Persönlichkeit, was mit dem Hormon nicht übereinkommen konnte. Nun aber ist da der Beginn einer größeren Ganzheit.
Diese größere Ganzheit ist paradigmatisch in dem Liebespaar Dr. Poole und Lulu dargestellt, und wir könnten dies auch in der Spiritualität erfahren. Um es mit dem großen Baruch de Spinoza zu umschreiben:
Insofern die Menschen von Neid oder irgendeinem Affekt des Hasses gegeneinander getrieben
werden, insofern sind sie einander entgegengesetzt, und folglich um so mehr zu fürchten, je mächtiger sie sind als die übrigen Individuen der Natur.
Die Herzen werden jedoch nicht durch Waffen, sondern durch Liebe und Edelmut überwunden. (Von der Macht der Erkenntnis, Spinoza)
Die Freiheit, frei zu sein
Von Hannah Arendt
Aus dem amerikanischen Englisch
von Andreas Wirthensohn
erschienen 2018 im Verlag dtv
Eine Revolution ist nicht die Ursache für den Zerfall eines Staates, sondern das Symptom. Daher sind die ideologischen Grundlagen einer Revolution verknüpft mit dem Zerfallsprozess. Und sie sind nicht rückgängig zu machen.
In der Astronomie bedeutet „Revolution“ den Umlauf eines Himmelskörpers um einen anderen. Das läuft dann schön geordnet ab. Früher dachte man sich die Sternlein aufgehängt an einer geschlossenen Kristallkugel. Der Himmel war geschlossen und die Sterne unbeweglich. Dann kamen Kopernikus und Kepler. Der Himmel war plötzlich offen und alles bewegte sich. Da sich die Erde beim Umlauf um die Sonne im freien Fall befindet, also geradezu um die Sonne herum fällt, gelegentlich schwebt um dann wieder durchs All zu fallen, bedeutet der Begriff „Revolution“ auf der Erde nicht Umlauf, sondern Umsturz. So haben die Revolutionäre Frankreich im 18. Jahrhundert die Revolution sprachlich umgedeutet. Bewegt sich alles im Kosmos, bewegt sich schließlich auch der Mensch. Einige Grundbedingungen für einen Umsturz müssen allerdings erfüllt werden:
1. Der Staat hat Probleme bei der Steuer-Eintreibung. Das war in Frankreich Vorbedingung für eine Revolution. Der Staat zentralisierte sich und die Elite scharte sich um den König. Die britische Aktivistengruppe Oxfam hat 2015 einen Bericht herausgegeben, in dem dargelegt wird, dass die reichsten Personen und Unternehmen weltweit 21 Billionen US-Dollar in einem globalen Netzwerk aus Steueroasen vor den Finanzbehörden der jeweiligen Staaten verstecken. In Deutschland wurde jüngst das Grundgesetz geändert. Ab jetzt werden die Steuerdaten in Berlin zentralisiert und die Länder geschwächt. Der Föderalismus wird zugunsten der Steuereinnahmen aufgegeben.
2. Eine Krise der Staatsautorität. Die Staatsvertreter verlieren ihre Legitimation. In Frankreich und ganz Europa stand der Feudalismus unter Dekadenz-Verdacht. In Deutschland gehört es heute zum Allgemeingut unseres Wissens über den Staat, dass die Legislative sich ihre Gesetze von den Lobby-Vertretern der Wirtschaft vorschreiben lässt (was natürlich falsch ist) und zunehmend sinkt bei Wahlen die Wahlbeteiligung. Zuletzt in Frankreich auf unter 50 Prozent.
3. Eine Krise der Wohlfahrt. Im feudalen Europa herrschte eine frühindustrielle Pauperisierung. Auch derzeit erleben wir eine Wohlfahrtskrise. Die technologische Revolution erschafft eine höchst ungesunde Spaltung der Gesellschaft in Arme und ein paar Superreiche. In Deutschland verfügen gerade zehn Menschen über zwei Drittel des Bruttosozialproduktes.
4. Wenn die Eliten sich einig sind, dann wird jeder Versuch der Rebellion selbstverständlich zurückgeschlagen. Zur Krise der Staatsautorität braucht es also noch einen Dissens der Eliten. In Frankreich war das der Fall, als der autoritäre Staat sich zentralisierte und damit den Landadel in Frankreich so schwächte, dass sie ihre Bauern nicht mehr kontrollieren konnten. Ähnlich war es in Russland. Das führte zu einem Dissens im Adel und einige Adlige stellten sich dann auf die Seite der Hungernden. Dass dem Adligen das nichts nutzte und er später trotzdem geköpft wurde, das zeigt, dass „die Revolution meist ihre eigenen Kinder frisst“. Zu diesem Dissens der Eliten muss also hinzu kommen, dass Teile der Elite mit den mittleren und unteren Schichten zusammenarbeiten. Doch das reicht immer noch nicht. Denn es braucht ein letztes wichtiges Element: die entscheidende einigende Ideologie, die verspricht, dass es dann besser wird.
Wir haben gute Voraussetzungen für eine Revolution in Deutschland: Krise bei den Steuereinnahmen, Krise der staatlichen Legitimation, Krise der Wohlfahrt und Krise der Eliten. Fast alles da. Fehlt eigentlich nur das einende Band, die passende Ideologie, die für die abtrünnigen Eliten und den frustrierten Mittelstand und die abgehängte Unterschicht gleichermaßen akzeptabel wäre.
Dies alles traf schon im 18. Jahrhundert zu und die ersten Krisentheorien von Ricardo und Sismondi (Akkumulationskrisen) zeigten später auf, dass die progressive Produktivität der Bourgeoisie vor allem auch Ungleichheit, Armut und Unrecht reproduziert. Auch der Frühsozialist Charles Fourier konnte sich mit dem Gang der Revolution nicht anfreunden. Nach seiner Meinung hatte die Masse des Volks sehr wenig dadurch gewonnen. Viel mehr dagegen hatte die Klasse, die er aufs Tiefste hasste, die handeltreibende Klasse, profitiert. Die Handelsfreiheit als das Ei des Columbus zu rühmen, erbitterte Charles Fourier. „Er hatte gesehen, dass, während die Revolutionäre sich bemühten, mit größter Rücksichtslosigkeit Alles mit blutiger Gewalt niederzuschlagen, was ihren Begriffen von gesellschaftlichem Glück entgegenstand, das Kapital im schreiendsten Widerspruch mit den gepredigten Grundsätzen agirte. Er sah, wie der Güterschacher, der Lebensmittelwucher, die Lieferungsschwindeleien blühten und die neu emporgekommenen und plötzlich reich gewordenen Besitzer ihre Orgien feierten.“ So schildert es August Bebel in seiner Biografie über Charles Fourier.
Doch Freiheit von Unterdrückung und Armut ist die eine Seite. Echte Freiheit benötigt stets eine Freiheit zu etwas. Aktives politisches Handeln ist mehr, als einfach nur zweckorientierter Wohlstand der Nationen. Das gelang bei der US-amerikanischen Revolution (dank Sklaven-Ökonomie und fehlender Akkumulationskrise). Hannah Arendt war immer eine „radikale“ Denkerin. Radikal in dem Sinn, dass sie an die Wurzeln des Denkens geht und an die Wurzel der Sprache. Und diese Wurzeln sind bei Arendt meist antik und wenn sie nicht antik sind, dann sind sie eine Wiedergeburt, sprich aus der Renaissance. Für Arendt ist das Gute immer radikal (lateinisch radix für den Ursprung oder die Wurzel) und tief. Das Böse hingegen ist extrem – und Arendt meint hier den Superlativ des lateinischen Adjektivs exter, zu Deutsch außen - und banal – aus dem französischen Wort für allgemein, allen gehörig. Als „banal“ bezeichnete man eine Sache, die der Lehnsherr seinen Vasallen überlässt. Auch eine Revolution lässt sich für Arendt daher nur radikal denken, indem die Revolution das Neue erschafft, weil das Alte untergeht.
Anhang: Kaum ein Ausdruck von Hannah Arendt wird so oft zitiert wie der Ausdruck „Banalität des Bösen“, wie sie den Bericht über den Eichmann-Prozess von 1961 titulierte. Arendts Begriff von der Banalität des Bösen rückt ab vom Begriff der Radikalität des Bösen. Das Böse, so Arendt, ist nicht radikal, hat gar keine Wurzeln, sondern verbreitet sich extrem wie ein Pilz überall. Es ist eine Form der Gedankenlosigkeit von Menschen, die keinen inneren Dialog führen. Nicht die Spaltung des Willens in Sinnlichkeit und moralische Vernunft - wie bei Kant - zeichnet das Böse aus, sondern der Mangel dieser Zwiespältigkeit. Die Zwiespältigkeit lässt uns gerade ja immer als Menschen mit einem Gewissen aufscheinen. Denn wenn ich eine Tat begehe oder unterlasse bin ich gleichsam mein eigener Zeuge und muss fürderhin mit mir als Mörder, Dieb oder dergleichen leben. Arendt sah in der Banalität des Bösen eben einen Mangel an selbsteigener Zeugenschaft, nämlich eine Form der Gedankenlosigkeit, die nicht radikal ist, weil sie sich nicht erinnert. Vielmehr kann sie sich ausbreiten, extrem werden. Es mangelt dem Bösen an Wurzeln.
Besprechung vom 20. März 18
Dubliner
Von James Joyce
Übersetzt von Harald Raykowski
-Bedenkt, ihr habet weiches Holz zu spalten, und seht nur hin für wen ihr schreibt! Wenn diesen Langeweile treibt, kommt jener satt vom übertischten Mahle.
-Geh hin und such dir einen andern Knecht! Der Dichter sollte wohl das höchste Recht, das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt, um deinetwillen freventlich verscherzen!
Dieser Dialog zwischen dem Theaterdirektor und dem Dichter im „Vorspiel auf dem Theater“ (Faust I, Goethe) zeigt, dass es ein komplementäres Verhältnis gibt zwischen Dichtung und Öffentlichkeit. Der Anspruch der Öffentlichkeit auf genießbare und verständliche Geschichten in erbaulicher Sprache ist legitim, aber nicht jeder Dichter ist dazu in der Lage oder willens, diesem Anspruch gerecht zu werden. In der deutschen Literatur der Nachkriegsepoche war Joyce vor allem wegen seines Anspruchs auf Authentizität beliebt. Im Nachwort zur Anthologie Tausend Gramm von 1949 schreibt der Herausgeber Wolfgang Weyrauch: „In der gegenwärtigen deutschen Prosa sind mehrere Schriftsteller erschienen, die versuchen, unsre blinden Augen sehend, unsre tauben Ohren hörend und unsre schreienden Münder artikuliert zu machen.“ Er nennt diese Literatur „Kahlschlag“. „Die Schönheit“, schreibt Weyrauch in diesem Nachwort „ist ein gutes Ding. Aber Schönheit ohne Wahrheit ist böse. Wahrheit ohne Schönheit ist besser.
Laut Weihrauch gibt es vier Kategorien von Schriftstellern.
- Die einen schreiben das, was nicht sein sollte.
- Die andern schreiben das, was nicht ist.
- Die dritten schreiben das, was ist.
- Die vierten schreiben das, was sein sollte.
Die Schriftsteller des Kahlschlags gehören zur dritten Kategorie.
„Ich kann nicht verändern, was ich geschrieben habe.“ (Siehe Nachwort Seite 276) Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hat unsere Ästhetik verändert. Die Authentizität des Erzählens vernachlässigte
die Kohärenz der Geschichte. Die zweite Hälfte des 20.ten Jahrhunderts gehörte dann der Postmoderne in der diese Authentizität selbst wieder in Frage gestellt wurde. Facts follows fiction. Die
Geschichten werden nicht verändert. Sie verändern. Unsere Wahrnehmung folgt vielmehr der Erzählung. Proust hat es einmal schön auf den Punkt gebracht. Er unterschied zwischen einer memoire volontaire
und einer memoire involontaire. Nur die unwillkürliche Erinnerung kann - nach Proust – ein Recht auf Wahrheit in Anspruch nehmen. Der Dichter ist damit mehr ein Empfänger und weniger ein
Sender. In meinen vielen Sitzungen in Literaturkreisen habe ich selbst festgestellt, dass die Leser die eigentlichen Autoren sind. Inzwischen kann ich zu Romanen keine allgemeinverbindliche Aussage
mehr treffen. Es handelt sich beim Lesen um ein subjektives ästhetisches Phänomen. Ob ein Text gut ist oder schlecht hängt ab vom Alter, Bildungsstand, Generationszugehörigkeit, Ethnie, Geschlecht,
sozialer Status, und ganz vielen, ganz persönlichen und ganz eigentlichen Eigenheiten.
Drei Jahre arbeitete Joyce an seinem Zyklus von 15 Geschichten über die Dubliner Bürger und
einer Stadt in Paralyse. Joyce suchte in dieser Stadt sieben Jahre nach einem Verleger, den er schließlich nach einigem Hin und Her in dem Oxford-Briten Franklin Thomas Grant Richards fand, nach dem
das Buch (laut Joyce eigener Aussage) von vierzig Verlegern abgelehnt wurde. Zwei Jahre nach den Dubliner erschien sein Werk A portrait of the artist as a young man. Es war einmal vor langer Zeit
und das war eine sehr gute Zeit da war eine Muhkuh die kam die Straße herunter gegangen und diese Muhkuh die da die Straße herunter gegangen kam die traf einen sönen tleinen Tnaben und der hieß
Tuckuck-Baby… beginnt das Portrait des Künstlers als junger Mann. Joyce schildert das jugendliche Schulleben des Stephen Dedalus, der ja in der Ulysses der Lehrerkollege von Leopold Bloom
wird.
Hier wendete Joyce erstmals seinen berühmten Bewusstseinsstrom an. Erst 1922 erschien sein bekanntestes Werk über einen Tag in Dublin, den 16. Juni 1904. Das war der Tag an dem Joyce seine Frau Nora
Barnacle kennenlernte. Die Themenkreise der Ulysses bleiben sich gleich: Sexualität, Religionskritik, Irland. Auf der Liste der 100 besten Novels in englischer Sprache der Modern Library, ist dieser
Roman auf Platz 1. In der Ulysses tauchen einige Figuren aus den Dubliner wieder auf.
Zum Beispiel in seinem Kapitel „Symplegaden“, wo es um die Irrfelsen (Hier sind überhängende Felsen, und gegen sie brandet groß die Woge der dunkeläugigen Amphitrite* 12,59 Odyssee) geht, die Odysseus ja mied (im Gegensatz zu den Argonauten) schildert Joyce in 19 Episoden unterschiedliche Dubliner Bürger ganz im Stil der Dubliner. So
gesehen kann man die Dubliner als Vorarbeit zur Ulysses lesen.
„Zwischen Leben und Kunst“ betitelt Richard Ellmann sein berühmtes Essay über Joyce und schildert dort, wie Joyce der deutschen Ärztin Gertrud Kämpfer nachstellte, ihr obszöne Briefe schrieb und all
dies im Nausikaa-Kapitel verewigte in der Figur Gerty MacDowell. Die Verschränkung von Kunst und Leben, von eigenem Erleben und Aufgeschriebenen bringt das Leben durcheinander. Man schreibt sich
selbst eine Story. Die Story beeinflusst das Leben und das Leben wieder die Story. Die Fakten sind ebenso ein Spiegel wie die Fiction. So lässt sich nicht mehr mit Gewissheit sagen, ob die Fakten der
Fiction untergeordnet sind oder die Fiction sich an den Fakten orientiert. Wir haben es in unserem Leben immer mit einer Wirklichkeit zweiter Ordnung zu tun (Watzlawick). Der Anspruch der
Öffentlichkeit auf eine genießbare und verständliche Geschichte in erbaulicher Sprache ist im Grunde der Anspruch auf ein genießbares, verständliches und erbauliches Leben. Facts follows fiction.
Wollen wir Schmutz und Dreck in unser Leben lassen? Wollen wir das Widerwärtige, Ekelhafte, Abartige, Gemeine, Abstoßende? Des Dichters Wahrheit ist des Dichters Wahrheit. Und doch lassen sich die
Phänomene nur als eine komplette Reihe aufgestellt verstehen: die aurea cateni homeri, die goldene Kette aller Wesen. Alles was „webt und lebt“ (Paulus) ist es wert aufgeschrieben zu werden. Nicht
nur das, was uns gefällt. Nur so können wir auch das Schöne sehen. Wäre alles schön, es würde uns nicht auffallen. Dass Geschichten nicht enden – wie in den15 Storys der Dubliner -, dass sie die
aristotelische Forderung der Geschlossenheit von Ort, Zeit und Handlung vermissen lassen, das ist auch sehr lebensnah. Wie oft wandert unser Geist heraus aus der Wirklichkeit! Daher lieben wir ja
Geschichten. Und was bringen wir schon zu Ende? Kohärenz ist ein psychologisches Motiv, das uns Sinn und Glück vermittelt. Aber Kohärenz ist reine Fiction. Die Gegenwart ist immer verworren und
undurchsichtig.
* Die Neiride Amphitrite flüchtete vor Poseidon, der ihr nachstellte. Der Mythos schildert das Eindringen der männlichen Priesterschaft in den Fischfang, der ursprünglich eine weibliche Domäne war
Besprechung vom 20. Februar 18
Lady Barbarina
Von Henry James
Übersetzt von Karen Lauer erschienen 2017 im Verlag Dörlemann
Unter den während des Krieges in England stationierten amerikanischen Soldaten war die Ansicht weit verbreitet, die englischen Mädchen seien sexuell überaus leicht zugänglich. Merkwürdigerweise behaupteten die Mädchen ihrerseits, die amerikanischen Soldaten seien übertrieben stürmisch. Eine Untersuchung, an der u.a. Margaret Mead teilnahm, führte zu einer interessanten Lösung dieses Widerspruchs. Es stellte sich heraus, dass das Paarungsverhalten in England wie in Amerika ungefähr dreißig verschiedene Verhaltensformen durchläuft, dass aber die Reihenfolge dieser Verhaltensformen in beiden Kulturbereichen verschieden ist. Während z.B. das Küssen in Amerika relativ früh kommt, etwa auf Stufe 5, tritt es im typischen Paarungsverhalten der Engländer relativ spät auf, etwa auf Stufe 25. Praktisch bedeutet dies, dass eine Engländerin, die von ihrem Soldaten geküsst wurde, sich nicht nur um einen Großteil des für sie intuitiv „richtigen“ Paarungsverhaltens (Stufe 5-24) betrogen fühlte, sondern zu entscheiden hatte, ob sie die Beziehung an diesem Punkt abbrechen oder sich dem Partner sexuell hingeben sollte. Entschied sie sich für die letzere Alternative, so fand sich der Amerikaner einem Verhalten gegenüber, das für ihn durchaus nicht in dieses Frühstadium der Beziehung passte und nur als schamlos zu bezeichnen war. Die Lösung eines solchen Beziehungskonflikts durch die beiden Partner selbst ist natürlich deswegen praktisch unmöglich, weil derartige kulturbedingte Verhaltensformen meist völlig außerbewusst sind. Ins Bewusstsein dringt nur das undeutliche Gefühl: der andere benimmt sich falsch. So beschrieb es die kanadische Psychologin Janet H. Beavin einmal in den 1990er Jahren. In einer anderen Versuchsanordnung von Asch sollen acht Studenten feststellen, ob mehrere parallele Linien gleich lang sind. Bis auf einen Studenten waren alle eingeweiht, falsche Antworten zu geben. Der andere Student unterwarf sich nun in 75 Prozent der Fälle der Mehrheitsmeinung der anderen sieben Studenten. Beziehungen zwischen Menschen mit all ihren Empfindungen, Bildern, Vorstellungen, Bedürfnissen sind keine isolierte Veranstaltung. Und Henry James ist ein großer Meister darin, diese nicht isolierte Veranstaltung zu beobachten und wiedergeben zu können.
Dem gelungenen und aufschlussreichen Nachwort der Übersetzerin Karen Lauer (die vor
wenigen Jahren durch ihre Übersetzung des Klassikers ‚Der letzte Mohikaner‘ von James Fenimore Cooper von sich reden machte) kann ich daher kaum etwas hinzufügen. Henry James ist der um ein Jahr
jüngere Bruder des berühmten Begründers der modernen Psychologie William James. Doch ist Henry James ein mindestens ebenso genialer Psychologe, wie sein Bruder, der Empirist und Vordenker des
Behaviorismus sowie der Verhaltenspsychologie. Henry James dekonstruiert mit sprachlichen Mitteln die Sprache selbst. In der Novelle nutzt er daher oft die Beschreibung von Mimik (Sie hatte
seinen Blick gemieden…Aber jetzt sah sie ihm direkt ins Gesicht S.60) bzw. wie gerade das Nichtverstehen der nonverbalen Signale (Sie stieß keinen Laut des Erschreckens aus, leistete sich
kein Zurückfahren; er konnte nicht einmal sehen, dass sie die Farbe wechselte S. 61) das Sprechen scheitern lässt. Geradezu schreiend komisch wird dies im Kapitel III dargestellt, als
Jackson Lemon bei den Cantervilles um die Hand von Lady Barb anhält. Dieses Gespräch scheitert so grundlegend an der zweiten Ebene der Sprache, an dem, was man allgemein „Verhalten“ nennt und Henry
James erzählt dies mit einer immer noch unerreichten Meisterschaft. Es ist daher nur logisch, dass die Protagonisten sprechende Namen tragen, von Zitrone bis Krieger Langstroh.
Der auktoriale Erzähler in der Novelle beginnt mit der Schilderung der Freers, die er als „reine Beobachter“ kennzeichnet. Damit wird die Novelle als Beobachtung der Beobachtenden fast schon wie ein
ethologisches Experiment angelegt. Die Beobachter wirken nach außen „durch und durch britisch“ aber sie denken amerikanisch (Sie dachten wie Amerikaner, aber nur ganz im Geheimen S. 8).
Schon hier verweist der Erzähler darauf, dass sich unsere kulturellen Eigenheiten nicht sofort jedermann offenbaren und uns keineswegs bewusst sind. Schließlich ist unser jeweiliges Selbstbild immer
ein soziales Projekt. An dem Bild wie ich mich sehe, haben eine Menge Leute mitgearbeitet. Und die Freers sind insofern Befreier, weil sie „sich imstande sahen zu vergleichen“ (S.9). Es sind nicht
nur die kulturellen Unterschiede der Nationen. Denn schließlich kommt Lady Agatha gut in Amerika zurecht. Und andersrum kommt Herman Longstraw in England sehr gut an. Lady Barb ist zwar wirklich
„very british“, wirkt nach außen wie eine Statue, den Kopf feudal gehoben und auf eine Weise distanziert freundlich, dass sie in Amerika schon wieder als mindestens undurchschaubar, wenn nicht gar
abweisend wirkt. So zeigt sich auch, dass Mrs. Vanderdecken auf dem völlig falschen Weg ist, wenn sie sich in ihrem Rang von Lady Barb bedroht fühlt. Für Lady Barb gibt es in Amerika gar nichts, was
für sie von Rang wäre. Und Jackson Lemon zweifelt und verzweifelt schließlich. Denn in England gibt es zahlreiche Ladys vom Format einer Lady Barb. Zumindest dem Rang nach. Aber Lady Barb reflektiert
nicht auf sich selbst (Seite 125 oben), neigt gar nicht dazu „Rechenschaft für ihr Verhalten von sich zu verlangen“. Bis zum Ende konsequent erfahren wir Leser nichts darüber, warum Lady Barb in
diese Ehe einwilligte. Denn es spielte in England „kaum eine Rolle, was sie tat“ (S. 125). Lady Barb ist es gewohnt eine Rolle zu spielen, aber – und das ist ‚supersuptil‘ – das spielt wohl keine
Rolle. Es ist ein Sozialverhalten um des Sozialverhaltens willen und der Gipfel des Snobismus. Denn die Rolle, die Lady Barb zu spielen hat, ist es „wichtig“ zu sein. Das Wichtigtun hat es
begrifflich als „Snobeffekt“ sogar in die Volkswirtschaftslehre gebracht. Einzigartigkeit benötigt keinen Inhalt und existiert qua seiner Einzigartigkeit. Und so mag sich Lady Barb in Amerika als
Kuriosität vorkommen, während sie in England von Einzigartigkeit umgeben ist. Ganz anders geht es ihrer Schwester: „Lady Agatha nahm undeutlich und wohlwollend wahr, dass sie etwas gesagt hatte, was
die seltsamen Amerikaner seltsam fanden, und dass sie sich rechtfertigen musste. Es ging etwas höchst Unnatürliches vor mit ihrem Begriff von Seltsamkeit.“ (S. 146). Aber mit Lady Agatha wäre Lady
Barb „noch viel einsamer“, denn ihr gefällt es in Amerika. Während Lady Agatha einen Gentleman definiert, lässt sich Lady Barb auf eine solche Definition erst gar nicht ein. Es kommt ihr gar nicht in
den Sinn, dass man das definieren könne. „Sie sei nicht nach Amerika gekommen, ausgerechnet Amerika, um herauszufinden, was ein Gentleman sei.“ Lady Agatha erkennt die Ähnlichkeiten (dennoch lag
der Unterschied nicht in ihm selbst, sondern darin, wie sie ihn sah – wie sie alle Leute in Amerika sah S. 149) Die Perspektiven der Schwestern zeigen, dass uns kulturelle Eigenarten nicht etwa
festlegen, sondern als ein offenes System funktionieren. Und wenn das Projekt von den beiden Damen Lady Marmeduke und Beauchemin funktionieren sollte, dann nur mit der Erkenntnis von Mrs Freer, dass
man die Grenzen nicht ausschließlich im Kulturellen, sondern auch im Menschlichen erkennt. „Unsere Lady Barb – ein einziges englisches Mädchen – kann eine Million Menschen zu Rangniederen machen.“
(S. 110) Da Lady Barb eine Blume aus einem aristokratischen Klima ist, die im amerikanischen Boden nicht gedeiht, kann man diese Blume ohne ihr Klima nicht denken.
Besprechung
vom 17. Januar 2018
Neubayern
Von Florian F. Scherzer
Erschienen im Hirschkäfer-Verlag 2017
Früher war alles besser? Nein, sicher nicht. Alles war immer gleich beschissen. All der
leuchtende Schnick-Schnack unserer spätmodernen Welt verhindert nicht, dass es heute nicht weniger Arschlöcher (um mit Elsi zu sprechen) als früher gibt.
Neubayern liegt irgendwo im Niemandsland zwischen Argentinien und Chile im nördlichen Patagonien. Ein etwa 40 Quadratkilometer großes Gebiet, bewohnt von etwa 20.000 rückständig lebenden Bayern, die
von ehemaligen Aussiedlern aus dem 19. Jahrhundert abstammen. Josef Kiener, das Wallermaul, ist einer von ihnen. Er lebt bei den Fischweihern in Oberpfaffing und wird von den Dorfbewohnern wegen
seines Aussehens verspottet. Seine Eltern und seinen Bruder hat er bei einem Brand verloren. Eines Tages verschwindet ein Junge, Benno, aus dem Dorf. Sein Freund Johann Schwarz bittet den Kiener
Josef um Hilfe, Benno wieder zu finden. Josef macht sich auf den Weg und was er nun alles erlebt und erfährt möchte man kaum glauben, hätte der Autor Florian F. Scherzer es nicht so plastisch und
glaubhaft erzählt. Als zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Heilige Römische Reich Deutscher Nation unterging und Napoleon den Rheinbund gründete, und 1813 die Reichsaufteilung durch den Wiener
Kongress beschlossen wurde, wuchs im schönen Bayernlande die Idee eines „Dritten Deutschland“ heran. Einer der Wortführer war Mitte des 19. Jahrhunderts (nach dem März 1848) Ludwig von der Pfordten,
ein Jurist und bayrischer Außenminister. Florian F. Scherzer nimmt diese historischen Motive heraus und bastelt eine geschickt verwobene Posse. Ein königlich bayrisches Kolonialamt gab es wohl so
nicht. Der erwähnte Adalbert von Reisach (Adalbert Heinrich Freiherr von Reisach) war in Wirklichkeit Bischof in Würzburg und lebte knapp 100 Jahre früher. Aber die Bestrebungen Bayerns
Kolonialgebiete zu erwerben, die gab es in jedem Fall. Und so wird eine Kuriosität der Geschichte glaubwürdig. Josef Kiener und seine Dorfbewohner aus Neubayern sind über 170 Jahre lang komplett von
der übrigen Welt isoliert gewesen und haben sich nicht über das 19. Jahrhundert hinaus entwickelt. Kein Strom, keine digitale Kommunikation, keine Autos, keine Flugzeuge. Eine Minengesellschaft sorgt
dafür, dass es so bleibt. In diesem Gebiet im nördlichen Patagonien gibt es ein begehrtes Metall: Neodym. Es ist hoch magnetisch und wird für Windkrafträder, Elektroautos aber auch für Kernspin
benötigt. Eine Gelddruckmaschine. Die im Roman erwähnte Mine in Bayan-Obo gibt es wirklich und es sieht dort wirklich so aus, wie im Roman geschildert. So viel also zu unserer guten bayrischen Luft.
So viel zu der „sauberen Energie“. Sie ist so sauber nicht. Sie ist so schmutzig wie all die nach Schweiß und Bier riechenden Neubayern, nein, sie ist sogar schmutziger.
Aber Josef Kiener hat großes Glück. Aber nicht einfach so. Er hat ein großes Herz und verdient daher auch sein großes Glück. In Neubayern gibt es einen Aberglauben. Man glaubt an die Perchtln, die
das Viechfieber bringen. Doch der heilige Andreas kann sie beschützen. Er hat einst eine ganze Horde von Perchtln erschlagen und so das schöne Neubayern gerettet. Tatsächlich glaubt Josef Kiener erst
nicht an diese abergläubische Geschichte. Bis er sie selbst erlebt. Aber die Perchtln sind keine Fabelwesen, sondern Indigene, die ihr ureigenes Land wieder zurück wollen. Die Neubayern erschlagen
sie und verbrennen sie. Geschickt erzählt uns Scherzer damit auch noch eine Parabel über Rassismus. Aber Kiener hat ein großes Herz und er hilft einem Perchtl zu überleben. Er erfährt nun, dass es
eine Frau ist und dass sie auch noch hübsch ist und kein grusliges Monster. Die beiden verlieben sich ineinander und zum Schluss kommen sie über viele Abenteuer und Umwege auch
zusammen.
Soweit also diese Geschichte. Erzählt wird die Geschichte von verschiedenen Zeitzeugen in Form von Berichten. Damit stellt Scherzer eine Art Authentizität her. Die Berichte von Josef Kiener erinnern sprachlich gelegentlich an Wolf Haas Privatdetektiv Brenner. Es ist ja auch gewissermaßen eine Kriminalgeschichte, ein Umweltthriller, eine Entdeckergeschichte, eine Parabel aber auch eine Posse. Fast zu viel auf einmal für einen Roman. Aber das macht die Tiefendimension dieses gelungenen Debüt-Romans von Florian F. Scherzer aus. Der Werbefachmann (wie auch Wolf Haas einer ist), lässt schon am Ende des ersten Drittels seines Romans den Hintergrund von Neubayern durch den Bericht von Christian Hinterwald (genannt Engel) auffliegen. Aber er schafft es nun weiter, die Spannung zu halten. Man hat Josef Kiener schon lieb gewonnen und so manche Szene erinnert an das königlich bayrische Amtsgericht. Die Figuren erinnern an Karikaturen von Manfred Deix. Kieners Reise von Oberpfaffing nach Rieding und dann nach Reisach auf der Suche nach Benno und dem geheimnisvollen München ist einfach süffig erzählt. Und die Stadt Rieding mit dem Heimatwahrer Holderer oder seinem alten Schulkameraden in Reisach dem Georg Dobler (Doblergirg) im Gasthaus Torbräu ist in die Details hinein köstlich. Oder das Supersol-Papier! Supersol ist eine spanische Discounter-Kette wie bei uns Penny oder Tengelmann. Das Supersol-Papier mit dem Sonnenzeichen sind diese Werbebroschuren für billige Industrienahrung. Wie überhaupt dann der Fraß mit dem wir Spätmodernen systematisch vergiftet werden herrlich geschildert wird. Es ist schon eine Kunst von Scherzer, wie er die Perspektive des vormodernen Kiener nutzt, um uns die Sinnentleertheit und Absurdität unserer Welt vorzuhalten. Früher war es nicht besser, wie schon gesagt. Wurde es wirklich besser inzwischen? Das lässt sich stark anzweifeln. Auch wenn das Leben in Neubayern karg und entbehrlich war, hochgradig rückständig und voller Aberglauben und beherrscht von autoritären Amtmännern, so ist das 21. Jahrhundert geprägt von sinnloser, entfremdeter Arbeit und Konsumzwang, geprägt von völlig nutzlosen Dingen, die wir ständig kaufen, geprägt von der Öde und Monotonie der Gewerbegebiete, die im Grunde nur eine Vorstufe zu der Mad-Max-Landschaft eines Minengebiets darstellen. Weder in Neubayern, noch in Bayern will man wirklich leben. Nur: Die Neubayern wussten es nicht besser. Und wir Altbayern wissen es auch nicht besser. Wir sind Vertreter einer vor-apokalyptischen Nach-Moderne, mit unseren Laptops, Smartphones, Elektroautos und beheizten Zweizimmerwohnungen, mit unseren entfremdeten Jobs und unserer partiellen Blindheit für das, was auf der Welt wirklich geschieht an Perversion und Ungerechtigkeit. Die Neubayern sind rückständige, rassistische und autoritätsgläubige Dummköpfe. Solche gibt es auch hier in Altbayern. Und dieser Weg des „Dritten Deutschland“ aus dem 19. Jahrhundert, wird heutzutage zur Karikatur durch die Reichsbürger, die ja inzwischen schon gut bewaffnet sind, wie man aus der Presse erfährt. Es hat sich also viel geändert in 200 Jahren. Aber nichts zum Besseren - gäbe es nicht warme Duschen. Täglich warmes Wasser und Sauberkeit sind die größten Errungenschaften der Moderne.
Rufen Sie einfach an unter
Arwed Vogel
++49 ( )8762 726121
oder
Bernhard Horwatitsch
017646130019
horwatitsch[at]gmx.at
...
oder
nutzen Sie unser