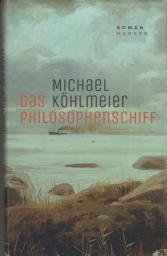16. Juli 24
Treibgut
Von Julien Green
Herausgegeben und übersetzt von Wolfgang Matz
Erschienen 2024 im Verlag Hanser
Kunst heißt die Wirklichkeit gegen den Strich bürsten. Sie glätten und polieren ist
Tapeziererarbeit. … Aber die Kunst ist hart. Sie will nicht »eins aus dem andern« entwickeln, sondern vieles aus wenigem. Sie läßt uns … in den Schnürboden der Leidenschaften hineinsehen und
zeigt das simple, zackige Räderwerk: Einsamkeit, Furcht, Haß, Liebe, Trotz, das hinter jedem Geschehen steht. Und nicht als »psychologische Motive« bewegen diese Gewalten die Handelnden: sie schaffen
sich in ihrem Schicksal Ausdruck.
Greens Abstand von dem üblichen Typus des Romanciers ist in der Kluft zwischen Vergegenwärtigung und Schilderung einbegriffen.
Green schildert die Menschen nicht, er vergegenwärtigt sie in schicksalhaften Momenten.
So formulierte es Walter Benjamin in seinem Essay über den im Jahr 1900 in Paris geborenen
Julien Green und der Literaturdirektor der bayrischen schönen Künste Wolfgang Matz hat in seinem ausführlichen Nachwort zu dieser Ausgabe alles Weitere zu Julien Green erwähnt, was man wissen muss.
Green starb 1998 und hinterließ ein gewaltiges Werk samt einem riesigen Tagebuch aus 18 Bänden. Green wurde auf eigenen Wunsch in der Pfarrkirche Klagenfurt-St. Egid (Klagenfurt am Wörthersee) bestattet. Sein 1950 von ihm adoptierter Sohn Jean-Éric Green (Geburtsname Eric Jourdan)
starb am 7. Februar 2015 und wurde neben seinem Vater in Klagenfurt beigesetzt. Auch Jean-Eric war ein Schriftsteller. Er war bereits 60 Jahre alt, als ihn Julien 1990 adoptierte.
Green erzählt in „Treibgut“ die Geschichte von drei Menschen, oder sagen wir dreieinhalb Menschen (den zehnjährigen Robert mit eingeschlossen), die sich im Paris der späten 1920er Jahre
„treiben“ lassen. Die Hauptperson ist Philippe, ein ziemlich eitler und dekadenter Mann Anfang dreißig, der vom Vater genug geerbt hat, um sorgenfrei leben zu können. Doch statt dies zu genießen,
sorgt er sich mehr und mehr um seinen Verfall, hat Angst dick zu werden, erlebt sich selbst in einer Schlüsselszene an der Seine (hier bekam das Leben ein feindliches und gewalttätiges Gesicht,
das er nicht kannte, S.32) als feige und erstickt zunehmend in Selbstzweifel, die er nur aufrechterhalten kann, wenn er sein Äußeres erhält. Seine junge Frau Henriette ist nicht weniger schön,
jung, aber sie liebt Philippe nicht. Stattdessen betrügt sie ihn mit einem armen und eher unansehnlichen Bankangestellten, dem sich immer wieder heimlich Philippes Geld zukommen lässt. Ihre
ältere Schwester Éliane, das „alte Mädchen“, lebt ebenfalls mit dem Paar in dem ererbten Pariser Appartement. Éliane ist verliebt, sehr verliebt in Philippe und hat die Ehe mit Philippe und ihrer
jungen Schwester arrangiert, um so näher bei Philippe sein zu können. Damit ist die Ménage-à-trois komplett. Ein eitler, dekadenter, sich langweilender Privatier, eine kokette, unreife junge Frau und
eine alte Jungfer leben zusammen in einem Appartement. Das fragile Gleichgewicht dieser Dreiecksbeziehung wird noch fragiler, als der Sohn Robert aus dem College nach Hause kommt und sich Philippe in
den Sohn ein wenig verliebt, weil er ihm so ähnlich sieht. Diese romantische Spiegelung ist dann der Gipfel der Ironie dieses burlesken Theaters, das Julien Green mit feinstem und hoch ernstem Humor
vorgetragen hat. Der Ernst und naturalistische Hintergrund sind die Stadt Paris. Und es ist eine Geschichte des Lichts.
In allen großen Städten gibt es Zonen, die entfalten ihr wahres Bild erst im Halbdunkel, heißt es auf Seite 33. Im „Abenddämmer“ erwacht sozusagen die „Parodie des Todes“. Beim
ersten Strahl dieser Sonne schmückt sich die nächtliche Landschaft mit all ihren Schatten, und die Materie beginnt eine unheimliche und wunderbare Häutung. In dieses Licht, dem Halbschatten, vom
Kaminfeuer im Lesezimmer bis zu den Lichtreflexen der Reklame, den Schatten auf den Gesichtern, entwirft Green cineastische Bilder, die mit der Kinoszene im sechsten Kapitel des zweiten Teils
wiederum eine romantische Spiegelung bekommt. Philippe langweilt sich zu Tode, weil Éliane vorübergehend das Haus verlassen hat. So gerät er in eine Kinovorführung. Dort bekommt er auf komische Weise
den Betrug seiner Ehefrau vorgespielt. Der Korridor auf der Leinwand zeigte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem zwischen seinem Schlafzimmer und der Bibliothek… heißt es auf Seite 195.
In so manchem erinnerte mich der Roman an die Erzählung „Armand“ von Emmanuel Bove. Zumindest in Teilen war die von Bove 1927 geschriebene Erzählung ein Licht- und Schattenkabinett, der in dieser
halb beleuchteten Moderne eingefangen wurden.
Die klassische Moderne zeigt sich beispielhaft in der Szene, als Philippe im vierten Kapitel des zweiten Teils bei der Geschäftsversammlung teilnimmt. Selten habe ich über das Gefühl von Langeweile
so präzise und brillant (alles andere als langweilig erzählt) gelesen, wie in dieser Passage. Einen Höhepunkt erreicht die Szene, als Philippe sich vorstellt, wie die Bergarbeiter, die für das
Unternehmen seines Vaters arbeiten, plötzlich in diese Geschäftsversammlung reinplatzen. Sie öffneten die Tür mit einer Art Respekt, blieben einen Moment auf der Schwelle stehen, vom Kronleuchter
geblendet, dessen Strahlen auf ihren schimmernden Oberkörpern spielten. Sie standen mit offenem Mund; drückten sich aneinander, in einem dunklen Winkel des Saals von einer Schüchternheit
gepackt, die noch wuchs, je mehr sie wurden.
Diese Szene spiegelt dann wiederum die Schüchternheit von Philippe, der sich im Grunde nicht zutraut, in dieser Runde alter Männer etwas Vernünftiges zu sagen. Er hat vermutlich auch nichts zu
sagen. So beschließt er, seine Anteile zu verkaufen. Diese Form der Dekadenz offenbart auch mehr und mehr den kleinbürgerlichen Hintergrund eines Menschen, der nicht gelernt hat Befehle zu
erteilen. Wir erleben gegen Ende des Romans in den bösartigen Gedanken von Éliane über Philippe, die präzise Darstellung des Kleinbürgerlichen. Die Welt der Großbürgerlichkeit schilderte noch
Thomas Mann. Dann war diese Welt tot, in zwei Weltkriegen vernichtet. Greens Roman aus dem Vorwinter des Zweiten Weltkrieges, aus der Zwischenkriegszeit erkennt noch die Hässlichkeit dieses
Kleinbürgertums. Heute, fast 100 Jahre später, gibt es im Grunde nur noch Kleinbürger, wurzellose, leicht beeinflussbare, vom Konsum gesteuerte Mitläufer. Die Langeweile wurde übermalt von einem
gigantischen Kino, das sich in Greens Roman bereits auszubreiten beginnt.
Doch hier gibt es noch Schatten zwischen all dem Licht. Die Wandleuchter aus Vermeil
kreuzten ihre Lichtstrahlen in der Unendlichkeit der Spiegel oberhalb der Konsolen, und über die kirschroten Vorhänge, deren große, gerade Falten Kontur und Strenge von Säulen vortäuschten, huschten
milchige Schimmer. Ein Porträt aus dem 18. Jahrhundert musterte mit undurchdringlichem Blick diese Versammlung leerer Sessel…
Schon Nebelgeruch und die flackernden Straßenlaternen kündigen bereits an, was zu kommen drohte. Die eisige Nacht verharrte noch in der Tiefe des Himmels, doch zwischen dem
harmlosen Gezwitscher einer Amsel traten bereits die fahlen Häuser aus dem Dunkel wie aus einem Schiffbruch.
Diese manchmal rührend komischen, insgesamt unfähigen und lächerlichen Protagonisten in Greens Roman waren genießbar nur, weil der Erzähler sie in ein Meer aus Licht und Schatten tauchte, sie in der Seine spiegeln ließ und ihren Reichtum so armselig machte, ohne Mitleid zu erwecken.
03. Juli 24
Trophäe
Von Gaea Schoeters
Aus dem niederländischen von Lisa Mensing
Erschienen 2024 im Verlag Zsolnay
Aufspüren, verfolgen, fangen und erlegen. Die Quadratur der Jagd. Dramaturgisch stellt sich jeder Leser zwei Fragen: Ist die Jagd gerecht? Gelingt der Beute die Flucht bzw. gelingt es dem Jäger, die Beute zu fangen. Ursprünglich ging es bei der Jagd um die Nahrungsbeschaffung. Darauf deutet zumindest die indogermanische Wurzel des Wortes Jagd: *uid, sich Nahrung verschaffen. Doch im Laufe des menschlichen Zivilisationsprozesses wurde die Jagd zum Zeitvertreib, zu einem Sport.
Gaea Schoeters liefert uns hier eine Jagdgeschichte, die am Ende dazu führt, dass Jäger und Beute tot sind. Aber es ist nicht nur eine Jagd, sondern eine Reise, eine Reise zwischen Diesseits und Jenseits. Das Swahili-Wort „Safari“ bedeutet ursprünglich einfach nur „Reise“. Durch die Kolonialherren in Afrika wurde das Wort zum Synonym für Großwildjagd. Der Held der Geschichte, Hunter White, ist ein moderner, im Geldgeschäft reich gewordener Amerikaner, der in dieser Großwildjagd auf der Suche nach Ursprünglichkeit ist. Dieser alte und immer schon faschistische Gedanke, der eigenen Dekadenz, der Verfeinerung seiner Sinne und Sitten und auch der Langeweile entkommen zu können, indem man in einer Art Spiel, einer Art Rausch Authentizität imitiert.
Schoeters erzählt Hunters Geschichte durchgängig im Präsens und immer eng an die Reflektorfigur Hunter geknüpft. So blickt man – mit Verlaub – durch die Kameraaugen eines Arschlochs auf die Story. Das unglaubliche Angebot seines Jagdführers van Heeren, einen Buschjungen zu jagen, als Ersatz für die missglückte Nashornjagd, nimmt Hunter fast sofort an. Sein Widerstand ist gering, denn „sein Körper“ sagte in allen Fasern „ja“ zu diesem Spektakel. Dass ihm als Spurenleser der beste Freund der Beute beigestellt wird, ist nicht in seinem Sinn. Aber Dawid, der Freund von !Nqate, erweist sich als guter Spurenleser und Jagdbegleiter, dem Hunter mehrfach sein Leben verdankt. Im entscheidenden Moment trifft Hunter seine Beute nicht perfekt, müsste ihn aber komplett töten, da es unehrenhaft ist, seine Beute leiden zu lassen. Aufspüren, verfolgen, fangen und erlegen. So ist das Weidwerk. Nicht anschießen und warten, bis es qualvoll stirbt. Die Tatsache, dass Hunter eine Beute jagt, die von der Jagd weiß, die vorausplanen kann und auch ein Wissen über den Tod hat, hemmt Hunter am Ende. Sein magischer Tod wird von Dawid gerechtfertigt, weil er die Beute nicht sachgerecht tötete. Das machte die Götter zornig. Hunter sieht sich als „anständiger Jäger“, der mit der Jagd aufgewachsen ist, und der sich über die Leute beschwert, die Freude daran haben, Tiere zu quälen, ihre Überlegenheit demonstrieren wollen. Er nicht. Er sieht sich auf Augenhöhe mit dem Tier, glaubt daran, dem archaischen Urmensch-Dasein nahe zu sein. Diese Verlogenheit und Heuchelei gab mir wirklich die gesamte Lektüre über ein Gefühl von Übelkeit.
Die belgische Autorin Gaea Schoeters schrieb eine Reihe anderer Bücher, sowohl Belletristik
als auch Sachbücher. Ihr allererstes Buch Girls, Muslims and Motorcycles war ein Bericht über eine lange Motorradreise, die sie durch den Nahen Osten und Zentralasien unternahm. Zu ihren
weiteren Werken gehören Romane, eine Sammlung von Interviews und Kinderbücher.
In dieser Metapher des Kolonialismus gelingt Schoeters ein Spannungsaufbau (Flucht – Rettung), der uns Leser durch die Geschichte jagt. Das Präsens als Erzähltempus trägt dazu bei, die
Unmittelbarkeit der Jagd mitzuerleben. All das sollte uns täuschen und uns zur Mittäterschaft verführen.
Zunächst müssen bei einer Jagd die Grundregeln festgelegt werden. Es gilt ein Fairplay. Je
schwieriger es für den Jäger ist, die Beute zu erlegen, desto wertvoller ist die Trophäe. Tropaion, das Siegeszeichen. Die Jagd ist somit ein archaischer Vorläufer des Krieges. Sind die Regeln
definiert, muss geklärt werden, was auf dem Spiel steht. Je kräftiger und gefährlicher die Beute ist und damit dem Jäger ebenbürtiger, desto wertvoller ist die Trophäe. Schließlich gibt es ein
Ereignis, das die Jagd auslöst. In den alten Zeiten war das einfach das Bedürfnis zu essen, den Hunger nach Fleisch zu stillen. Warum geht Hunter White auf die Jagd? Er hat alles. Seine Trophäen
verschenkt er. Vordergründig möchte er seine Frau beeindrucken. Tiefenpsychologisch verarbeitet Hunter den Tod seines Vaters, der bei der Jagd verstarb. Jemand hatte ihn mit der Beute verwechselt.
Ein gar nicht so seltener Jagdunfall. Es geht Hunter also um Identität. Und am Ende stirbt er, wie sein Vater, bei der Jagd. Er wird nicht mit der Beute verwechselt, sondern macht sich durch sein
Verhalten selbst zur Beute. Er stirbt an Malaria, an einer Mücke. Ein simpler, ironischer Tod für einen Jäger.
Dazwischen erzählte er sich das ganze Jägerlatein über die Würde der Jagd. Von Anfang an war immer klar, dass der Jäger die Beute tötet. Dawid sagt es immer wieder. Es gibt die Jäger. Es gibt die
Beute. Die Beute stirbt. Der Jäger tötet. Dies ist das Gesetz. Da Hunter nicht tötete, wurde er schlicht zur Beute. Eine Welt auf diese Keimzelle menschlicher Entwicklung zu reduzieren, nennt man
Sozialdarwinismus und das ist purer Faschismus. Schoeters demaskiert diesen ganzen kolonialen Dreck. Aber nicht plump durch Vorwürfe und mit dem Finger zeigend. Nein. Die Problematik in Ostafrika,
dass der Großwildtourismus den Bestand von Tieren sogar fördert, weil man mit dem verdienten Geld die Wilderei reduzieren kann, ist an schizophrener Ironie nicht zu überbieten. Die Wilderer bedienen
einen weißen Markt und jagen nicht ehrenhaft, oder sportlich, sondern nutzen die Optionen. Sie sind wie Hunter, wenn er seine Geldgeschäfte macht. Aber – ach wie romantisch – in Ostafrika kann er so
sein, wie er sein möchte, wie er als Kind einmal war, einfach nur ein Jäger, der seine Beute jagt und sich den wilden Gefahren des Dschungels aussetzt. Zum Kotzen. !Nqate zu jagen bringt den nirgends
geduldeten Ureinwohnern genügend Geld und die Option, ihr früher eigenes Land als Jagdgebiet zu nutzen. So leistet van Heeren auch noch Entwicklungshilfe und ist ein guter Mensch mit Idealen. Zum
Kotzen.
Insgesamt las ich das Buch nicht in einem Stück. Weil ich die Ironie der Story nicht über längere Strecken vertrug. Zum Anderen fand ich am Ende gewisse Redundanzen in den immer wieder zelebrierten Jagdmetaphern. Ein Höhepunkt des Romans war sicher die Szene im Dschungel, als sich Löwen und Hyänen um ihre Beute (Dawid und Hunter) stritten. Der fast gelähmte Hunter bedient sich auch hier einer Erzählung von Ernest Hemingway. Dieser vom Lebensüberdruss der lost generation gezeichnete Schriftsteller ging auch gerne auf Safari und schoss sich am Ende mit dem Schießeisen ein Loch in den Kopf, so wie schon sein Vater, der Landarzt Clarance Hemingway. Über allem Depression, Lebensüberdruss, Dekadenz und Sehnsucht nach dem echten Leben. Ein Mechanismus der Sattheit.
Juni 24
Mond über Manhattan
(Originaltitel: Moon Palace)
Von Paul Auster
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
Es war Vollmond, gelb und rund wie ein glühender Stein. Ich folgte ihm mit den Augen auf seinem Weg in den nächtlichen Himmel und wandte mich erst ab, als er seinen Platz in der Dunkelheit gefunden hatte.
Dieser Schlusssatz in Austers aus dem Jahr 1989 stammenden Roman „Moon Palace“ lässt sich natürlich umstandslos metaphorisch deuten. Der Mond ist eine Art Leitstern, der uns durch die Dunkelheit unseres Daseins führt. Eines Daseins, das von Zufällen und gleichzeitig absurden Zusammenhängen zeugt. Der Ich-Erzähler Marco Stanley Fogg verfasst den vorliegenden Text im Jahr 1986 als Folge einer zufälligen
Begegnung mit seiner Vergangenheit, wie aus einer Schlüsselstelle hervorgeht:
„Seither [Frühjahr 1982, Begegnung auf der Straße nach 13 Jahren] habe ich nichts mehr von ihm [David Zimmer] gesehen oder gehört, aber ich vermute, diese Begegnung vor vier Jahren [Zeit des Niederschreibens 1986!] hat den ersten Anstoß dazu gegeben, dieses Buch zu schreiben, und zwar kam mir die Idee genau in dem Moment, als Zimmer im Gewühl verschwand und ich ihn wieder aus den Augen verlor.“ (S. 136)
Tatsächlich hat der 1947 in New Jersey geborenen Nachfahr österreichischer Juden für den komplexen und sehr pikaresken Roman 20 Jahre gebraucht.
„The original Moon Palace was enormous; it would’ve been three times the length it is now. There were lots of bits in it that I stole and used in City of Glass.“ Er schrieb an diesem 1989 erschienenen Roman mit Unterbrechung zwischen den 1970ern bis Ende der 1980er Jahre, hat ihn vermutlich bereits in seiner Zeit in Frankreich begonnen. Paul Auster hielt sich zwischen 1971 und 1974 drei Jahre in Frankreich auf. Dort lernte er auch seine erste Frau, die Lyrikerin Lydia Davis, kennen. 1982, war dann bis zu seinem Tod 2024 mit der Schriftstellerin Siri Hustvedt liiert.
Sein Ich-Erzähler fasst den ganzen Roman schon zu Beginn komplett zusammen:
„Es war der Sommer, in dem zum ersten Mal Menschen den Mond betraten [zeitlicher Kontext: Sommer 1969]. Ich war damals noch sehr jung, glaubte aber an keinerlei Zukunft. Ich wollte gefährlich leben, bis an meine Grenzen vordringen und sehen, was mich dort erwartete. Wie sich herausstellte, ging ich daran fast zugrunde. [Thema: Überschreiten von Grenzen] Nach und nach sah ich mein Geld schwinden; ich verlor meine Wohnung; am Ende lebte ich auf der Straße.[Thema: pure Existenz] Ohne ein Mädchen namens Kitty
Wu wäre ich wohl verhungert. [Thema: Liebe/Gemeinschaft vs. Eremiten-Dasein]. Ich hatte sie erst kurz vorher zufällig kennengelernt, doch sehe ich in diesem Zufall [Thema: Zufall] im Nachhinein eine Art Bereitschaft, mich durch den geistigen Einsatz anderer Leute retten zu lassen. Das war der erste Teil.
Von da an stießen mir seltsame Dinge zu. Ich verdingte mich bei dem alten Mann im Rollstuhl. Ich fand heraus, wer mein Vater war [Thema: Identitätsfindung]. Ich wanderte durch die Wüste von Utah nach Kalifornien [örtlicher Kontext: nicht auf einen Ort eingegrenzt, sondern grenzüberschreitend; Bewegung gen Westen]. Das ist natürlich lange her, aber ich erinnere mich gut an diese Zeit, sie ist der Anfang meines Lebens [Anliegen: Lebensgeschichte].“ (S. 9)
So haben wir hier alle wesentlichen Erzählmotive angedeutet. Vom Existenzkampf bis zur Grenzüberschreitung, der metaphysischen Deutungsmaschine Mensch, dem Zufall ausgeliefert, auf der Suche nach der eigenen Identität zwischen Selbstsucht und Selbstauflösung einem ständigen Antagonismus ausgesetzt. Der postmoderne Roman ist zwar im Stil konventionell geschrieben. Aber die literarischen Quellen für Moon Palace sind so vielfältig und das Hauptargument im Roman (wie in der Postmoderne) ist ja der Zerfall einer großen Geschichte in lauter einzelne Geschichten. So setzt sich das Leben von Stanley Fogg zusammen aus diversen expliziten und impliziten intertextuellen Verweisen auf zahlreiche weitere literarische Werke. An dieser Stelle seien nur die Lyrik Sir Walter Raleighs (um 1600), Shakespeares Tragödie König Lear (1608), Die Reise zum Mond (1649) von Cyrano de Bergerac, Charles Dickens’ Roman David Copperfield (1849), Hermann Melvilles Erzählung Bartleby, der Schreiber (1853), Fjodor Dostojewskis Roman Schuld und Sühne (1866), Jules Vernes Roman In achtzig Tagen um die Welt (1872), Knut Hamsuns Roman Hunger (1890) sowie Franz Kafkas Erzählung Ein Hungerkünstler (1924) genannt.
Zugleich sind die Romaneinteilung und der erzählte Raum ein ironischer Verweis auf die biblische Schöpfungsgeschichte. Es sind sieben Kapitel und sieben Jahre von 1965 bis 1972, die uns erzählt werden. Im Herbst 1965 kommt der Erzähler als 18-Jähriger aus Chicago nach New York zum Studium an der Columbia University. Am 04. Januar 1972 stirbt sein vermeintlicher Vater Solomon Barber, der Sohn von Effing (früher Julian Barber) und zwei Tage später beobachtet Fogg am Strand des Lake Powell den Mond.
Erst zehn Jahre später, 1982 kommt ihm die Idee für den Roman. Das ist dann auch die Entstehungsgeschichte des Romans in der Realität. (Siehe Zitat oben, S. 136).
Auster verknüpft die Haupt- und Nebenhandlungen durch Leitmotive, wie das Moon Palace, dem chinesischen Restaurant, dessen Neonlicht-Reklame er von seiner Wohnung aus sehen kann. Fogg trifft sich mit Solomon Barber im „White Horse Tavern“, in der gleichen Kneipe, in der er Jahre zuvor mit David Zimmer, seinem Studienfreund, regelmäßig ein Bier trinken ging. Der Name der Kneipe verweist natürlich auf die Frontiers-Geschichte, die ihm später der 86 Jahre alte Effing erzählen wird. Effing ist natürlich so alt wie das Jahrhundert, und es ist 1986, als Fogg die Geschichte aufzuschreiben beginnt.
So werden die Zufälle und Verbindungen zu einem Ganzen verknüpft. Dieser konstruktivistische Erzähl-Ansatz ist natürlich wieder ein klarer postmoderner Verweis.
Fragmentierung und Parallelität geben sich in der Erzählstruktur die Hand. So wie die intermediale Struktur zwischen seinem Jazz musizierenden Onkel Victor, dem malenden Julian Barber (sprich Effing) und der Literatur einen Zusammenhang vortäuscht, der nur bedingt existiert.
Weiter erzeugt Auster auch metafiktionale Effekte, zum Beispiel ist für Onkel Victor jedermann „der Autor seines Lebens“ (S. 16).
Fogg, fiktiver Protagonist von Austers Roman, schreibt, wie er seine Lebensgeschichte verfasst (vgl. S. 136). Und Fogg beginnt nach seiner Zeit bei Effing, „eine untergründige Version meiner eigenen Lebensgeschichte zu schreiben.“(S. 292). Da Solomon Barber seinerseits die Geschichte seines Vaters als Roman (Keplers Blut) schreibt und Fogg die Geschichte von Julian Barber erzählt, im Grunde die Geschichte seines Großvaters, wird auch klar, dass die Zufälle durch dynastische Verbindungen einen Zusammenhang bekommen. Und damit eine Struktur. Und das ist es ja, was wir im Leben wollen. Eine Struktur und damit einen Sinn. Darum leben wir. Um am Ende Licht in der Dunkelheit unseres Seins zu sehen. Und doch ist der Mond Symbol für eine Reise ins Unbekannte, eine sentimentale Empfindung, ein Beispiel unserer paradoxen Realität, aber auch für Harmonie und Universalität (Spiritualität) und es ist ein gefährdeter Mythos (Ausrottung der Indianer Blacklocks Moonlight).
Vom Börsencrash 1929 bis Hiroshima, von den ersten Siedlern bis zur Mondlandung. Ein breiter Wurf in einem inzwischen zum Klassiker gewordenen Roman.
Juni 24
Eine Arbeiterin
Leben, Alter und Sterben
Von Didier Eribon
Aus dem Französischen von Sonja Finck
Erschienen im Verlag Suhrkamp 2024
Im Projekt Altwerden bin ich noch ein Neuling. Aber dennoch merke ich immer intensiver den Verlust von Bedeutung des Wortes „Zukunft“. Mein Leben wird allmählich zu einem Cold Case. Also blicke ich zurück, muss zurückblicken, da vor mir eine Mauer steht. Zur Mauer gibt es noch Reflexionen. Aber auch sie rückt ja immer näher und wird - je näher sie kommt – zu nichts weiter als einer Mauer, ohne jedes Geheimnis. Diese Mauer hat man, weil man sich umdreht und zurückblickt, im Rücken. Eine kalte, raue Mauer, die sich von hinten durchs Hemd scheuert. Vorne dagegen die unendlich werdende Vergangenheit, ein sich in Details auflösender, formloser und so auch beinahe zeitloser Plusquamperfekt, der sich wie ein Konjunktiv gebärdet. Denn in diesem Stadium des Altwerdens, in dem ich mich befinde, formt man noch sein Leben, oder hält die Illusion aufrecht, sein Leben formen zu können. Das ändert sich, wenn Immobilität, Gedächtnisverlust und Kurzsichtigkeit, wenn entzündete Schleimbeutel, chronische Knochenschmerzen und derlei unangenehme, aber noch lange nicht tödliche Beschwerden den Alltag immer weiter durchkreuzen. Dann wird auch die Illusion von der Formbarkeit des Lebens von der physiologischen Begrenzung eingeholt.
Soweit formulierte ich es während meiner Lektüre von Eribons Auseinandersetzung mit seiner
alternden und sterbenden Mutter. Vieles konnte ich auf erschreckende Weise selbst nachvollziehen. Der Tod meiner Mutter lag nicht allzu lange zurück. Sie hatte sich vehement und bis zum bitteren Ende
gegen Hilfe von außen gewehrt, empfand jede Einmischung in ihr häusliches Dasein als Verletzung ihrer Intimität. Ich habe lange nicht verstanden, warum sich meine Mutter derart gegen Hilfe wehrte und
dafür auch in Kauf nahm, dass die Wohnung nicht mehr gepflegt war und sie auch immer seltener rausgehen konnte. Sie akzeptierte den Verlust von Freiheit, von Mobilität, um ihre Intimität zu
wahren.
Eribon schildert ein Verhältnis zu seiner Mutter, das deutlich gemischter ist, vor allem durch die Klassenunterschiede und die Entfremdung durch Bildung und Status. Daher auch der Titel „Eine
Arbeiterin“. Das Milieu der Arbeiter in Reims schilderte er bereits in seinem sehr erfolgreichen autofiktionalen Text „Rückkehr nach Reims“ in dem sich Didier Eribon intensiv mit Homophobie und
Rassismus im linken Arbeitermilieu auseinandersetzt.
Diesmal ist das Altern am Beispiel seiner Mutter das Thema seines Buches. Der subalterne Prozess des Altwerdens und Dahinsiechen, den man in allen Pflegeheimen der modernen industrialisierten Welt
beobachten kann, dokumentiert Eribon und schont sich dabei selbst nicht. Seine beiden Referenzbücher sind „Über das Altern“ von Simone de Beauvoir und „Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren
Tagen“ von Norbert Elias. Norbert Elias schreibt an einer Stelle seines Essays, dass „die Menschheit eine Gemeinschaft der Sterblichen ist und dass Menschen in ihrer Not, Hilfe nur von Menschen
erwarten können. Das gesellschaftliche Problem des Todes ist deswegen besonders schwer zu bewältigen, weil die Lebenden es schwer finden, sich mit den Sterbenden zu identifizieren.“ Weitere Referenz
ist sicher noch Michel Foucault und seine Studie über den Wahnsinn. Wobei bei Foucaults Studie ein wenig unterschlagen wird, dass das allgemeine Hospital erstmals ein weiches Bett für den Irren zur
Verfügung stellte. Norbert Elias beschreibt das mit größerer Sorgfalt gegenüber den unterschiedlichen Standpunkten.
Schon am Anfang des Buches zitiert Eribon den barocken Philosophen Descartes, der uns rät die eigenen Gedanken zu kontrollieren, die eigenen Wünsche der Realität anzupassen (Seite 19/20), anstatt zu versuchen, dem Schicksal zu trotzen. Dass Eribon seine Mutter in ein Pflegeheim einweisen lässt und sich in seiner Argumentation auf die Vernunft beruft, einzusehen, dass man krank ist, alt, und dass man eben ohne fremde Hilfe… genau so dachte ich auch bei meiner Mutter. Meine Mutter hat sich standhaft geweigert, hat ihre kleine Wohnung, die sie so liebte, nicht mehr verlassen. Erst ein Zusammenbruch und im Zustand großer Verwirrung wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Dort überlebte sie nur eine Nacht. Meiner Mutter blieb es erspart, über Wochen, Monate, ja manchmal Jahre als Pflegefall Stück für Stück jede Freiheit zu verlieren. Die durchschnittliche Dauer der Versorgung und Begleitung von heute sogenannten Pflegebedürftigen im Jahr 1935 soll drei Monate betragen haben, heute beträgt sie acht Jahre! Im Jahr 2050 werden wir in Deutschland drei Millionen Menschen mit Demenz haben. Aber schon im Jahr 2030 werden 500000 Beschäftigte für die Langzeitpflege fehlen!
Im Jahr 1920 formulierte der Freiburger Sozialmediziner Alfred Hoche in seinem Buch Die
Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens es folgendermaßen:
„In wirtschaftlicher Beziehung würden diese Vollidioten […]diejenigen sein, deren Existenz am schwersten auf der Allgemeinheit lastet. Es ist eine peinliche Vorstellung, dass ganze Generationen von
Pflegern neben diesen leeren Menschenhülsen dahin altern. Mitleid ist den geistig Toten gegenüber dem Leben und dem Sterbensfall die an letzter Stelle angebrachte Gefühlsregung. Wo kein Leiden ist,
ist auch kein Mit-Leiden.“
Das ist eine Formulierung, die wir heute grundsätzlich ablehnen, weil– wie es Norbert Elias
formuliert – „der Radius der Identifizierung heute größer ist, als in früheren Zeiten. Wir betrachten es nicht mehr als Sonntagsvergnügen, Menschen gehenkt, gevierteilt und gerädert zu sehen.“
Dennoch bleibt eine Leerstelle, eine Stille, die Eribon feststellt, ein Problem, sich mit einer Gruppe zu identifizieren, die kein Plural der ersten Person bekunden können, denen ein Wir fehlt, weil
sie keine Stimme mehr haben. Und sie werden auch keine in der Zukunft haben.
Insofern ist dies ein sehr trauriges Buch von Didier Eribon, der ja nun selbst schon über 70 Jahre alt ist und begonnen hat, zu altern. So mache ich es seit kurzem auch. Ich altere. Jeden Tag. Und ich kann meinen Körper präzise dabei beobachten, wie er diesen Kampf auf sich nimmt. Mein Körper wird ihn verlieren. Die heutige Medizin kann – wenn man ökonomisch in der Lage dazu ist – uns schon sehr alt machen, viel älter, als man je geworden ist. Doch der Unterschied zwischen Arm und Reich beträgt in den USA bereits über 20 Lebensjahre. Auch in Europa wird die Frage, ob man es sich wird leisten können in Zukunft, eine ganze Kohorte für acht Jahre (im Durchschnitt) voll pflegerisch zu versorgen, zunehmend drängender. Schon jetzt zeigt der Besuch eines Altenheims, selbst eines vorbildlich geführten und teuren Altenheims, dass der erste Artikel unseres Grundgesetzes nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Dem Personal fehlen die Ausbildung, das Versorgungsmaterial, die Zeit und sogar die berufliche Lobby, um die Würde des alternden Menschen zu wahren.
Daher braucht es diese traurigen Bücher. Wobei ich in diesen Analysen regelmäßig mein Unwohlsein spüre, weil ich keine Antworten habe auf all die drängenden Fragen.
Juni 2024
Herr Kiyak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an
Von Mely Kiyak
Erschienen im Verlag Hanser 2024
Morituri te salutant. So grüßten die Gladiatoren einst Caesar beim Einlaufen in die Arena. Sie
hätten auch sagen können: „Morituri moriturum salutant“. Denn nicht nur die Gladiatoren waren Sterbliche. Auch die Cäsaren aller Welt sterben einmal. So ist – schreibt Norbert Elias – die
Menschheit eine Gemeinschaft der Sterblichen und kann in ihrer Not Hilfe nur von Menschen erwarten. Niemand sonst, als der Mensch hilft dem Menschen. Und so konnte J.P. Sartre in seinem Stück
„Geschlossene Gesellschaft“ eine seiner Figuren sagen lassen: „Die Hölle sind immer die anderen.“
Auch wenn die Autorin gelegentlich als hartnäckig und beinahe lästig erscheinen mag; sie hat ihrem Vater geholfen zu sterben. Sie hat ihn nicht allein gelassen und dieses Sterben in ihrem Buch auch
öffentlich gemacht. Tatsächlich wurde früher viel öffentlicher gestorben. Eine Tatsache, die damit zusammen hängt, dass wir Menschen enger zusammenlebten und uns die Lebensräume teilten. Aber
auch der Tod war uns näher, weil wir nicht so alt wurden. In vorindustriellen Zeiten lag das Durchschnittsalter bei grade mal 40 Jahren. Selbst junge Menschen waren mit dem Sterben vertraut, erlebten
es tagtäglich und konnten diesen Fakt nicht so totschweigen, wie das heute der Fall ist. Der Tod erscheint beinahe als peinlich, zumindest als etwas worüber man nicht redet. Ich habe das mehr als
einmal erlebt, dass ich mit meiner vorlauten und naiven Art für Unruhe sorgte, nur weil ich das Memento mori ansprach. Es war, als hätte ich einen lauten Furz gemacht und dazu auch noch gelacht. So
etwas tut man einfach nicht. Und Mely Kiyak hat es gemacht und sie machte es eindrucksvoll und aus ihrer Perspektive. Ihre Wut, ihre Hilflosigkeit ihr ganzes Herz und ihre Liebe zu ihrem Vater wurde
zu einer Geschichte des Sterbens eines Mannes. Aber eben nicht nur eines Mannes. Mely Kiyak schildert den Klinikalltag, die Desinformationen, die Daseinshygiene bis zum Essen, das den Geschmack von
Sterilium angenommen hat. Sie schildert ihr Mitleiden und erspart sich dabei nicht das genaue Hinsehen. Es muss ihr jeder Satz noch einmal Schmerzen verursacht haben, wenn sie beschreibt, wie ihr
Vater nach der Lungenpunktion „schlapp und verschwitzt, gelb und eingefallen“ ist und die Krankenschwester ihm „einen komischen Fummel umbindet“.
Der Vater, der tapfer und stoisch erträgt, aushält, dabei verschwindet, Stück für Stück sich auflöst, und eine Tochter, die sich wehrt, die seine Stimme wird.
Denn das ist das Drama der Einsamkeit der Sterbenden, dass sie, die schwach und alt und gebrechlich werden mehr und mehr ihre Stimme verlieren. „Wie kann man die Handlungen der Menschen denken, die nicht mehr selbst handeln können, wie die Stimme der Menschen, die nicht mehr für sich selbst sprechen können?“ So fragt sich Didier Eribon in seinem Buch „Eine Arbeiterin“ in der er die letzten Tage seiner Mutter im Altenheim beschreibt. Auch hier ist der Alltag klinisch, klinisch im Sinne des Aussortiertseins. Sekrete, Schleim, Bakterien werden weggewischt, aber damit auch das Leben. Doch das Problem beschreibt Mely Kiyak treffend: „…ich sagte es bereits mehrmals, einiges ist so unfassbar beknackt in diesem Krankenhaus, aber es ist unmöglich einzuschreiten, die Schwestern verbreiten mit ihrem täglichen Unmut über ihre Arbeitsbedingungen ein Klima, das es verbietet, sich zu beschweren und so ist ihre ständig an der Grenze zum Zusammenbruch gespannte Stimmung penetrant dominant und bewirkt, dass man sich ängstigt und es erträgt mitanzusehen, wie die Patienten beschallt werden.“ Die Beschallung findet in einem Raum statt, wo die Menschen an Nadeln hängen, schlapp, wehrlos sind, Chemie, tödliche Chemie wird in sie hinein gepumpt und das Radio läuft, eine Plappersendung, banal und dumm. Dabei ist nicht sicher, wie die an den Nadeln hängenden Patienten das Gedudel wahrnehmen. Es könnte sogar sein, dass dieses Gedudel ein Stück Leben ist, das man in seiner ganzen Leichtigkeit noch aufnehmen kann.
Ganz nach dem Motto von Martin Opitz, einem schlesischen Dichter des 17. Jahrhunderts:
Laß‘ ich schon nicht viel zu erben
Ey so hab ich edlen Wein;
Will mit andern lustig seyn /
Wann ich gleich allein muß sterben
Diese Allein könnte bedeuten, dass man den Sterbeprozess mit niemanden teilen kann, es kann aber auch bedeuten, dass man im Sterben von allen Menschen die einem etwas bedeuten allein gelassen wird. Norbert Elias meinte, dass man wohl mit anderen lustig sein könne, aber allein sterben müsse, sei zwar eine bekannte Vorstellung und heute noch im Gebrauch, aber weit weniger universal als das Bemühen der Menschen, eine Erklärung dafür zu finden, dass sie sterben müssen. Die Art des Sterbens hängt nicht zuletzt auch davon ab, ob und wieweit ein Mensch die Möglichkeit hat, sich für sein Leben Ziele zu setzen und sie zu erreichen. Tolstoi erzählte in „Herr und Arbeitsmann“ wie ein Herr und sein Kutscher verunfallen und im Schnee begraben sterben. Während sich der Herr verzweifelt wehr, findet sich der Kutscher leicht damit ab. „Der Gedanke an den Tod, der ihn wahrscheinlich noch in dieser Nacht ereilen würde, stieg in ihm auf, aber er hatte gar nichts Peinliches oder Furchtbares für ihn. Das lag daran, daß er sein Lebtag wenig frohe Feste, dafür aber viele saure Wochen gehabt hatte, und er war der ununterbrochenen Arbeit müde.“
Herr Kiyak dagegen hat gerade angefangen, sein hartes Leben zu genießen, eine Geliebte in der Türkei und ein gutes Leben vor sich, den Lohn der Mühen…
Der französische Schriftsteller André Malraux (1901 – 1976) schrieb einmal: „Die Tragödie des Todes ist, dass sie das Leben in Schicksal verwandelt.“ Das Leben weicht zurück und alles war einmal. Und vor uns ist kein Geheimnis, keine Tür öffnet sich. Was von uns bleibt, ist die Erinnerung der anderen an uns. Das ist der andere starke Anteil an dem Buch von Mely Kiyak. Ihr Vater ist nicht nur der Sterbende, an Lungenkrebs erkrankte Gastarbeiter, er entstammt der Sippe der Xeramen, aus der östlichen Provinz Bingöl (Anatolien), aus der Stadt Kiğı 1700 Meter über dem Meer gelegen. Dort lebten überwiegend Aleviten. Daher ist Herr Kiyak auch ein Humanist, ein Sozialist und ein weltoffener Mensch. Seine Erzählungen über seine Herkunft, seine Familie sind archaisch. Die Schlusserzählung ist fast nicht auszuhalten, als er für seine totkranke Tochter einen Arzt sucht. Es ist ein schönes Ende und vermeidet das Ende. Denn durch das Buch von Mely Kiyak bleibt auch ihr Vater, bleiben sein Bruder Ismo, bleibt Kiyaks Baba. Diese Kraft des Erzählens bleibt.
17. Mai 2024
Kafkas Amerika
Einleitung
Insgesamt hat Kafka drei Romane geschrieben. 1911 beginnt er seinen ersten Roman „Der
Verschollene“ (später von Max Brod als „Amerika-Roman“ bezeichnet). Noch als er 1913 die Fragmente von Bruneldas Ausreise und dem Naturtheater von Oklahoma schrieb, begann er mit dem zweiten
Roman „Der Prozess“.
Das Anfangskapitel „Der Heizer“ wurde 1913 von Kurt Wolff in der Schriftreihe „Der jüngste Tag“ veröffentlicht. Der Rest des Romans wurde erst 1927 von Max Brod herausgegeben, ebenfalls im Kurt Wolff
Verlag unter dem Titel „Amerika“. Kafkas Bild von Amerika stammte nachweislich von dem Reisebericht „Amerika heute und morgen“, den der ungarische Reiseschriftsteller Arthur Holitscher 1912
herausbrachte im Auftrag von Samuel Fischer. Darin gibt es ein Kapitel mit der Überschrift „Neger“.
Und ein Bild wird gezeigt von einem Farbigen, der an einem Baum hängt und eine Gruppe Weißer steht dabei, als wären sie eine Gruppe Großwildjäger und präsentierten hier ihre Beute. Hollitscher schreibt dazu: Amerika darf sich nicht wundern darüber, daß es sich an dem Neger einen gefährlichen inneren Feind großzieht. Daß das Prinzip der Demokratie, hier einmal wieder an dem lebenden Exempel verhöhnt, einen grimmigen Verachter bekommt in der Gestalt des durch dasselbe Prinzip freigewordenen Farbigen.
In dem Fragment mit dem Titel „Das Naturtheater von Oklahoma“ nennt sich der Protagonist von Kafka, der eigentlich Karl Roßmann heißt, Negro.
Aus dem Fragment „Das Naturtheater von Oklahoma“
Er nannte daher, da ihm im Augenblick kein anderer Name einfiel, den Rufnamen aus seinen letzten Stellungen: »Negro«.
»Negro?« fragte der Leiter, drehte den Kopf und machte eine Grimasse, als hätte Karl jetzt den Höhepunkt der Unglaubwürdigkeit erreicht. Auch der Schreiber sah Karl eine Weile lang prüfend an, dann aber wiederholte er »Negro« und schrieb den Namen ein.
»Sie haben doch nicht Negro aufgeschrieben?« fuhr ihn der Leiter an.
Nebenbei, Arthur Holitscher starb nahezu in Vergessenheit geraten 1941 in Genf. Die Grabrede hielt der nicht weniger aus der Erinnerung der Menschen gefallene Robert Musil. Musil hatte dann ein Comeback. Holitscher leider nicht. Doch sein Reisebericht ist noch heute absolut lesbar und zu empfehlen.
Der Verschollene (von Franz Kafka)
Der siebzehnjährige Karl Roßmann wird von seinen Eltern in die USA geschickt, da er von einem Dienstmädchen „verführt“ wurde und dieses nun ein Kind von ihm bekommen hat. Im Hafen von New York angekommen, trifft er noch auf dem Schiff einen reichen Onkel, der ihn zu sich nimmt und von dessen Reichtum Karl nun lebt. Doch bald verstößt der Onkel den Jungen, als Karl die Einladung eines Geschäftsfreundes des Onkels zu einem Landhausbesuch eigenmächtig annimmt. Der ohne Aussprache vom Onkel auf die Straße gesetzte Karl lernt zwei Landstreicher kennen, einen Franzosen und einen Iren, die sich seiner annehmen, freilich immer zum Nachteil von Karl. Wegen des Iren verliert er eine Anstellung als Liftjunge in einem riesigen Hotel mit bedrückenden Arbeitsbedingungen. Anschließend wird er in einer Wohnung, die die beiden Landstreicher mit der dickeren älteren Sängerin Brunelda teilen, gegen seinen Willen als Diener angestellt und ausgenutzt.
Die Handlung bricht an dieser Stelle ab. Die Kritische Kafka-Ausgabe führt danach zwei Textfragmente an, von denen das zweite das bekannte „Naturtheater von Oklahoma“ ist. Im ersten Textfragment schiebt Karl Brunelda in einem Rollstuhl durch die Straßen der Stadt zu dem „Unternehmen Nr. 25“. In dem zweiten, dem von einigen vermuteten Abschlusskapitel, entdeckt Karl ein Plakat für ein Theater in Oklahoma (Kafka schrieb durchgehend „Oklahama“), das allen Menschen Beschäftigung verspricht. Karl wird nach einer peniblen Befragung von den Werbern des Theaters aufgenommen, freilich nur „für niedrige technische Arbeiten“. Dieser Textteil endet mit der langen Zugfahrt nach Oklahoma, wo Karl zum ersten Mal die „Größe Amerikas begreift“.
Kapitel 1 Der Heizer
Erzählt wird die Geschichte von dem siebzehnjährigen (auch mal sechszehnjährigen) Karl Roßmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekommen hatte... .
Die Geschichte setzt an, als das Schiff in den Hafen von Newyork einläuft. Zunächst sieht Karl die Freiheitsgöttin: „Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte.“
Kafka machte aus der Fackel die von der amerikanischen Libertas hochgereckt wird, ein
Schwert.
Der Junge hat in Amerika kein Ziel vor Augen. Einen Koffer, etwas Erspartes und eine Veroneser Salami sind sein ganzer Besitz.
Bereits im Hafen bemerkt Karl, dass er seinen Regenschirm vergessen hat und vertraut seinen Koffer einem Bekannten an. Im Schiff selbst merkt Karl zum ersten Mal wie groß das Schiff ist und verirrt sich zum „Heizer“[1]. Der Heizer gewinnt schließlich das Vertrauen von Karl, erzählt ihm von seinen Leiden auf dem Schiff, vor allem von der ungerechten Behandlung durch den Rumänen Schubal. Karl ist empört und verwundert sich, dass der Heizer sich nicht zu wehren versteht. Er überredet schließlich den Heizer, zum Kapitän zu gehen und seine Beschwerde über Schubal vorzutragen. Dort wird er von seinem Onkel Jakob erkannt. Dieser Onkel bekam von dem Dienstmädchen welches K. verführte einen Brief, er möge sich seines Neffen in Amerika annehmen. Der Onkel ist in einer hohen Position. Es ist der Staatsrat „Edward Jakob“. Zunächst will Karl seinen Onkel nicht kennen: „Ich habe allerdings einen Onkel Jakob in Amerika“, sagte Karl zum Kapitän gewendet, „aber wenn ich recht verstanden habe, lautet bloß der Zuname des Herrn Staatsrat Jakob.“....“Nun, mein Onkel Jakob, welcher der Bruder meiner Mutter ist, heißt aber mit dem Taufnamen Jakob während sein Zuname natürlich gleich jenem meiner Mutter lauten müßte, welche eine, geborene Bendelmeyer ist.“
Dies verursacht nur ein allgemeines Lachen, welches Karl Roßmann unangenehm ist. Schließlich wird die „Sache“ des Heizers abgehandelt: „Dem Heizer wird geschehn, was er verdient,“ sagte der Senator „und was der Herr Kapitän erachtet. Ich glaube wir haben von dem Heizer genug und übergenug, wozu mir jeder der anwesenden Herren sicher zustimmen wird.“
Karl wird dem Onkel in Pflege gegeben und sie verlassen das Schiff.
Kapitel 2 Der Onkel
Im zweiten Kapitel verlebt Karl eine mehr oder weniger geschützte Episode im Hause des Onkels.
Der Onkel kam ihm aber auch in jeder Kleinigkeit freundlich entgegen. Nur darf Karl keine eigenen Schritte wagen. Er bekommt einen Lehrer zugeteilt, trifft sich (obwohl er nicht wirklich
will) mit einem Bekannten, der ihm Reitunterricht erteilt. Das Geschäft des reichen Onkels von Karl Roßmann beschreibt Kafka so:
Das Geschäft bestand nämlich in einem Zwischenhandel, der aber die Waren nicht etwa von den Produzenten zu den Konsumenten oder vielleicht zu den Händlern vermittelte, sondern welcher die
Vermittlung aller Waren und Urprodukte für die großen Fabrikskartelle und zwischen ihnen besorgte. Es war daher ein Geschäft, welches in einem Käufe, Lagerungen, Transporte und Verkäufe riesenhaften
Umfangs umfaßte und ganz genaue, unaufhörliche telephonische und telegraphische Verbindungen mit den Klienten unterhalten mußte.
In dieses ungeheure Netzwerk (einem Sinnbild des globalisierten Kapitalismus) sind auch die Angestellten eingespannt.
Im Saal der Telephone gingen, wohin man schaute, die Türen der Telephonzellen auf und zu, und das Läuten war sinnverwirrend. …man sah dort im sprühenden elektrischen Licht einen Angestellten, gleichgültig gegen jedes Geräusch der Türe, den Kopf eingespannt in ein Stahlband, das ihm die Hörmuscheln an die Ohren drückte. Der rechte Arm lag auf einem Tischchen, als wäre er besonders schwer, und nur die Finger, welche den Bleistift hielten, zuckten unmenschlich gleichmäßig und rasch. In den Worten, die er in den Sprechtrichter sagte, war er sehr sparsam…
Dieses Bild – man denkt gleich an die moderne Callcenter-Sklaverei – ist von höchster Klaustrophobie. In den zwar riesigen Fabriken, haben die Menschen nur ganz wenig Platz. Die Maschine ist dabei die Hauptsache. Der Mensch ist ein Teil der Maschine geworden, eingezwängt in die maschinellen Abläufe. Zugleich herrscht größte Hektik im Arbeitsbetrieb.
Keiner grüßte, das Grüßen war abgeschafft, jeder schloß sich den Schritten des ihm
vorhergehenden an und sah auf den Boden, auf dem er möglichst rasch vorwärtskommen wollte, oder fing mit den Blicken wohl nur einzelne Worte oder Zahlen von Papieren ab, die er in der Hand hielt und
die bei seinem Laufschritt flatterten….
Alle Entwicklungen gehen hier so schnell vor sich“, sagte der Onkel, das Gespräch abbrechend.
Zur dritten Wende der Geschichte kommt es, als ein gewisser Herr Pollunder auftritt: „Herr Pollunder“, sagte der Onkel, er war in der Abenddämmerung des Zimmers kaum zu erkennen, „Herr Pollunder ist gekommen, um Dich auf sein Landgut mitzunehmen, wie wir es gestern besprochen haben.“
Karl ist überrascht: „Ich wußte nicht daß es schon heute sein sollte“.
Kapitel drei Ein Landhaus bei New York
Der Onkel reagiert undurchsichtig. Herr Pollunder ist ein „satter Typ“, dick und stattlich. Karl wird also mitgerissen, fährt auf das Landgut, wo die Tochter des Herrn Pollunder, Klara, bereits auf Karl wartet. Dort angekommen ist Karl bereits von der langen Autofahrt ermüdet. Zwar belebt ihn noch die frische Landluft, aber die überraschende Anwesenheit des Herrn Green irritiert Karl. Aber auch Herr Pollunder ist zunächst erbost über diesen überraschenden Besuch, da dies bedeutet, dass er für Karl keine Zeit hat. So wird Karl ganz in die Obhut Klaras gegeben. Doch mit ihr streitet er. Sie kämpfen regelrecht miteinander. Dennoch bittet ihn Klara, er möge noch nachts in ihr Zimmer kommen. Dies ist für Kafka eine übliche Zweideutigkeit in seiner Beziehung zu Frauen. Der Hauptprotagonist wird wieder einmal verführt (sei es Karl durch Klara, sei es Josef K. durch Leni, sei es der Landvermesser K. durch Frieda). Doch in dieser Verführung liegt schon der Keim des Übels. Karl wehrt sich also gegen Klara. Karl will jetzt nur wieder zum Onkel zurück. Schließlich plagt ihn das schlechte Gewissen.
Doch Mr. Green übergibt ihm nach Mitternacht einen Brief vom Onkel, worin Karl vom Onkel verstoßen wird. Darin heißt es: Du hast Dich gegen meinen Willen dafür entschieden, heute Abend von mir fortzugehen, dann bleibe aber auch bei diesem Entschluß Dein Leben lang; nur dann war es ein männlicher Entschluß.
Der Onkel wirf dem Neffen vor, dass er mit Herrn Pollunder gegangen ist, obwohl er es selbst arrangiert hatte. Es war damit eine Art Falle. Eine Lebensfalle. Eine Hinterlist, die der naive Karl Roßmann nicht durchschaute. Die Gesetzmäßigkeiten des Lebens verfügen über eine unerklärliche Logik. Karl wird ein weiteres Mal verstoßen und jedes Mal wurde er dazu verführt. Mr Green hat den Brief gebracht, gibt Karl seinen Koffer und seinen Regenschirm und schiebt ihn zur Tür raus.
Karl stand erstaunt im Freien. …Schließlich sagte er sich, daß er ja nicht unbedingt nach New York müsse, wo ihn niemand erwarte und einer sogar mit Bestimmtheit nicht erwarte. Er wählte also eine beliebige Richtung und machte sich auf den Weg.
Kapitel vier Weg nach Ramses
In dem kleinen Wirtshaus, in das Karl nach kurzem Marsch kam, und das eigentlich nur eine kleine letzte Station des New Yorker Fuhrwerkverkehrs bildete und deshalb kaum für Nachlager benützt zu werden pflegte, verlangte Karl die billigste Bettstelle, die zu haben war, denn er glaubte, mit dem Sparen sofort anfangen zu müssen. Er wurde, seiner Forderung entsprechend, vom Wirt mit einem Wink, als sei er ein Angestellter, die Treppe hinaufgewiesen, wo ihn ein zerrauftes, altes Frauenzimmer, ärgerlich über den gestörten Schlaf, empfing und, fast ohne ihn anzuhören mit ununterbrochenen Ermahnungen, leise aufzutreten, in ein Zimmer führte, dessen Tür sie, nicht ohne ihn vorher mit einem Pst! Angehaucht zu haben, schloß.
Es ist wie ein Hineinkriechen in den Kaninchenbau der Subalternität. Karl stürzt regelrecht ab. Er verliert die Protektion seiner Familie und hat nur noch sich selbst und einen lächerlichen Koffer und einen Regenschirm. Es ist keine ordentliche Schlafstätte mir, wo er unterkommt.
Das Zimmer hatte zwei Betten, die aber beide schon besetzt waren. Karl sah dort zwei junge Leute, die in schwerem Schlafe lagen und vor allem deshalb wenig vertrauenswürdig erschienen, weil sie, ohne verständlichen Grund, angezogen schliefen; der eine hatte sogar seine Stiefel an.
Es handelt sich dabei um die beiden Streuner Delamarche und Robinson. Obdachlose die hier Unterschlupf fanden. Die beiden hängen sich an Karl dran.
… die Zimmerfrau kam herein, genau so verschlafen wie in der Nacht, und trieb alle drei auf den Gang hinaus, mit der Erklärung, daß das Zimmer für neue Gäste hergerichtet werden müsse.
…Auf dem Gange mußten sie lange hin und her gehen, und besonders der Franzose, der sich in Karl eingehängt hatte, schimpfte ununterbrochen, drohte, den Wirt, wenn er sich vorwagen sollte, niederzuboxen, und es schien eine Vorbereitung dazu zu sein, daß er die geballten Fäuste rasend aneinander rieb.
Zu leicht fasst Karl Roßmann zu ihnen Vertrauen. Es ist ein Muster, ein Leitmotiv bei Kafka. Die Menschen, ob Frauen oder Männer fassen schnell Freundschaft mit der Hauptfigur, aber Karl ist eigentlich nur passiv dabei. Die beiden halten sich an Karls wenigen Besitztümern schadlos. Auf der Suche nach Arbeit gehen die drei ein Stück Wegs gemeinsam. Karl wird eines Abends beauftragt, Essen aus dem Hotel Occidental zu beschaffen. Die dortige Oberköchin ist Karl gegenüber sehr fürsorglich und bietet ihm Logis und Arbeit an. Karl geht aber zurück zu seinen Kumpanen. Dort wird er sehr ärgerlich, da sie seinen Koffer aufgebrochen haben und nun das Foto seiner Eltern verschwunden ist. So nimmt er das Angebot der Oberköchin doch an und trennt sich von den beiden zwielichtigen Begleitern.
Kapitel fünf Hotel Occidental
Karl kommt im Hotel occidental als Liftjunge unter. Gefördert wird er hier von der Oberköchin. Er freundet sich mit ihrer Sekretärin Therese an. Diese erzählt ihm die tieftraurige Geschichte vom Tod ihrer Mutter, die von Ziegeln erschlagen wird, auf der Suche nach einer Schlafstätte.
Der Job als Liftjunge ist zwar hart, aber Karl fügt sich.
»Der Dienst hier muß wirklich sehr anstrengend sein«, sagte Karl. »Unten habe ich jetzt einen Liftjungen stehend schlafen gesehen.«
»Dabei haben es die Liftjungen noch am besten«, sagte sie, »die verdienen ihr schönes Geld an Trinkgeldern und müssen sich schließlich doch bei weitem nicht so plagen wie die Leute in der Küche.
Bald lernte Karl auch die kurzen, tiefen Verbeugungen machen, die man von den Liftjungen verlangt, und das Trinkgeld fing er im Fluge ab
Kapitel 6 Der Fall Robinson
Eines Tages taucht der ehemalige Gefährte Robinson bei Karl auf. Er ist betrunken und benimmt sich daneben. Im Bemühen, ihn los zu werden, verlässt Karl kurz seinen Posten. Er bringt Robinson in den gemeinsamen Schlafsaal der Liftjungen.
»Hier können Sie nun einmal nicht bleiben«, sagte Karl, »bedenken Sie doch, wo Sie sind. Wenn man Sie hier findet, werden Sie bestraft, und ich verliere meinen Posten. Wollen Sie das?«
»Ich kann nicht weggehen«, sagte Robinson, »lieber springe ich da hinunter«, und er zeigte zwischen den Geländerstangen in den Lichtschacht.
Als Karl wieder bei seinem Aufzug angelangt war, sah er, daß sowohl sein Aufzug als auch jener seines Nachbarn gerade in die Höhe fuhren. Unruhig wartete er darauf, wie sich das aufklären würde. Sein Aufzug kam früher herunter, und es entstieg ihm jener Junge, der vor einem Weilchen durch den Gang gelaufen war.
»Ja, wo bist du denn gewesen, Roßmann?« fragte dieser.
»Warum bist du weggegangen? Warum hast du es nicht gemeldet?«
Die kurze Abwesenheit von seinem Posten am Lift kommt Karl teuer zu stehen. Er wird vom Oberkellner und vom Oberportier als unwürdig bezeichnet und gerät in einen Komplott aus verschiedensten Beschuldigungen, wird sogar mit einem anderen Liftjungen verwechselt, für den Karl häufiger den Posten übernahm. Zwar versucht die Oberköchin noch, ein gutes Wort für Karl einzulegen, aber es gelingt ihr nicht. Karl wird entlassen und kann noch froh sein, dass er nicht sogar eingesperrt wird.
Als Karl gehen will, schnappt ihn sich noch der Oberportier und spielt Karl übel mit, auch verliert Karl dabei das Empfehlungsschreiben der Oberköchin.
Karl flüchtet und sieht vor dem Hotel den übel zugerichteten Robinson. Die Liftjungen haben ihn verprügelt. Robinson bittet Karl um seine Hilfe. Schließlich fahren sie mit dem Taxi zu Delamarche. Am Ziel angekommen, will sich Karl gleich verdrücken, er möchte weder mit Robinson und erst recht nichts mit Delamarche zu tun haben. Allerdings verlangt der Taxichauffeur das Fahrgeld von Karl. Dieser hat allerdings kein Geld mehr. Es kommt ein Polizist und verlangt Karls Ausweispapiere. Aber auch ausweisen kann sich Karl nicht. Schließlich kommt Delamarche und versucht, die Sache zu regeln, er kümmere sich um Karl.
Kapitel 7 Ein Asyl
Karl flüchtet, aber er wird von Delamarche gestellt und schließlich in die sehr hoch gelegene Wohnung gebracht, in der vor allem die ehemalige Sängerin Brunelda mit Delamarche als Geliebten und Robinson als Diener lebt. Karl soll nun die Dienerschaft von Robinson übernehmen. Es ist allerdings eine sehr unangenehme Tätigkeit, da Delamarche sehr jähzornig ist und Brunelda eine sehr affektierte und unschlüssige Dame von Welt (auch sehr fett).
Als Karl einmal eine Unaufmerksamkeit von Delamarche und Brunelda, die ihn weiter festhalten, nutzt, um zu fliehen, wird er von Robinson zu Fall gebracht und von Delamarche heftig verprügelt.
Karl wacht aus seiner Bewusstlosigkeit auf dem Balkon auf. Dort lernt er den Studenten auf dem Nachbarbalkon kennen.
Als er zur Besinnung kam, war es um ihn ganz finster, es mochte noch spät in der Nacht
sein, vom Balkon her drang unter dem Vorhang ein leichter Schimmer des Mondlichts in das Zimmer….Er mute ans Licht, um seinen Zustand genau festzustellen, vielleicht hatte man ihn zum Krüppel
geschlagen…
…Das Rücken eines Tisches auf dem Nachbarbalkon machte Karl aufmerksam, dort saß ja jemand und studiert. Es war ein junger Mann mit einem kleinen Spitzbart, an dem er beim Lesen, das er mit raschen
Lippenbewegungen begleitete, ständig drehte. Er saß, das Gesicht Karl zugewendet, an einem kleinen, mit Büchern bedeckten Tisch, die Glühlampe hatte er von der Mauer abgenommen, zwischen zwei große
Bücher geklemmt, und war nun von ihrem grellen Licht ganz überleuchtet.
Es stellt sich heraus, dass der Student tagsüber als Verkäufer arbeitet „eher schon als Laufbursche im Warenhaus von Montly.“ Es ginge nicht anders, vor Jahren sei er nur Student gewesen und wäre fast verhungert. …habe in einer schmutzigen alten Höhle geschlafen und wagte mich in meinem damaligen Anzug nicht in die Hörsäle.
„Aber wann schlafen Sie?“ fragte Karl und sah den Studenten verwundert an.
„Ja, schlafen?“ sagte der Student. „Schlafen werde ich, wen ich mit meinem Studium fertig bin. Vorläufig trinke ich schwarzen Kaffee.“
Der Student studiert aber nicht gerne, nur aus Konsequenz macht er das noch. Es interressiert gar nicht mehr. Seinen mickrigen Posten als Laufbursche bezeichnet der Student als seinen größten Erfolg im Leben.
So schwer ist es, dort einen Posten zu bekommen“, sagte Karl mehr für sich.
„Ach, was denken Sie denn“, sagte der Stundet, „es ist leichter, hier Bezirksrichter zu werden als Türöffner bei Montly.“
Das Kapitel endet, indem sich Karl in seine neue Rolle fügt: Brunelda nickte Delamarche befriedigt zu und reichte Karl zum Lohn eine Handvoll Keks.
Wenn aber Karl einmal einen solchen Posten in einem Büro hätte, dann wollte er sich mit nichts anderem beschäftigen als mit seinen Büroarbeiten und nicht die Kräfte zersplittern wie der Student. Wenn es nötig sein sollte, wollte er auch die Nacht fürs Büro verwenden, was man ja im Beginn bei seiner geringen kaufmännischen Vorbildung sowieso von ihm verlangen würde. Er wollte nur an das Interesse des Geschäftes denken, dem er zu dienen hätte, und allen Arbeiten sich unterziehen, selbst solchen, die andere Bürobeamte als ihrer nicht würdig zurückweisen würden. Die guten Vorsätze drängten sich in seinem Kopf, als stehe sein künftiger Chef vor dem Kanapee und lese sie von seinem Gesicht ab.
In solchen Gedanken schlief Karl ein und nur im ersten Halbschlaf störte ihn noch ein gewaltiges Seufzen Bruneldas, die, scheinbar von schweren Träumen geplagt, sich auf ihrem Lager wälzte.
Die Fragmente
In den Fragmenten gibt es einen Umzug von Brunelda und Karl, der jetzt wohl die Rolle Delamarche inne hat, während der Student die Rolle Karls ausfüllt.
Im zweiten, erhaltenen Fragment lässt sich Karl in das „Teater Oklahama“ aufnehmen. Dieses „große Teater“ verspricht auf Plakaten, jeden aufzunehmen und ihm/ihr einen Posten zu verschaffen.
Dort trifft er Giacomo, einen alten Bekannten, einen Liftjungen aus dem „Hotel occidental“. Der Junge ist überhaupt nicht gealtert.
Karl wird als technischer Gehilfe aufgenommen und alle fahren mit dem Zug zu ihrem ersten Auftritt.
„Man muß nicht alles für wahr halten, man muß es nur für notwendig halten“ (aus dem „Prozeß“)
Diese Worte, die der Gefängniskaplan an K. richtet um ihn zu trösten, trösten K. nicht. Die tiefere Wahrheit dieses Satzes lässt sich gewissermaßen auf den „Amerika-Roman (Max Brod)“ übertragen. Dort handelt es sich um den Freiheitsbegriff. Zu Beginn des Romans sieht Karl das 46 Meter hohe weibliche Standbild der Freiheitsgöttin am Hafen von New York stehen und sagt sich: „So hoch“ und wird, wie er so gar nicht an das Weggehn dachte, von der immer mehr anschwellenden Menge der Gepäckträger, die an ihm vorüberzogen, allmählich bis an das Bordgeländer geschoben.
Niemand ist im Grunde so frei wie Karl Roßmann in Amerika. Aber niemand wird gleichzeitig so sehr seiner Eigenkontrolle beraubt, die er sich immer wieder zurück erkämpfen muss. Es ist im Grunde der doppelt freie Lohnarbeiter von dem Karl Marx gesprochen hat.
Der Lohnarbeiter darf seine Arbeit verkaufen, denn er ist frei (kein Sklave).
Doch er muss seine Arbeit verkaufen, denn er ist von Produktionsmitteln "frei" - kann mit seiner Arbeitskraft allein nicht viel anfangen. Der Student ist exakt die Schilderung von Karl Marx.
Schon zu Beginn setzt sich Karl für den Heizer ein, gegen den ungerechten Schubal. Doch bleibt es für den Leser ganz im Unklaren, ob der Heizer wirklich unschuldig ist. Karl kennt keineswegs alle Einzelheiten. Er muss sich auch geschlagen geben, da schließlich der Kapitän und der Onkel mächtiger sind. Aber Karl zweifelt: Es war wirklich, als gebe es keinen Heizer mehr. Karl faßte den Onkel, mit dessen Knien sich die seinen fast berührten, genauer ins Auge und es kamen ihm Zweifel, ob dieser Mann ihm jemals den Heizer werde ersetzen können. Auch wich der Onkel seinem Blicke aus und sah auf die Wellen hin, von denen ihr Boot umschwankt wurde.
Vom Onkel verstoßen landet Karl am Ende beim verbrecherischen Streuner Delamarche und Robinson. Karl kann sich weder gegen den böswilligen Mr. Green wehren, noch gegen den Komplott des Oberportiers.
Karl trifft seine Entscheidungen sehr wohl von sich aus, muss sich aber stets den Notwendigkeiten beugen. Auch hier ist wie im Prozess, der Existenzialismus vorgedacht; Karl wählt sich selbst gegen das bewusst gewordene Nichts.
Auch die Wahl des Richters, die Karl Roßmann von Bruneldas Balkon aus beobachtet, wird in ihrem Tumult und in ihrer Lächerlichkeit ein Nichts aus dem heraus man sich nur selbst wählen kann. Die Freiheit wird von Bruneldas Balkon aus zu einer Farce. Die Wahlveranstaltung die vom Balkon aus beobachtet wird, ist mehr eine „Show“ als eine reale Angelegenheit.
Notizen
Den amerikanischen Traum hat Kafka schon Anfang des 20. Jahrhunderts durchschaut. Allein die Schilderung von Thereses Mutter und deren Tod auf der Suche nach einer Unterkunft (Therese ist Küchenhilfe im Hotel Occidental und Karl Roßmanna freundet sich mit ihr an, sie trifft er auch in Naturtheater in Oklahoma wieder), ist so erschreckend, die Schilderung von Armut und Not so eindringlich, dass der amerikanische Traum und die große Freiheit daran zerschellt. Außerdem die Schilderung des Schlafraums der Liftjungen, der 12stündige Arbeitstag, dabei immer wieder Schichtwechsel, kaum Schlaf, Geringachtung, all das schildert ein Amerika, das gegenüber Europa rückständig ist.
Kafkas Koffer
Ein Versatzstück (ein absurder McGuffin), das immer wieder symbolische Wirkkraft entfaltet ist Kafkas Koffer, von Beginn an mit absurder Wichtigkeit aufgeladen, obwohl nichts Großartiges in ihm ist, einer Veroneser Salami, ein paar alte Anzüge, das Foto seiner Eltern - die ihn doch verstoßen haben. Dennoch ist der Koffer Symbol der alten Heimat, und zugleich trauriges Symbol der Freiheit. Der Koffer wird so immer wieder zum Spiegel der Befindlichkeit Roßmanns. Wenn er von Delamarche und Robinson achtlos durchsucht wird, wenn er dann bei der Oberköchin im Hotel Occidental ordentlich dasteht, immer wieder ist Kafkas Koffer allein eine ausführliche Betrachtung wert. Es lohnt sich daher, den Koffer einmal in seiner sprachlichen Bedeutung zu umschreiben. So kommt das Wort Koffer aus dem Arabischen quffa für Flechtkorb, im jiddischen der Kaffer, und umgangssprachlich im österreichischen für Dummerchen stehend.
...und daß doch alles vergebens gewesen war, denn nun war dieser Liftjungendienst nicht wie er gehofft hatte, eine Vorstufe zu besserer Anstellung gewesen, vielmehr war er jetzt noch tiefer herabgedrückt worden und sogar sehr nahe an das Gefängnis geraten. So beschreibt Kafka Roßmanns Werdegang nach der Katastrophe im Hotel Occidental, nachdem es zu Verdrehungen und falschen Anschuldigungen kam. Kafka gelingt hier brillant, zu demonstrieren, wie man mit denen, die man heute zum "Prekariat" zählt schon damals umging. Aus dem Traum vom sozialen Aufstieg wird der Alptraum des sozialen Abstiegs. Kafkas Roman von 1912 zeigt, dass dieser Traum vom Tellerwäscher zum Millionär schon vor fast hundert Jahren eigentlich ausgeträumt war, bzw. deckt Kafka ganz im Sinne der kritischen Analyse der Frankfurter Schule diesen Traum als Mythos auf. Wenn die Masse droht aufzuwachen und den Traum als Alptraum identifiziert, schickt man sie in den Krieg. Auch das hat sich nicht geändert.
[1] Der Heizer ist eine abgekoppelte und veröffentlichte Kurzgeschichte
20. März 2024
Das Philosophenschiff
Von Michael Köhlmeier
Erschien 2024 im Hanser-Verlag
Der 1949 im Ländle (Vorarlberg) geborene Schriftsteller Michael Köhlmeier hat wieder – wie
jedes Jahr – einen Roman geschrieben. Diesmal kommt er auch selbst darin vor. Er interviewt in diesem Roman die inzwischen 100jährige Architektur-Professorin Anouk Perlemann-Jakob, die im Jahr 1922
auf einem so genannten „Philosophenschiff“ mit ihren Eltern unfreiwillig aus Russland emigrierte. Nun sind Anouk Perlemann-Jakob und ihre amerikanische Freundin Alice Winegard die einzigen fiktiven
Figuren in dem Roman. All die anderen - Russen - die darin vorkommen gab es. Ein Interview hat also nie stattgefunden, ist frei erfunden. Das Philosophenschiff mit den anderen Insassen gab es, bis
auf ein kleines Detail: Lenin war nie auf einem solchen Schiff, zumindest nicht nachweislich. Doch das ist das entscheidende Detail, das Frau Perlemann-Jakob den Geschichtsschreibern mitteilen kann.
Der immer noch nicht aufgeklärte Tod von Lenin – was nicht unwesentlich dazu beitrug, dass aus Lenin ein Kult wurde – wird von der Architektin aufgeklärt. Und an dem Spitzbart, der ihn gegen Ende des
Romans zur Rede stellt, lässt sich unschwer Trotzki erkennen. Leo Trotzki, der später dann den Säuberungen durch Stalin zu Opfer fiel. Anfang der 1980er Jahre war ich selbst einmal ganz kurz Mitglied
einer K-Gruppe, die sich selbst als „Trotzkisten“ wahrnahmen. Es waren für mich damals alte Männer (so um die 30). Ich kann die kleine Nebengeschichte mit Köhlmeiers Freund Carlo (die er im zwölften
Kapitel erzählt) gut nachvollziehen- im ironischen Sinn. Ich wurde damals von diesen Trotzkisten bewaffnet. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Waffe war. Aber ich ging damit in den Ebersberger
Forst und übte Schießen. Ich weiß nicht mehr, wie die Waffe verschwunden ist, wohin. So waren die 1980er. Dinge tauchten auf und verschwanden einfach wieder und wir Jungen waren alle meist viel zu
zugedröhnt, um diesen Dingen nachzuspüren. Köhlmeier und sein Freund Carlo gehören eher der Generation an, die für mich damals alte Männer waren.
Die Geschichte von Köhlmeier wechselt oft in den Zeiten und nicht immer ist man gleich orientiert: Die Zeit im Pariser Exil, die Zeit auf dem Schiff, die Zeit in Russland (vor Paris, nach Paris?),
die Zeit in den USA, als sie schon eine bekannte Architektin war, in Etticott, Maryland- . Dort übrigens gibt es keinen Perlemann-Platz oder ähnliches. Es gibt aber Etticott in Maryland.
Das ist eine besondere Frage an den Text. Denn Köhlmeier hat in jedem Fall recherchiert. So las er mit Sicherheit den Artikel „Kopfloses Rußland“ von Wiktor Jerofejew in der FAZ 2022 zum Anlass eines
Kongresses von Philosophen, der sich nach dem berühmten Philosophenschiff benannte. Köhlmeier erzählt historisch nichts Neues, nur eben weniger Geläufiges. Mit seiner hundertjährigen Architektin hat
er natürlich eine originelle Stimme gefunden, die dem realhistorischen Hintergrund eine gewisse literarische Apartheit gibt. Nun stellt man sich dennoch die Frage, warum er das so macht. Denn die
Stellen, wo er sich um die alte Frau sorgt, wo er für sie kocht, wo sie einschläft, die sind erstens banal und zweitens Teil einer Fiktion, die der eigentlichen Geschichte in nichts dienlich ist. Es
ist ein Fake. Ein Deep-Fake, weil die historischen Ereignisse ja stattfanden. In das Bild des Philosophenschiffs, hat Michael Köhlmeier eine hundertjährige Architektin einmontiert, wie jüngst die
Prinzessin von Wales eine bessere Variante von sich selbst in ein Familienfoto. Was eine Prinzessin nicht darf, ist in der Literatur jederzeit erlaubt. Erlaubt ist aber auch zu fragen, wozu!? Denn
die Geschichte über diese Säuberungsaktion der Bolschewisten, ist für sich schon ungeheuer. Ist es allein wegen des Bildes von Lenin? Köhlmeier stellt ihn als von mehreren Schlaganfällen gelähmten
und damit auch symbolisch Machtlosen Führer vor, der „seine Worte an der gelähmten Zunge vorbeirollen muss“, Ist es die Geschichte des Geheimdienstes über Tscheka, GPU? Beide Vorläufer des KGB
gab es natürlich, wobei Köhlmeier da noch die Geschichte der Ochrana einbauen hätte müssen, zumal diese Geheimorganisation noch im zaristischen Russland gegründet wurde. Das machte Joseph Roth einmal
viel besser mit seinem Roman „Beichte eines Mörders“. Hier wurde die Fiktion lebendig.
Meine Hauptkritik an dem Romanversuch von Köhlmeier ist daher auf zwei Füßen aufzustellen. Einmal die schon bemerkte Frage, warum denn das so fiktionalisieren? Und dann war mir das auch noch viel zu einseitig gegen den Kommunismus gerichtet. Der Roman gab mir also nichts zu denken, wie es die von den Mainstream-Medien und den großen Verlagen bezahlten Feuilletonisten überall schrieben. Immerhin weiß ich jetzt Bescheid darüber, dass es den Begriff Philosophenschiff wirklich gibt, dass alles so stattgefunden hat mehr oder weniger. Aber die Verwicklungen und Unklarheiten der revolutionären Zeiten in der entstehenden Sowjetrepublik wurden mir nicht erklärt, nur offenkundig. Mir ist nach wie vor die Motivation nicht klar. Denn die Ereignisse um die Ausbürgerung, Säuberung, finden auch durch die Erzählerin Anouk Perlemann-Jakob keinen zentralen, leitmotivisch erkennbaren Strang. Und irgendwie habe ich das Gefühl, werde das komische Gefühl nicht los, dass Köhlmeier das Thema irgendwie verschenkt hat, novellistisch runterhackte. Ein großer Erzähler könnte daraus einen 500 Seiten Roman machen, der uns diese Zeit nahe bringt, der lebendige Figuren schafft. All das aufwendige Personal, all die Russen in der Novelle, sind lediglich erwähnt. Namen. Ich konnte einen guten Teil recherchieren und war dahingehend fasziniert, welche größere Bedeutung sie in der Kulturgeschichte Europas zum Teil spielten. So beginnt Huxleys schöne neue Welt mit einem Zitat von Nikolai Berdjajew. In Köhlmeiers Novelle ist das nur ein Name. Tatsächlich war er ein wichtiger Religionsphilosoph, der unter anderem auch mit Paul Tillich zusammenarbeitete. Der oft erwähnte Nikolai Gumiljow war ein Lyriker und Übersetzer, dessen Werke erst unter Gorbatschow wieder erlaubt waren in Russland. Der von ihm mitbegründete Akmeismus (Akme = Spitze, Reife, Höhepunkt) verbindet Ästhetik mit Mystik. Das kann nur der Russe. Und hier, zwischen Ästhetik und Mystik, in dieser Verbindung treffen sich auf der Linie Kaliningrad der Deutsche und der Russe. All das fehlte mir. Es wurde viel zu viel liegen gelassen, nur erwähnt und gleich wieder rauchend wegradiert von dieser bourgeoisen Architektin, die ja nur von Köhlmeier erfunden ist. Erfunden ist auch der auf Seite 89 erwähnte acht Meter lange Tisch der Michaelsburg. Der von Köhlmeier erwähnte Zar Paul I. war der Sohn von Katharina der Großen. Er schränkte die Macht der Großgrundbesitzer über die Leibeigenen ein, amnestierte politische Gefangene und schuf die Wehrpflicht ab. Köhlmeier erfindet stattdessen einen Tisch, der als plumper Witz auf Putin anspielt. Da wäre Zar Nikolaus I. eher interessant gewesen, der immerhin die Geheimpolizei der Ochrana ins Leben rief, um gegen die „Dekabristen“ vorzugehen, also gegen Aufständische Offiziere, die am 14. Dezember gegen Leibeigenschaft, Polizeiwillkür und Zensur rebellierten.
Michael Köhlmeier ist ein großartiger Schriftsteller und vielleicht sollte man ihm, oder er sich einmal drei Jahre Zeit gönnen, für einen Roman. Es ist eine Zumutung für alle jedes Jahr einen Roman schreiben, veröffentlichen und lesen zu müssen von einem Autor. Als hätten wir nicht genug Autoren. Es ist eine Marktdiktatur, die langsam aber sicher die Nerven der Leser strapaziert und Leichte Kost ist nicht immer verträglicher in der Literatur. Hätte – so meine spitzzüngige Vermutung – Köhlmeier sich Zeit gelassen, wäre er irgendwann auf die Idee gekommen, einen richtigen Roman zu schreiben, der wirklich auf dem Schiff spielt oder wirklich von diesen Menschen handelt. Oder er hätte es bleiben lassen und daraus eine zehnseitige Kurzgeschichte gemacht. Denn was in dem Text wichtig ist und bemerkenswert, läßt sich in der Tat auf eine viel knappere Form reduzieren und dann wird es wieder zur Literatur, von der man Dichte oder Höhe, mitunter sogar Dichte und Höhe erwartet.
27. Februar 24
Kleine Probleme
Von Nele Pollatschek
Erschienen im Verlag Galiani 2024
Man braucht eigentlich nur einen Buchstaben zu streichen und die Sache ist erledigt.
Eine Liste mit 13 Punkten muss abgearbeitet werden. Und erst dann hat man sich verändert, wurde ein anderer und ist doch immer noch man selbst. So schraubt ein 49 jähriger Mann ein Bett zusammen für
seine Tochter, putzt endlich die Wohnung, macht seine Steuererklärung, packt notdürftig Geschenke ein (es ist bald Sylvester), ruft endlich seinen Vater an, macht einen Nudelsalat und statt Feuerwerk
eben Wunderkerzen, reinigt die Regenrinne, verfasst ein Lebenswerk, klärt das Verhältnis zu seiner Freundin, hört mit dem Rauchen auf und macht es gut. Weil er es einfach macht. Aber dazu muss man
natürlich erst anfangen. Dieser zentrale Unterschied zwischen dem eigentlichen Tun (Machen) und der Vorstellung des Tuns (machen wollen zu müssen) widmete sich die Autorin Nele Pollatschek. Zwischen
dem Faktor Arbeitseifer und dem Faktor Zeit schiebt man die Tätigkeit noch etwas heraus mit dem Argument, dass ja noch genug Zeit ist. Aber die Zeit ist ein gnadenloser Wirtschaftsfaktor. In einem
klassischen Unternehmensumfeld schätzt der Mitarbeiter typischerweise den Aufwand und damit die Dauer eines Arbeitspaketes inklusive eines Puffers zur Erhöhung der eigenen Zuverlässigkeit. Aufgrund
von Parkinsons Gesetz, das besagt, dass Puffer immer genutzt und nicht gekürzt werden, des Studentensyndroms, das besagt, dass so spät wie möglich begonnen wird, und kombiniert mit dem Gesetz von
Murphy, das besagt, dass immer etwas schiefgeht, werden Verfrühungen nicht und Verspätungen immer weitergegeben. Im Critical Chain Projektmanagement, dem CCPM, werden daher Schätzungen für die
einzelnen Arbeitspakete so gewählt, dass sie mit einer absoluten Wahrscheinlichkeit von ca. 50 % eintreffen. Die Differenz zu der klassischen Schätzung wird als gemeinschaftlicher Projektpuffer
für alle Arbeitspakete an das Projektende gestellt. Hierdurch können sich Verfrühungen und Verspätungen ausgleichen, was wiederum genutzt wird, um diesen Puffer um 50 % zu kürzen. Das Ergebnis
ist eine sehr hohe Termintreue verbunden mit einer Verkürzung der Durchlaufzeit um 25 %. Gut soweit. Die Frage ist nun, ob für Lars Schätzung für sein Lebenswerk das CCPM hilfreich wäre. Für die
Regenrinne und den Nudelsalat könnte das noch zutreffen. Aber wie Lars schon beschreibt, ist das Leben kein Projekt, sondern eine Frage der Haltung. Du musst dein Leben ändern, so lautete vor Jahren
ein Buchtitel von Peter Sloterdijk, Der Mensch bringt den Menschen hervor, aber nicht durch Arbeit an sich selbst, sondern durch Übung. Durch Wiederholung entsteht ein Gefühl von Sicherheit. So
führen uns Exerzitien ins gelobte Land. Übung macht eben den berühmten Meister. Die Natur verlor jedoch ihre ontologische Autorität durch das menschliche Begehr nach Vollkommenheit. Ein defizitäres
Menschenbild impliziert das jeweilige Streben des Menschen nach Vollkommenheit durch Einüben (Exerzitien). Ob das auf religiöser, sportlicher oder intellektueller Ebene geschieht, oder in
ökonomischer, militärischer oder zwischenmenschlicher Ebene. Das ist Nietzsches Genealogie der Moral, ein immer Höher, immer Weiter. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich die,
dass wir noch in den Höhlen säßen, wären alle so wie Lars und würden derart akrobatisch prokrastinieren. Die Kunst, dem Machen aus dem Weg zu gehen, die Kunst es sein zu lassen, bedarf mindestens
ebenso intensiver Übung, ja sogar eine heiligen Form der Übung, dass man durchaus von religiösen Exerzitien sprechen kann, die mit Faulheit und Lustlosigkeit nicht ausreichend erklärt wird. Ein
berühmter Vorläufer von Lars ist Oblomov. In der Umtriebigkeit und Vielbeschäftigtheit der Menschen um einen herum, fällt dem ruhenden Oblomov besonders auf, wie sinnlos und fragwürdig all die
Tätigkeiten sind. Am Ende verfolgen sie lediglich das Ziel des Überlebens. Mitten im Tun, im Machen fällt uns nicht mehr auf, dass wir Leben. Dazu benötigen wir stets die passive Rezeption. Dem, der
nichts tut, der ruht, dem fällt auf, fällt erst auf, was er getan hat, dass er gelebt hat. Also fragt man sich, ob die heute so in den kulturellen Hintergrund gedrängte Kontemplation durch die
hypertrophe Betriebsamkeit des Menschen, nicht doch einer Renaissance bedarf. Dabei aber riskiert das einzelne Subjekt Demütigung. Denn eine nicht geputzte Wohnung, ein klebriger Boden, muffelnde
Kleidung, all das ist nicht gesellschaftsfähig. Das für viele begehrte Bedürfnis nach Ruhe, nach Kontemplation, ist nicht gesellschaftsfähig. Man muss arbeiten gehen und seine Brötchen verdienen, man
muss die Wohnung putzen, die Wäsche waschen, die Familie bekochen, Geschenke einkaufen gehen, man muss auch noch ein Lebenswerk schaffen, weil man ohne ein Lebenswerk nichts zählt. Wird aber so das
ganze Leben nicht zu einer Einkaufsliste, To-do-Liste? Schule fertig machen, vernünftig werden, Berufsausbildung fertig machen, Karriere machen, Familie gründen, Kinder groß ziehen, Rente genießen,
Urlaub machen, alt werden, weise werden, krank werden, und nicht vergessen zu sterben. Arbeit wird zur Abarbeit. Ich muss noch was abarbeiten, ist aber nicht vergleichbar mit arbeiten. Machen ist
nicht gleich leben. Ein rechtes Maß zu finden, das mich als Subjekt so lässt wie ich bin und nicht zum gesellschaftlichen Maskenträger macht, der sozialen Normen nachjagt wie ein Schnäppchenjäger.
Bei allem vergessen wir nur uns selbst und fragen uns am Ende nicht einmal mehr, wer wir sind. Da wir metaphysisch Obdachlose sind, unser Emoji verloren haben, verfolgen wir kaum noch höhere Ziele.
Im Grunde geht es darum in dem Text von Nele Pollatschek. Denn Lars schafft all das, ändert sich, weil er ein höheres Ziel verfolgt und das ist die Rettung seiner großen Liebe. Dieses höhere Ziel ist
ein ganz altes, romantisches Ziel und das war auch gemeint in der Gegenbewegung zur Aufklärung. Alles was wir tun, tun wir allein um glücklich zu sein. So hat Aristoteles des Menschen Ziel verortet.
Sigmund Freud meinte dagegen, dass die Evolution für den Menschen kein Glück vorgesehen hat. Und gelernt haben wir, dass Glück stets mit Leid erkauft, erarbeitet wird. Mein Vater brachte es einst auf
den Punkt: „Manchmal haue ich mir mit dem Hammer auf den Zeh, weil es so schön ist, wenn der Schmerz nachlässt.“
Lars arbeitet seine Liste gegen sich selbst ab. Sein Ziel ist es nicht, dass die Wohnung geputzt ist, die Regenrinne gesäubert, der Nudelsalat gemacht, sein Ziel ist es, Johanna zurückzugewinnen, sie
von seiner Brauchbarkeit zu überzeugen, von seiner Fähigkeit sich ändern zu können. Du musst dein Leben ändern ist hier nicht bloßes Distinktionsgehabe. Es geht um sein menschliches Glück, das er wie
einst Oblomov verspielen würde, wenn er weiter in seinem Nomos bliebe. Lars muss raus aus seiner Wohlfühlzone. Wir alle müssen raus aus unserer Wohlfühlzone. Und darin sehe ich das große Problem
eines nietzscheanischen Über. Der Übermensch, der Superheld, der Supermarkt. Als sich Saulus zu Paulus wandelte, hat sich Saulus nicht verändert. Er stellte seine Fähigkeiten als Saulus nur einer
neuen Sache in den Dienst. Weil man sich gar nicht ändern kann. Man bleibt sich immer gleich. Und Lars hat sich auch nicht verändert. Er hat sich nur einer Sache verschrieben und sich überwunden. Das
ist nicht sich ändern, weil man sich bestenfalls zusammenreißen, disziplinieren kann und dadurch seine Trägheit überwindet. Dazu musst du ausreichend motiviert sein. Also kommt alles nur von außen.
Und die Intention scheint eine Lüge zu sein. Doch hätten wir nicht unseren Selbstzweck, unsere Intention, wir wären nur Roboter. Der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und KI ist nun mal die
Intention. Und Lars konnte die ungeputzte Wohnung als Problem erkennen, obwohl es für ihn kein Problem war. Das ist so verwirrend. Und sich einem Problem zu stellen, das man selbst gar nicht als ein
Problem wahrnimmt, das ist wirklich eine Form der Überwindung. Oder doch nur Programmierung?
09. Januar 2024
Mann vom Meer
Von Volker Weidermann
Erschienen 2023 im Verlag Kiepenheuer & Witsch
Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen; es schwoll empor, sich in sich selbst zu türmen, dann ließ es nach und schüttete die Wogen, des flachen Ufers Breite zu bestürmen.
Goethe ließ einst seinen berühmten Entrepreneur Faust auf einem Berggipfel sitzend, diese Sätze aussprechen. Die Szene spielt im vierten Akt des so umfassenden zweiten Teils der Tragödie. Doch Faust reagiert missmutig auf dieses Meeresschauspiel. Sie schleicht heran, an abertausend Enden, unfruchtbar selbst, Unfruchtbarkeit zu spenden; nun schwillt’s heran und wächst und rollt und überzieht der wüsten Strecke widerlich Gebiet, da herrscht Well‘ auf Welle kraftbegeistert, zieht sich zurück, und es ist nichts geleistet, was zur Verzweiflung mich beängstigen könnte! Zwecklose Kraft unbändiger Elemente!
Diese Kraft mit „überfliegendem Geist“ zu bändigen, wird Faust sich zur Aufgabe machen und am
Ende wird dieser Ort sein Grab. Kein halbes Jahrhundert nach Goethes Tod kommt 1875 in Lübeck ein weiterer deutscher Dichterfürst zur Welt. Thomas Mann war Zeit seines Lebens im Vergleichsmodus mit
dem Weimarer Adelsmann, der selbst aus bürgerlichen Verhältnissen heraus über diese hinaus wuchs und mit den Größten seiner Zeit verkehrte.
„Wir alle waren bestimmt, Weltkinder zu sein“, sagte einmal seine Tochter Monika Mann. Volker Weidermann machte eine Tauchfahrt in die Welt des Meeres und erzählt uns dabei auch die
Lebensgeschichte des „überfliegenden Geistes“ von Thomas Mann. Begleitet wird er von Thomas Manns jüngster Tochter Elisabeth, die wir alle in Breloers großartigem Filmroman „Die Manns“ als
kommentierende Begleiterin kennen lernten. Das Meer als Symbol von Tod und Leben zugleich. Am Ende des Tauchgangs in die Meerwelt des „Da wo ich bin ist Deutschland Schriftstellers“ rieselt
mariner Schnee herab und vereinigt das Schnee-Kapitel im Zauberberg mit dem Topos Meer.
Sand, Schnee und Meer werden zur Einheit.
Die Danakil-Wüste ist eine riesige Salzwüste an der Küste des roten Meeres. Der dort vom Wind aufgewirbelte Salzstaub geht auf die Reise bis zum Amazonasbecken, fällt dort herab und düngt den Boden
derart mit Mineralstoffen, dass es nur so blüht. Die vielen Pflanzen im Amazonas verwandeln Kohlendioxid in Sauerstoffmengen, die ausreichen würden, die gesamte Menschheit 20 x mit genügend
Sauerstoff zu versorgen. Aber der Sauerstoff verlässt den Amazonas nie. Die vielen Tiere dort verbrauchen ihn selbst. Es ist das Wasser im Boden, das in den großen Bäumen nach oben steigt, oben dann
zu einem gewaltigen Fluss aus Wolken wird. Diese Wolken ziehen bis zu den Anden, krachen dort gegen die Gebirgswände, der Regen der so entsteht wäscht Mineralien aus dem Gestein, das ganze fließt ins
Meer, dort warten Kieselalgen, die dank der Mineralien sich fortpflanzen können. Diese Kieselalgen sind der größte Sauerstofflieferant. Sie betreiben Photosynthese. Wenn die Kieselalgen sterben,
sinken sie als mariner Schnee auf den Meeresboden. Sie schmelzen aber nicht, sondern sammeln sich in Jahrmillionen an, heben den Boden. Der Meeresspiegel sinkt und es entsteht eine Salzwüste, wie die
Danakil-Wüste, dessen Salzstaub wieder zum Amazonbecken fliegt und so schließt sich der Kreislauf. Denn das Wasser, das unserem Leibe dient und schmeichlt, und dem wir uns sorglos anvertrauen, es ist
unser Element. Wir alle kommen aus diesem Wasser, bestehen zu großen Teilen daraus, so könnte man sagen, das Meer fließt in uns und wenn wir austrocknen werden wir zur Wüste und düngen das nächste
Meer.
Mit Volker Weidermann reisen wir nun von Brasilien nach Lübeck und über München in an die
Riviera und von dort nach Kalifornien. In vielen Variationen erläutert uns der Autor, den wir vor allem als Literaturkritiker des literarischen Quartetts kennen (von 2015-19 moderierte er die
beliebte Literatursendung), den Meeresblick von Thomas Mann. Die Meeresstationen verwebt Weidermann geschickt mit Zitaten aus den Romanen von Thomas Mann, aber auch aus den Tagebüchern. Dabei steht
das Verhältnis zu seiner jüngsten Tochter Elisabeth im Fokus der Betrachtung. Zu keinem seiner sechs Kinder hatte Thomas Mann ein so inniges Verhältnis, wie zu seinem Jüngsten. Das Meer kam von der
Villa Boa Vista nach Lübeck und verdunkelte sich an der Ostsee. Erst in den USA wurde es für Thomas Mann wieder richtig hell.
Der Horizont, und dahinter wieder der Horizont. Bis zuletzt Land in Sicht ist, und dann ist der Horizont verschwunden. Du kannst ihn dann aber wieder sehen, wenn du dich herumdrehst.
Salzgeschmack, Tang, Muscheln, milde Winde, Welle auf Welle, sanft brausendes Getöse, eine Strömung führt uns zum Meer.
Volker Weidermann gab uns eine plausible Darstellung der stillen Hauptfigur im Werk von Thomas Mann. Derzeit moderiert der gebürtige Darmstädter Weidermann zusammen mit dem ehemaligen Tennisprofi und der studierten Politikwissenschaftlerin Andrea Petkovic für Zeit online den Seitenwechsel, ein Live-Talk über Literaturen.
Thomas Mann wird im nächsten Jahr 150 Jahre alt und man kann davon ausgehen, dass sich die Kulturindustrie schon etwas einschießt auf dieses Jubiläum. Weidermann machte den Anfang und zeigte uns in diesem literarischen und thematischen Portrait, dass noch immer nicht alles über Thomas Mann gesagt und geschrieben wurde. Vor allem wäre hier sein monumentales Spätwerk Joseph und seine Brüder zu nennen. Immer noch mein Lieblingswerk von Thomas Mann. Es schildert den Fall und Aufstieg des biblischen Joseph zum ägyptischen Pharao und gilt als endgültiges Bekenntnis Thomas Manns zur republikanischen Verfassung. Die Republik, die öffentliche Sache, das klingt auch nach der Offenheit des Meeres, seiner Weite und Endlosigkeit. Die Staatsform der Demokratie als Grundlage einer am Gemeinwohl orientierten republikanischen Verfassung ist offen, offen und weit. Ja, man könnte das Bild erweitern. Denn auch in der Demokratie sieht man den Horizont und dahinter den Horizont. Und wenn man sich umdreht wieder. Brisen und Stürme, Welle auf Welle, Strömungen, aber eben offen und frei wie das Meer. Wenn Thomas Mann 150 Jahre alt wird, werden wir das brauchen, mehr Meer.
Von Teufeln und Heiligen
Von Jean-Baptiste Andrea
Aus dem Französischen von Thomas Brovot
Erschienen im Jahr 2022 im Verlag btb
Vor 90 Jahren (1932) entdeckte ein französisch-amerikanisches Grabungsteam die Hauskirche von Dura Europos. Es ist die derzeit älteste, archäologisch nachgewiesene Kirche und entstand in der Zeit nach dem Tod Alexander des Großen, im Jahr 233 nach Christus. Ihre Lehmziegelreste ruhen in der römischen Provinz Koile Syrien, am Euphrat gelegen. Man fand dort viele Malereien, die heute in der Kunstgalerie der Yale-Universität hängen. Eines davon zeigt den Guten Hirten. Pastor Bonus ist eine der ältesten Bezeichnungen für Jesus Christus. Seine alttestamentarischen Vorbilder Abel, Abraham, Isaak und Jakob waren noch verantwortungsbewusste Führer ihres Volkes. Dann kam David, der erste Messias. Über ihn heißt es im Tanach, im Zwölfprophetenbuch: „Schlag den Hirten, dann werden sich die Schafe zerstreuen.“ Die Bedeutung dieses biblischen Satzes über den Mühlstein des Messias, wird uns klar in der Szene, als Joseph, der Ich-Erzähler des Romans seine wahre Sünde erkennt und Senac um Vergebung bittet. Vergebung wofür? Dass ich Sie gezwungen haben, mich zu bestrafen. Denn Sie sind ein guter Mensch. Meine Strafe ist auch Ihre Strafe, vor allem Ihre. Sie leiden noch mehr als ich, und das ist meine größte Sünde. (Seite 272)
Berühmt ist der Hirtenpsalm 23: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen…ob ich
schon wanderte im finsteren Tal...
Dieses finstere Tal liegt in dem Roman von Andrea in den Pyrenäen, nahe der spanischen Grenze und wird von der berühmten Mondscheinsonate von Beethoven begleitet, in cis-Moll, die der
Komponist seiner jungen Klavierschülerin der Gräfin Julie (Giulietta) Guicciardi gewidmet haben soll. Im vorliegenden Roman heißt die kleine Julie Rose und ist gar keine Gräfin. Es ist die grausamste
Tat des Pfarrer Senac, dass er der armen, lungenkranken Rose erzählte, dass Joseph sie verraten habe.
Joseph verliert seine Eltern bei einem Flugzeugabsturz und kommt in ein abgelegenes Waisenhaus. Für ein langes Jahr erlebt er dort die Hölle und findet zugleich Lebensfreunde. Andrea erzählt uns die
fürsorgliche Brutalität der Aufseher, denen die Kinder in diesem Waisenhaus gnadenlos ausgeliefert sind. Das ist fürwahr keine neue Geschichte. Senac ist ein Gegenentwurf zu Dr. Larch, dem wahrhaft
guten Hirten aus dem Roman Von Gottes Werk & Teufels Beitrag, den John Irving 1985 geschrieben hatte, die Geschichte des Waisenjungen Homer Wells, den es in das St. Cloud in Maine
verschlägt. Der äthersüchtige Wilbur Larch ist kein biblisches Vorbild. Doch die Titelwahl von Andrea verweist uns nicht ganz zufällig auf Irvings sechsten Roman, der 1999 verfilmt wurde. Gerade die
Schneemetaphorik durchzieht auch Irvings Roman. Die Kälte in einer Kinderwelt ohne Heimat. Diese Welt da draußen ist hart und hat ihre Regeln, das ist auch ein Thema in Irvings Roman.
Doch die Welt im Confinium, der Grenze zwischen Morgen- und Abendrot, des confinia mortis, ist ungleich brutaler, kälter und verstörender. Es ist dort still, es wird nur geflüstert und die Schreie
sind so leise, dass niemand sie hört.
Andrea erzählt uns zusätzlich von Freundschaft. Die Wacht ist das Zentrum der Waisenkinder und
ein selbst gebauter Radio der nur einen Sender empfängt wird
zum magischen Objekt.
Die Geschichte ist spannend erzählt und gruselig zugleich, aber auch – um eine abgedroschene Synästhesie zu gebrauchen – bittersüß. Durch den dramaturgischen Aufbau einer Novelle wird die alte
Geschichte vom Waisenkind in einen musikalischen Bezug gebracht, sozusagen als Lebensmelodie verarbeitet.
Von Jane Eyre bis zu den Orphan Black zieht sich die Waisenkind-Thematik. Sogar der berühmte James Bond wuchs als Waisenkind in einem Internat auf. Oliver Twist, Tom Sawyer, Pipi Langstrumpf, Jim
Knopf, Rob Cole (Figur des Medicus) ja selbst Bambi waren alles Waisen. Die Liste ist gar nicht so kurz. Und für die Waisenkinder war immer die öffentliche Hand verantwortlich. Sie waren Mündel
fremder Herren. Die Kirche hat sich immer rührend ihrer angenommen. Und so ist es eine besondere Wendung, als herauskommt, dass auch Pfarrer Senac einst ein Waisenkind war. Der Vater von allen, der
gute Hirte ist der abwesende Vater. Die Macht ihrer Stellvertreter auf Erden geht so tief, weil sie auch spirituell nachwirkt. Es ist viel schwerer, sich von etwas zu befreien, das so abstrakt ist,
wie das spirituelle Erziehungskonzept der Kirche. Es ist nicht nur schlecht, sonst hätte sich diese Institution nicht so lange halten können. Sie brachten die größten Geister hervor, aber auch die
größten Sünder. Die Humanisten suchten dann nach einer unabhängigen, persönlichen Auslegung des Evangeliums und einer Bewahrung des Glaubens durch ein frommes, tugendhaftes Leben. Sie landeten
vielfach auf dem Scheiterhaufen. Dass Joseph nicht zerbrach, lag an der Musik, an seinem – keineswegs zärtlichen – Urmentor Rothenberg und es lag an der Mondlandung bzw. am Orbit des Mondes, an
Michael Collins. Die dunkle Seite des Mondes in diesem kirchlichen Waisenhaus, die Stille, die Gespenster, den Mond zu umkreisen, ihn nicht zu betreten, als das größere Abenteuer, diese Metapher hat
mir sehr gut gefallen. Diese dann mit Beethovens Mondsonate zu verschränken und zum Leitmotiv zu machen, ist gekonnt.
Insgesamt ist der Roman von Andrea rund und man merkt dem Text an, dass sein Autor ein geübter Drehbuchautor ist. Schon in seinem Debütroman Ma reine erzählt Andrea die Geschichte von einem zwölfjährigen Jungen. Hier lebt er mit seinen Eltern auf einer provenzalischen Tankstelle begibt sich auf die gefährliche Suche nach seiner Freundin. Diese Suchen nach Freundschaft und Liebe ist dann der Topos auch in dem vorliegenden Roman. Man kann gespannt sein, denn der Roman würde sich dazu eignen, verfilmt zu werden. So wie viele Waisenkind-Geschichten verfilmt wurden.
Das Thema Kirche und das Thema Waise. Andrea hat beide bedient und zusammengebracht. Und ob
man den Kammerton A mit 440 Hz immer genau so spielen kann, ist ebenfalls eine schöne Metapher.
Tatsächlich gibt es in der hebräischen Philosophie zwei Begriffe, die jene von Rothenberg gemeinte in den Ton gelegte Emotion definieren. Metziut ist Ihre identifizierbare Präsentation als etwas ganz
Eigenes. Wie das Wort „ist“ in „Das ist ein Pferd“. Oder einfach nur „Das Pferd ist es.“
Mahut ist das grundlegende Konzept dessen, was Sie sind, manchmal auch „Essenz“ genannt. Das „das“ von „Dieses Pferd ist“. Selbst wenn dieses Pferd nie existierte, selbst wenn es sich als etwas anderes als ein Pferd präsentierte, ist sein Mahut immer noch vorhanden. Das ist sehr platonisch. In diesem Sinne ist das Metziut das Momentum, die unmittelbare Existenz, also – wie die Kabbalisten es korrekt bezeichnen – die wahre Wirklichkeit. Doch da Musik nicht aus einem Ton besteht, sondern aus einer Schichtung von Tönen, die durch Rhythmus, Stil und musikalischer Syntax gebaut ist und nur als Ganzes wahrgenommen werden kann, ist der einzelne Ton in dieser Verbindung durch eine Brücke mit den anderen verbunden, die von den Kabbalisten als billul bezeichnet wird, als ein Nichts, das aber nicht nur Nichts ist, sondern – naja – was auch immer zwischen etwas und nichts ist. Dass Joseph an dem alten Klavier einmalig diesen Ton trifft und so die Grundtonart seines ganzen Lebens, das ist irgendwie auch beängstigend.
Rufen Sie einfach an unter
Arwed Vogel
++49 ( )8762 726121
oder
Bernhard Horwatitsch
017646130019
horwatitsch[at]gmx.at
...
oder
nutzen Sie unser