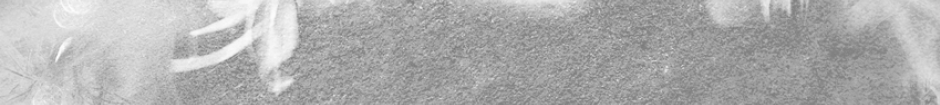
Neue Streifschüsse
Wann immer nötig. Alle ein bis zwei Wochen ein Schuss
Streifschuss
vom 04. April 24
Anlass: Ehe zwischen Mythos und Aufklärung am Beispiel Christoph Martin Wieland
Studie über Alkestis
Die Ehe gilt als Basislager der Bourgeoisie und so verwundert es nicht, dass der aus einer
Wirtshausfamilie (schon sein Urgroßvater war Wirt von „Zum golden Bären) stammende Biberacher Christoph Martin Wieland fast 40 Jahre verheiratet war und mit seiner Frau Anna Dorothea, eine
geborene Hillenbrand, 14 Töchter hatte. Ein von ihm gedichtetes Singspiel, ein Libretto für eine Oper von Anton Schweitzer, brachte ihm dann aber den Spott eines Mannes ein, der von der Ehe keine
Ahnung hatte. Wieland war schon acht Jahre verheiratet und hatte schon vier Töchter, Sophie-Katharina (*1768), Maria Caroline Friederike (*1770) Regina Dorothea (*1771), und Amalia Augusta
(*1773). Kein Wunder also, dass Wieland auch einmal den Alkeste-Mythos aufgriff, der den Opfertod einer liebenden Ehefrau ins Zentrum des Geschehens stellt. Denn der Mythos beschreibt den König
Admetos von Pherai, der es schafft einen Eber und einen Löwen vor den Hochzeitswagen zu spannen und daher die schönste der Töchter des Königs von Iolkos als Lohn für diese Leistung bekam. Eber und
Löwe stehen allegorisch für die Manneskraft und die Stärke des Männlichen. In der Regel gehen in der Ehe diese Kräfte ein wenig verloren. Nicht so bei Admetos, der sogar dauerhaft leben darf, weil er
einen Stellvertreter findet, der für ihn stirbt. Doch leider ist es seine Frau Alkestis, die sich für ihren Ehemann opfert. Das war zwar so nicht von vorneherein abgemacht, aber die Götter sind fiese
Biester und selbst schuld, wer mit ihnen Verträge eingeht. Doch ein Halbgott – Typen, die sich nicht um Verträge scheren – rettet Alkestis. Es ist Herakles, der mit dem Tod, mit Thannatos ringt, und
ihn auch in die Flucht schlägt. Alkestis darf also weiter leben, an der Seite ihres Mannes. Der Schelm und Tragödiendichter Euripides nahm diesen Stoff auf und darin streitet sich der König Admetos
mit seinem Vater Pheres. Er wirft ihm vor, nicht an Stelle von Alkestis gestorben zu sein. Pheres wirft seinem Sohn vor, er sei der Mörder seiner Frau. Herakles erfährt vom Tod der Alkestis, geht in
die Unterwelt, den Hades, und holt Alkestis da wieder raus. Doch Admetos erkennt die verschleierte Ehefrau nicht, misstraut dem Mitbringsel von Herakles zunächst. Herakles zieht nun den Schleier von
Alkestis, damit Admetos sie erkennen kann.
Christoph Martin Wieland holt in seiner Interpretation des Mythos noch eine Parthenis ins Boot. Sie ist die Schwester von Alkestis. Im fünften Akt, als Herakles mit der verschleierten Frau ankommt,
ist es gerade Parthenis die dem Halbgott Vorwürfe macht, er würde hier irgendwas ins Haus schleppen, aber bestimmt nicht ihre Schwester Alkestis. Doch dann erkennt sie, dass Herakles sein Wort
gehalten hat und holt den trauernden Admetos dazu. Friede, Freude, Eierkuchen.
Goethe las dieses Singspiel und betrank sich daraufhin. Im Suff schrieb er dann (so hat er es selbst gegenüber Johanna Fahlmer geäußert) sein Spottgedicht Götter, Helden und Wieland.
Hier kann man mitlesen: Götter, Helden und Wieland. In dem Spott wirft Goethe seinem, 16 Jahre älteren Kollegen vor, er würde aus dem griechischen Helden
Herakles einen gefühlsduseligen Schwippschwager machen und er schildert Wieland der in Schlafanzug und Schlafmütze in den Hades gebracht und dort vor Gericht gestellt wird, für sein mäßiges
Alkestis-Singspiel. Wielands Herakles-Darstellung ist nicht vereinbar mit Goethes damaliger Auffassung von griechischem Heldenmut. Tatsächlich standen Wieland und Lessing Pate für die Empfindsamkeit.
Seltsam nur, dass der Autor des Werther (der Heulsuse der Literatur schlechthin) sich hier über die Empfindsamkeit eines Halbgottes lustig machte.
Wieland wiederum reagierte auf das böse Gedicht von Goethe weltmännisch und schrieb eine sehr
positive Rezension über Goethes Götz von Berlichingen. Mit folgenden Worten: Ein Autor ist darum nicht gerade ein Duns, weil er unbillig oder unartig gegen uns ist; und warum sollte ein Böser
Mensch (gesetzt auch, daß einer, der uns nicht liebt, darum gleich ein böser Mensch seyn müßte) nicht eben sowohl ein gutes Werk schreiben können.
So nahm er dem jungen Goethe den Wind aus den Segeln. Und Goethe bliebt nichts anderes übrig, als entschuldigend zu behaupten, er habe sein Spottgedicht über Wieland im Suff geschrieben und es
sei ganz aus Versehen dann auch noch veröffentlicht worden.
Goethe: Mea maxima culpa.
Und Wieland: Praecipitandus est liber spiritus.
Und Goethe ad spectatores: Dieser Sack, nicht mal böse kann man mit ihm sein.
Zurück zum eigentlich Thema. Wieland war fast 40 Jahre verheiratet, von 1765 bis 1801, dem
Tode seiner Frau, die er selbst 12 lange Jahre überlebte. 14 Töchter aus dieser Ehe, ein Sohn hat nie überlebt. Wieland war der Familienmensch schlechthin unter den Weimarer Viersternedichtern. Er
war der Bourgeoise schlechtin. Ein Admetos der beginnenden Aufklärung, ein sentimentaler Held am Endpunkt des Rokoko. Eber und Löwe waren in Wielands Fall Feder und Tinte.
Kurz: Die Ehe ist unter dem bürgerlichen Zeltlager immer ein Frauenopfer. Es bedarf eines Herakles, die Frau zu retten. Später hat Goethe den Opfertod der Frau ja auch immer wieder kritisiert, in
seinem Helena-Akt im Faust oder in seiner Iphigenie auf Tauris. Goethe war noch mehr ein barocker Mensch, als Wieland. Die Empfindsamkeit der Bourgeoisie erfand die weiblichen Tugenden und die
Aufklärung – und dies hier gilt als weiterer Beleg dafür – hat das Frauenopfer institutionalisiert.
Streifschuss vom 02. April 24
Anlass: Woher kommt unsere Kunst und warum eigentlich?
Natur und Verstand – eine unglückliche Mesalliance
Sieht man sich die Kunstgeschichte an, die ganze Kunstgeschichte – Gott bewahre
ich hätte sie im Ganzen je gesehen - lässt sie sich in einem einfachen Antagonismus darstellen. Auf der einen Seite haben wir die Natur. Auf der anderen Seite die Ratio, also unseren diese
Natur begreifenden Verstand. Und hier gibt es schon große Missverständnisse.
Naturalismus – Rationalismus sind die Begriffe dieses Antagonismus und sie bedeuten oft nicht das, was man glaubt, was sie bedeuten. Die Zeichnungen von Kindern und von
Primitiven sind „rationalistisch“. Das ist die erste Überraschung. Sie sind nicht sensorisch, sie zeigen, was das Kind und der Primitive wissen, nicht, was sie tatsächlich sehen, sie geben ein
theoretisch-synthetisches, nicht ein optisch-organisches Bild vom Gegenstand. Die Darstellung primitiver Kulturen, also die Darstellung der Hirtengesellschaften, der Ackerbau treibenden und
Metall verarbeitenden Gesellschaften nach der neolithischen Revolution weist große Ähnlichkeiten auf mit der Darstellung der Wirklichkeit von kleinen Kindern bis etwa zum dritten, vierten Lebensjahr.
So sieht man eine vereinfachte und stilisierte Darstellung bei Kindern ebenso wie bei den frühen neolithischen Kulturen. Die Komplexität der Formen wird reduziert, um die Essenz des dargestellten
Objekts oder der Szene einzufangen. Das ist rationalistisch gedacht, da hier nicht die Wirklichkeit abgebildet wird, sondern ein Stil, eine Gedanke. Frühe Kulturen und Kinder verwenden symbolische
oder ikonische Elemente, um bestimmte Konzepte oder Ideen darzustellen. Beiden (Kindern und Primitiven) fehlt die Perspektive, Objekte werden oft flach und ohne räumliche Tiefe dargestellt.
Auch hier fehlt also Wirklichkeit. Es kommt in beiden Fällen zu einer Betonung der Linie: auffällige, deutliche Linien, um Formen zu umreißen und Details hervorzuheben. Die Linie wird oft als
primäres gestalterisches Element verwendet. Ebenso gibt es den expressiven Ausdruck: Ausdruck von Emotionen und unmittelbare Verbindung zum Erleben und Empfinden. Nicht was ist, sondern was
erlebt, empfunden, für das Subjekt bedeutend ist, wird dargestellt.
Also es wird zum Beispiel –das Profil nicht frontal, sondern von der Seite dargestellt, das biologisch oder motivisch Wichtige wird vergrößert und vernachlässigen alles, was für den gegenständlichen Zusammenhang keine direkte Rolle spielt.
In der älteren Steinzeit hingegen, im Paläolithikum, das etwa vor 2,5 Millionen Jahren bis etwa 10.000 vor Christus geht, begegnen wir regelrechten Bewegungsstudien, die uns beinahe schon an photographische Momentaufnahmen erinnern. Der Paläolithiker malt noch, was er unmittelbar sieht. Das wäre im Gegensatz zur rationalen und begrifflich orientierten Faktur ab der Jungsteinzeit als Naturalismus zu bezeichnen. Also der Anspruch der Dichter im 19. Jahrhundert, die Dinge, gesellschaftlichen Verhältnisse, etc. so darzustellen, wie sie sind und nicht, wie man sie gerne hätte, oder wie sie wahrgenommen werden in der ganzen Verfälschtheit subjektiver Wertung, sondern so, wie sie sind, dieser - heute als naiv zu bezeichnende – Ansatz lässt sich also in den vorgesellschaftlichen Menschen erkennen.
Der Paläolithiker kennt diese kindlich rationale Darstellung eines Seitenprofils, ein Gesicht aus der Silhouette im Profil und den Augen en face zusammengesetzt, noch nicht. Das ist sicher ein wesentlicher Unterschied zu den Darstellungen des 19. Jahrhunderts. Emile Zola oder Gerhard Hauptmann kannten die andere Seite des rationalen, bewertenden, deutenden Spektrums der Literatur sehr wohl.
In dieser Altsteinzeit gab es den Dualismus des Sichtbaren und des Unsichtbaren, des Gesehenen und des Gewußten nicht, das ist den Menschen dieser Zeit fremd. Hier im Urgrund es Mythos wird noch nicht gedeutet.-
Die Menschen waren Jäger und Sammler. Jäger und Sammler dieser Zeit waren unproduktiv, auf einer parasitären Wirtschaftsstufe, erbeuteten oder sammelten ihre Lebensmittel, erzeugten sie aber nicht. Vermutlich glaubten sie nicht an Götter, oder an ein Jenseits oder einem Dasein nach dem Tode (das ist in jüngster Zeit zwar umstritten, aber sicher war das Jenseits des vorgesellschaftlichen Menschen ohne feste Form).
Was bezweckten diese Darstellungen (Altamira, Lascaux)? Dachte der Maler, in dem Bild
das Ding selbst zu besitzen, mit der Abbildung Gewalt über das Abgebildete zu gewinnen? Glaubte er, dass das wirkliche Tier die am abgebildeten Tier vollzogene Tötung selber erleidet?
Tatsächlich dürfte es sich nicht um symbolische Ersatzfunktionen gehandelt haben, sondern um richtige Zweckhandlungen, um wirkliches Tun, wirkliches Verursachen. Und diese atavistische
Motivation steckt bis heute in jedem Kunstwerk.
Die Welt der Fiktionen und Bilder, die Sphäre der Kunst und der bloßen Nachahmung (Mimesis) wurde bei den vorgesellschaftlichen Menschen noch nicht unterschieden von der Erfahrungswirklichkeit.
Es waren keine verschiedenen, keine voneinander geschiedene Bezirke.
Diese Sphäre der Unentschiedenheit verschwand dabei nie ganz. Sie kommt noch – unter anderem - in der Legende des Pygmalion vor, in der sich der König von Zypern in eine elfenbeinerne Statue der
Aphrodite verliebt. Es ist die gleiche Statue, die er selbst geschaffen hat, und sie stammt aus dieser vorgeschichtlichen Gedankenwelt. Die ausführlichste Schilderung des Pygmalion findet sich bei
Ovid (augusteisches ZA) in den Metamorphosen 10,243–297. Die früheste stammt von Phylostephanos aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert. Erstmals wurde sie von dem aus dem heutigen Lybien
stammenden griechischen Dichter Philostephanos als Sage übermittelt. Die Geschichte selbst ist sicher schon um vieles älter. Aber das sei außen vor. Entscheidend ist der Inhalt, dass es einen
verschmelzenden Übergang gibt von Kunst und Wirklichkeit, von der Natur zur Ratio. Es gibt die Utopie des unverstellten Blicks auf die Welt. Sie ahnt uns aus unserer Vorgeschichte an. In wie weit wir
heute fähig sind, die Natur ohne deutende und verzerrende Bias wahrzunehmen, das steht auf einem unbeschriebenen Blatt. Aber genau hier liegt die epistemische Grenze allen Seins. Und was würde unser
Leben bedeuten, wenn es nur eine Fiktion ist? Und was ist da die Wahrheit, die Wirklichkeit?
Streifschuss vom 30. März 24
Anlass: etwas Antichrist am Ostersamstag
(Das Bild zeigt Nietzsche im Alter von 17 Jahren)
Begriffsweihrauch
Der Dionysiker Nietzsche nannte die Philosophen einmal „Herren-Begriffs-Götzendiener“ und erwies sich darin als der heiße Denker und Sprachkritiker der Moderne und als Vorläufer von Foucaults Machtkritik und Derridas Kritik am Logozentrismus. Nietzsche kritisierte die Philosophen als unsinnliche, die Wirklichkeit aus den Begriffen saugende Monster (Totengräber-Mimik). Er verwarf darin die Vernunft als Begriffszement, der „Glaube an die Lüge“ darstellt und das war für ihn vor allem die Moral.
Heute wissen wir, glauben zu wissen, dass wir uns an Begriffe leichter gewöhnen, wenn wir sie vergegenständlichen, sie erfahrbar machen. Begriffe, die wir nicht erfahren können, die nur Gedachtes, aber nicht Vorstellbares transportieren (Vernunft, wäre so ein Begriff) benötigen die Institutionalisierung durch die Verschriftlichung. Die Verschriftlichung führte zu einer Stabilisierung des Noumenon von Begriffen. Allein, weil sie verschriftlicht wurden, waren sie mehr erdacht als erfahren. Das Universale verewigt sich und wird genau zu dem, was Nietzsche kritisierte, einer Begriffs-Mumie, die irgendwann ihren Eigensinn verliert. So geht es Worten wie Gott, Vernunft, Geist.
Es war der britische Philologe Eric Havelocks(1903 bis 1988) der die epochemachende These aufstellte, dass die Ablösung noumenaler Gehalte von ihrer Präsenz im menschlichen Bewusstsein, ihre Hypostasierung zu unabhängigen geistigen Wesenheiten eine Folge von habitualisiertem Schriftgebrauch ist (zitiert nach Albrecht Koschorke, aus Wahrheit und Erfindung).
Nietzsches Sprachkritik gegen die Begriffsmumifizierer ist also eine Kritik aus den heißen Zonen der Kultur und richtet sich gegen die kalten Machtzentren der Begriffspriester. Worin Nietzsche mehrfach im Recht ist, denn tatsächlich sind Begriffe mit möglichst wenig Inhalt und viel Varianz am stabilsten. Das heißt Begriffe, die eigentlich schon tot sind, leben am längsten. Schlüsselwörter wie Geschichte, Kultur, Gesellschaft, Entwicklung stammen alle aus dem 18. Jahrhundert. Sie haben schon jetzt kaum noch einen speziellen, konzeptuellen Inhalt. Ihre Varianz übersteigt bei weitem ihre Spezialität. Auch neuere Begriffe wandern leichter, können in andere Wissensgebiete migrieren, wenn sie ähnlich unterbestimmt sind wie dieses kalt gewordene im künstlichen Koma lebendig gehaltene Begriffsfleisch.
Es bedarf der Einrichtung von Sperrgebieten, die aus starren und fluiden Begriffen bestehen. Priester erbauen Stätte semiotischer Produktion in die man nur hinein kommt, wenn man hohe Widerstände überwindet: Die Wissenschaft, das Recht, die Medizin.
Es gibt dagegen die loci communes, die wir heute als Medien bezeichnen würden, und dort findet
ein friedensstiftender Austausch statt, mit dem Preis, dass die Überwölbung der Differenz zur semantischen Entleerung führt. So entstehen die leeren Signifikanten, die Ernesto Laclau (argentinischer
Poststrukturalist, 1935-2014) einführte. Das Wort „Freiheit“ ist so ein leerer Signifikant auf der allgemeinen Sprachbühne der Politik. Und genau diese loci communes, diese Orte der gemeinsamen
Sprache nutzte Nietzsche, um sie zugleich zu kritisieren.
So wie heute eine Spezies existiert, die sich der Medien bedient, um über die Medien zu schimpfen. Es ist eine destruktive Energie, die zugleich wiederum konstruktive Rückkoppelung ermöglicht. Das
ist diese Umwertung aller Werte. Bevor man an die Stelle der verkommenen, längst modrig-miefenden, septisch sich zersetzenden Werte der Moral neue Werte setzt, muss man die alten Werte
nachhaltig und rigoros zerschlagen und auflösen. Das gebietet die kognitive Hygiene. Da wären wir bei den Christen und ihren Affenglauben an die Auferstehung. Allein diese Gedankengänge Nietzsches
sind sogar für den Revolutionär reizvoll.
Es ist das Zeichen der Zeit, der Nietzsche folgte. Im wilhelminischen Kaiserreich sah Nietzsche bereits all die Verfallserscheinungen einer demokratischen Verfasstheit, deren Liberalismus den Begriff
"Liberty" entwertete. Die allgemein herrschende Vorstellung der Moderne wurde es dann schließlich, dass sich dringend etwas ändern muss. So haben viele den ersten Weltkrieg als reinigendes Gewitter
herbeigesehnt, als einen Umwerter aller Werte. Auch heute haben wir so eine Schwellen-Epoche in der viele Menschen so denken. ES MUSS SICH WAS ÄNDERN – SO KANN ES NICHT MEHR
WEITERGEHEN!
Doch diese leeren Signifikanten unserer herkömmlichen Moral haben den großen Vorteil, dass sie für alle offen und gebrauchbar sind. Das ist ihr eigentlicher Wert. Begriffe die jedermann benutzen kann, jede Partei, jede Organisation. Begriffe, die jeder Formalisierung standhalten. Sie sind auf keiner Festplatte mehr zu löschen, sind längst ein Teil der Festplatte geworden. So sind die höchsten Werte der Moral meist ganz inhaltsleer und können doch stark mobilisieren, weil sie eben ein gemeinsamer Nenner sind. Freiheit? Da können wir uns alle darauf einigen. Und gerade dieser Wert muss zerschlagen werden. Die Festplatte selbst taugt nichts mehr, wenn Begriffe nicht mehr gelöscht werden können, jeder Formalisierung standhalten, weil sie wie ein Dämon jeden Inhalt annehmen, den man ihnen anbietet. Was taugt eine Moral noch, wenn sie so beliebig geworden ist?
Mit Nietzsche gesprochen: „Was wir aus ihrem Zeugnis machen, das legt erst die Lüge hinein, zum Beispiel die Lüge der Einheit, die Lüge der Dinglichkeit, der Substanz, der Dauer… Aber damit wird Heraklit ewig recht behalten, daß das Sein eine leere Fiktion ist. Die scheinbare Welt ist die einzige: die wahre Welt ist nur hinzugelogen.“
Die Scheinwelt ist jene fest stehende und für immer wahr seiende Welt. Es gibt daher keine ewigen Wahrheiten. Ewige Wahrheiten sind leere Signifikanten, die wie Zeit und Raum unser Sein einspannen ohne einen Anfang oder ein Ende zu kennen. Was soll das für ein Gespann sein? Zwei lose Enden? Gott, Gottes Sohn, Gottes Enkel, Gottes Sperma gezüchtet in einer Datenbank – Ergebnis: vom Inzest verkrüppelte Totgeburten.
Streifschuss vom 27. März 24
Anlass: Geschrieben vor 15 Jahren
Streifschuss 14. April 2008
Anlass: Olympiade in China
Sport ist Mord
Der älteste deutsche Fußballclub feiert sein 120jähriges Bestehen. Der B.F.C. Germania 1888 war im Jahr 1890 inoffizieller deutscher Fußballmeister. Heute spielen die Recken von Chef-Trainer Erkan Erdogan in der siebtklassigen Berliner Bezirksliga und liegen dort abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der BSV Hürtürkel führt diese Berliner Bezirksliga an. Immerhin findet sich eine kleine Geschichte des Fußballs auf der Webpräsenz des Vereins von Germania. Dort kann der Interessierte nachlesen, dass dieses Spiel 3000 vor Christi von den Chinesen erfunden wurde. Sie nannten es damals Tsu Chu (...einen Ball mit dem Fuß stoßen). Also: Im Jahr der brennenden Fackel - äh, Olympia, ein Indiz für die Chinesen, die vermutlich alles erfunden haben. Oder? Waren es doch die Tibeter? Wir werden es nie genau wissen können.
Aber wir erfahren weiter auf der informativen Webpräsenz des B.F.C Germania 1888, dass das angebliche Mutterland des Fußballs diesen Sport im 14. Jahrhundert sogar verboten hatte, da man "um die öffentliche Ordnung und um die Vernachlässigung des Kriegshandwerks fürchtete". Und ah ja: Die Römer unter Theodosius I. und dem II. um 400 vor Christi haben sogar die olympischen Spiele verboten, um das Heidentum zu bekämpfen. Auf niedrigem Niveau wurden die Spiele damals allerdings heimlich aufgeführt.
Das alles ist interessant, wissenswert und macht uns neugierig. Aber es hilft uns nicht weiter, wenn im August 2008 über 10.000 Athleten schwören werden: "Im Namen aller Athleten verspreche ich, dass wir an den Olympischen Spielen teilnehmen und dabei die gültigen Regeln respektieren und befolgen und uns dabei einem Sport ohne Doping und ohne Drogen verpflichten, im wahren Geist der Sportlichkeit, für den Ruhm des Sports und die Ehre unserer Mannschaft.“
Sport ist Mord. Dieser Ausspruch von Winston Churchill gewinnt für einen Tibeter dieser Tage eine ganz neue Bedeutung.
Streifschuss vom 23. März 24
Anlass: Earth Hour
Hippie Aliens
In der Science Fiction wurden schon alle möglichen Varianten durchgeführt. Die außerirdischen Eroberer, gekommen um aus der Erde eine Kolonie und uns zu Sklaven zu machen. Die außerirdischen Retter, gekommen, um unsere Erde und uns vor uns selbst zu retten. Die außerirdischen Lehrer, gekommen um uns beizubringen, wie man richtig lebt. Die außerirdischen Prüfer, gekommen und unsere Reife zu testen. Die außerirdischen Freunde, gekommen um uns in den galaktischen Planetenbund aufzunehmen. Die außerirdischen Flüchtlinge, gekommen um sich bei uns vor ihren Feinden zu verstecken. Und so weiter. Aber die wahrscheinlichste Variante haben all diese versponnenen SF-Schriftsteller nicht bedacht. Die ersten Aliens waren eine kleine Gruppe schlecht riechender, vergammelter Hippie-ETs in einem schäbigen, rostigen Raumschiff. Vollgepumpt mit hypergalaktischen Drogen, ausgestattet mit einer mehrdimensionalen Bong landeten sie versehentlich auf der Erde. Sie stammelten etwas über das Wassermannzeitalter universaler Echsen, die den intergalaktischen Frieden mit großer kaltblütiger Weisheit brächten. Sie waren mehr oder weniger humanoid. Sie sahen aus wie Hippies. Ihre Batik-Kleider lösten beim Ansehen Halluzinationen aus. Sie machten laute Musik, die in unseren Ohren nur Lärm war. Die Menschheit war ziemlich enttäuscht von dieser Art Besucher. Aber im Großen und Ganzen duldete man sie. Ein Hotelzimmer bekamen sie selten. Sie wurden weggejagt und kampierten meist im Freien. Unsere Kinder zeigten auf sie, manche spielten mit ihnen, bis ihre Eltern drauf kamen und das untersagten. Für ein paar schräge Vögel unter uns Menschen waren diese Goa-ETs interessant genug, um sich ihnen anzuschließen, mit ihnen durch die Lande zu ziehen. Sie fingen an, genau so schlecht zu riechen, glaubten an die hypergalaktische Anarchie, die sich lediglich in Faulenzerei, Mundraub und Gelegenheitsdiebstahl kundtat. Die Hippies kamen irgendwo aus dem Sternbild der Leier, einem von uns Menschen noch unentdeckten Planeten im System Wega, der Spektralklasse A0F0. Nur ein Jahr später kamen weitere Raumschiffe und schon kurz darauf immer mehr Shuttle-Schiffe mit Außerirdischen jeder Couleur. Die Hippie-ETs waren nur die ersten gewesen. Irgendwie hatte sich im Universum herumgesprochen, dass man auf der Erde billig Urlaub machen könne und es noch echte Meere gab, richtige Tiere, und echte Luft. Sie überrannten uns regelrecht, fotografieren alles auf der Erde, rissen die Pflanzen aus und horteten alles, was ihrer Ansicht nach menschentypisch war. Wir stellten uns allmählich auf sie ein. Die USA wurde zum Reiseparadies der Besucher. Aus einer blühenden Industrielandschaft von Los Angeles bis San Diego wurde ein Souvenirladen für Besucher. Shuttle auf Shuttle kam und die Hotels, Pensionen, Bungalows waren überfüllt. Auf der ganzen Welt wurden Andenken verkauft, traditionelle Tänze aufgeführt und Veranstaltungen extra für die außerirdischen Touristen. Das Geschäft brummte. Sämtliche Fabriken wurden geschlossen und zu Hotels umgebaut. Aber dann kamen plötzlich keine mehr. Über ein Jahr lang lagen die Geschäfte brach und es kam zu vermehrten sozialen Spannungen auf der Erde. Doch urplötzlich kamen sie wieder. Und noch mehr. Wir erkannten, dass sie in einem Dreijahreszyklus kamen. Der Planet im System Wega war ein Riese, in dem ein Tag drei Tage dauerte. Die Außerirdischen hatten daher einen ganz anderen Urlaubszyklus. Außerhalb der Saison kam eben kaum jemand auf die Erde. Einige Jahrzehnte ging das so. Wir lernten, uns darauf einzustellen. Aber dann wurden es immer weniger. Der Tourismus flaute ab. Angeblich gab es auf dem Planeten in Wega, wir nannten ihn Wegatron, eine Wirtschaftskrise und angeblich wäre die Erde zu teuer geworden. Wir reduzierten die Preise über unsere Schmerzgrenze. Aber es half nichts. Wir waren in den Jahrzehnten der Besuche so abhängig von ihnen geworden, dass wir uns kaum selbst ernähren konnten. Irgendwann blieben die Besucher ganz weg. Inzwischen kommt niemand mehr. Unsere Souvenirläden sind Ruinen geworden. Zuerst erlebten wir schwere Hungersnöte. Die sozialen Spannungen waren groß, aber da wir alle Fabriken schon seit Jahrzehnten geschlossen hatten, produzierten wir auch keine Waffen mehr. Die kleinen Auseinandersetzungen waren dann auch schnell vorüber, und die Menschen reichten sich wieder die Hand zur Versöhnung. Immerhin hatte sich die Erde ökologisch erholt, weil wir uns alle auf den Tourismus umgestellt hatten. Keine Industrie mehr, kaum noch CO2 Ausstoß, viel Sonnen- und Windenergie, alles wurde kompostiert. Wir lebten nun in den ehemaligen Hotels und Pensionen, betrieben auf niedrigem Niveau Landwirtschaft und da wir gelernt hatten, dass die Außerirdischen uns weit überlegen waren, hatten wir auch die Schulen weitestgehend abgeschafft. Wir würden aus rein biologischen Gründen nie das intellektuelle Niveau intergalaktischer Echsen erreichen. Heute leben wir im Einklang mit der Natur, begegnen den Tieren auf Augenhöhe. Wir haben gelernt. Wir haben alles verlernt. Wir leben einfach. Wie Bauern im Mittelalter. Hin und wieder einen mehrdimensionalen Bong, den uns die Hippie-ETs zurück gelassen haben. Ansonsten sind wir friedlich, gemütlich, ruhig und ohne Ehrgeiz. Eine der langweiligsten und uninteressantesten Existenzen im ganzen Multiversum.
Streifschuss vom
14. März 24
Anlass: Geburtstag eines Giganten – (Das Bild von Friedrich Hagemann zeigt den Philosophen Kant beim Anrühren von Senf)
Maximale Quadratur
Dreihundert Jahre nach Kants Geburtstag gelten die vier Sätze seines kategorischen Imperativs immer noch als Grenzmarkierung zur Barbarei. Die Naturgesetzformel, dass die maxima propositio (oberste Regel) meiner Handlung durch meinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte, da sei wahrlich Gott vor. Schon in dieser Hinsicht bin ich persönlich froh drum, nicht in einer solchen Lebensposition zu sein, in der mein Handeln einem Naturgesetz gleichkäme. Aber es gibt natürlich Menschen, die können einen Knopf drücken und eine Maschine in Gang setzen, die wie ein Naturgesetz auf uns wirkt. Tagtäglich sind wir mit diesen Auswirkungen konfrontiert. Die technische Komplexität unseres Daseins auszuhalten, erfordert schon übermenschliche Kräfte. Dazu noch all die Anstrengungen halbwegs unbeschädigt und nicht traumatisiert durch dieses Leben zu kommen, sind kaum noch zu erreichen. Und das in einer Welt, in der die Naturgesetze mein geringstes Problem sind. Vielmehr verursachen mir gerade jene Gesetze schwerste Traumata, die von Menschen gestaltet wurden, deren Handlungen tatsächlich zum allgemeinen Naturgesetz wurden. Und das ist wahrlich nicht schön. In dieser Hinsicht leben wir in einer barbarischen Welt.
Die zweite kantische Formel betrifft nicht die Naturgesetze, sondern die allgemeinen Gesetze des Menschen, also Recht und Ordnung. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde. Wer dieses „Allgemeine“ nicht denken kann, wer also nur nach seinen eigenen Gesetzen und nicht nach den allgemeinen Gesetzen handelt, der ist ein Barbar. Da wir Menschen evolutionsbiologisch nicht über unsere kleine Horde hinausdenken können, liegt allein in dieser kantischen Formel ein ganz eigenes kulturelles Unbehagen begraben. Kants Begriff von der „faulen Vernunft“, die derjenige anwendet, der nur seine Gesetze kennt und gleichzeitig so tut, als wären seine Gesetze allgemeingültige Gesetze, diese „faule Vernunft“ ist weit verbreitet und bestimmt den Lebenslauf fast aller meiner Mitbürger. Schon dies macht mich unendlich traurig. Denn die Menschen sind nicht dumm. Sie sind nur nicht fähig aus ihrer evolutionsbiologischen Haut zu kriechen und sich eine Allgemeinheit vorzustellen, die so abstrakt ist wie die Vorstellung von einem schwarzen Loch im Universum. Allgemeine Gesetze werden hier durch die Demokratie ausgehandelt. Sie wechseln ständig und niemand versteht mehr, warum eigentlich. Das allgemeine Gesetz in dieser Formel von Kant ist zur Tagespolitik verkommen und bedient nicht die Allgemeinheit, sondern wechselnde Interessensgruppen. Das ist pure Barbarei.
Die dritte Formel von Kant ist die Menschheitszweckformel. Der Satz des kategorischen Imperativs von Kant lautet hier: „Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ Diese Formel ist immerhin umsetzbar. Doch für die Agenten des Kapitals bin ich nur ein Endverbraucher und nur Mittel zur Bereicherung. Es ist eher ein Wunder, dass die produzierten Waren in ihrer Praxis auch einem Zweck dienen für die Menschen, denen diese Waren am Ende zum Verbrauch zugewiesen werden. Denn die Praxis der Produktion von Waren hat diesen Zweck nicht vorgesehen. Die Produktion von Waren dient allein einer Erhöhung der Rendite. Würden wir Menschen Scheiße fressen, würde der Kapitalist auch Scheiße produzieren. Tatsächlich ist das sogar der Fall. Bei den großen Marktführern der Nahrungsproduktion (Nestle, Unilever) wird längst Scheiße produziert und verkauft. Für diese Firmen ist es nicht von Bedeutung, ob die produzierten Waren auch dem Endverbraucher Vorteile bringen. Sie produzieren diese Waren zur Vermehrung ihrer Rendite. Dazu kalkulieren sie lediglich, wie viel Geschmacksverstärker die produzierte Scheiße übertünchen und ob es sich lohnt, die Scheiße überhaupt noch zu parfümieren. Die kantische Formel so zu handeln, dass der Endverbraucher der parfümierten Scheiße aus den Supermärkten, auch etwas davon hat außer Diabetes zu bekommen oder ein metabolisches Syndrom, diese Formel erfüllen Nestle und Co nicht. Dezidiert nicht. Auch andere Globalplayer im kapitalistischen Produktionshimmel interessiert es nicht im Geringsten, ob ihre bezahlenden Endverbraucher den Konsum dieser Waren überleben. Sie sind am Überleben der Endverbraucher nur interessiert, weil diese Leben ihre Rendite garantieren. So leben wir auch in unserem kapitalistischen Verbraucher-Himmel in luxuriöser Barbarei. Jeder tägliche Discounter-Besuch bestätigt diese Perversion. Dennoch lieben wir alle unsere Waren und umgeben uns mit ihnen so sehr, dass unsere Wohnungen aus allen kapitalistischen Nähten platzen. Der einzige Mangel unserer Gesellschaft ist der Mangel an Bescheidenheit. Es ist pervers. Was unsere Welt der Waren und des Tauschens betrifft, leben wir in tiefster Barbarei. Und da Geld den Alltag bestimmt, darüber bestimmt, wer ich bin, was ich bin und ob ich überhaupt sein darf, haben wir eine Form der Barbarei entwickelt, die geradezu dem Gegenteil der Menschheitszweckformel entspricht. Hier ist alles für die Menschheit unzweckmäßig. Das ist keine Behauptung, sondern belegt durch die aktuelle Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Diese Zerstörung der Erde ist ein Ergebnis unseres Wirtschaftens. Simpel.
Daher sind wir von Kants Endformel, so zu handeln, als ob wir durch unsere Maximen jederzeit ein gesetzgebendes Glied im allgemeinen Reiche der Zwecke wären, so weit entfernt, wie ein Stern in einer anderen Galaxie.
Dieses von Immanuel Kant beschworene allgemeine Reich der Zwecke ist keine Utopie im Sinne des goldenen Zeitalters. In dieser von Hesiod beschworenen Vergangenheit, als wir in Arkadien lebten, mit den Göttern befreundet von Sorgen befreit das Gemüte, fern von Mühen und fern von Trübsal; entrückt von jeglichem Übel, in dieser Vergangenheit war der Mensch nicht mündig und auch gar nicht fähig ein sittliches Wesen zu sein. Bei Hesiod heißt es weiter: Wie vom Schlummer bezwungen verschieden sie; keines der Güter missten sie; Frucht gab ihnen das nahrungsspendende Saatland gern von selbst und in Hülle und Fülle; und ganz nach Belieben schafften sie ruhig das Werk im Besitze der reichlichsten Gaben, wohl mit Herden gesegnet. Also ein kapitalistisches Schlaraffenland. Das war Arkadien. Aber das Ideal von Immanuel Kant ist nicht der naive und glückliche Mensch der ohne Kummer und Sorgen in einem Garten wohlbehütet wie ein Kind lebt. Die Freiheit, die uns als Mensch vor allem auszeichnet, ist eine Freiheit von den kausalen Naturgesetzen. So frei zu sein bedeutet, sich sittlich selbst zu bestimmen. Aber wie lässt sich das ohne totales Chaos auszulösen für acht Milliarden Menschen (und es werden immer mehr, 2050 werden wir die 15 Milliarden-Grenze überschreiten) bewerkstelligen. Wie können wir ein Reich der Zwecke gestalten in der jeder einzelne Mensch die Option hat, sittlich frei zu handeln? Gelingt dies nur unter Berücksichtigung der vier Formeln von Immanuel Kant? Und sind wir dann noch frei? Und jetzt, spätestens jetzt, sprengt es mir den Schädel und ich will nicht ein Wort mehr hören von Philosophie.
Streifschuss vom 14. Feber 24
Anlass: die Lunge
Der Blutsturz
In populärwissenschaftlichen Büchern zur Literaturgeschichte liest man oft vom „Blutsturz“,
den habe zum Beispiel 1892 Heinrich Mann erwischt, 1917 hatte auch Kafka einen Blutsturz, 1786 hatte schon Goethe einen in Leipzig und wiederholte den Blutsturz 1830 in Weimar. Ein wenig hat man den
Eindruck, ein guter Schriftsteller braucht eine schlechte Lunge. Thomas Bernhard hatte nur einen Lungenflügel. Thomas Mann verlor seine halbe Lunge im späten Mannesalter, und hatte davor einen
Blutsturz. Sein Hauptwerk hat er aber wohl mit kompletter Lunge und ohne Blutsturz geschrieben. Hardenberg, also unser Novalis, starb 1801 an einem Blutsturz. Wie auch immer. Der Volksmund und die
Literaturwissenschaft verwendet den Begriff „Blutsturz“ nicht spezifisch genug, um immer sicher zu sein, ob es sich auch wirklich um die Lunge handelte, also um eine Hämoptyse, und nicht doch ein
bisserl, ein klein wenig, der Magen beteiligt war, die Hämatemesis. So meint auch der Medizinhistoriker Nager, dass Goethe eher an einer Magenblutung verstorben sei.
Da man ja oft beim starken Husten mit erbricht, und weil der Schleim einer entzündeten Lunge oft rostbraun ist, und auch im Magen viel farbenfroher Schleim herumlungert, entsteht ganz schnell ein
Blutsturz. Außerdem bilden Lunge und Darm eine verzwickte Symbiose. In jedem Fall ist das Wort „Blutsturz“ viel zu gut, um ganz darauf zu verzichten. Wir lieben unsere Nationaldichter um ihrer
Blutstürze willen. Und keine Vita klingt nach etwas ohne Blutsturz. Da das Blut seinen Weg von unten nach oben geht, ist es eigentlich ein Sprung. Aber ich bitte Sie! Blutsprung? Was soll das denn
sein? Nein, nein. Wir bleiben beim Sturz. In der Medizin ist der Sturz lediglich ein Unfall. Ein Umfallen. Aus dem Gleichgewicht geraten, fällt man vom Stehen auf den Boden. Aber Blutfall? Das trifft
es nicht. In der Geschichte ist der Sturz viel dramatischer. Da stürzt der König, da stürzt eine ganze Klasse. Da ist es der Umsturz. In der Architektur ist der Sturz eine monolithische (aus einem
Stein) Abdeckung einer Maueröffnung (Fenstersturz, Türsturz), die Österreicher nennen es auch Überlager, die Schweizer sagen „Kämpfer“ dazu. Dass der Blutsturz am ehesten zur Bedeutung passt, die er
in der Geschichte hat, leuchtet ein. Zumal der Blutsturz stets ein für den davon betroffenen Dichter ein historisches Ereignis darstellt. Meist wendet sich nach dem Blutsturz irgendwie das Blatt, das
Werk wird neu geschrieben, nimmt erst seinen Lauf, kommt zum großen Abschluss. Ob Ende oder Anfang. Der Blutsturz ist immer ein medizinischer Fall von literarischer Bedeutung. Da die Lunge Flügel
hat, ist ein Blutsturz immer auch der Fall eines Pegasus reitenden Poeten. Zwar bildet die Metaphorik von Sprache nicht immer ganz rational die Wirklichkeit ab, aber das ist ja das Schöne an der
Sprache, dass sie uns von der jämmerlichen Wirklichkeit befreien kann und so wird ein so öder und unangenehmer Fall wie der Blutsturz zu einem kolossalen Ereignis mit aparter Neigung zur
Literatur.
Streifschuss vom
17. Januar 24
Anlass: faule Früchte
Inani usu – vom unnützen Nutzen
Matthäus 25, 14-30 schildert uns das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ein Unternehmer
gibt seinen Angestellten Geld zur Verwaltung. Dem ersten 5 Talente (biblische Währung, Gewichtseinheit für Silber), dem zweiten 2 Talente und dem dritten 1 Talent. Am Ende kehrt der Unternehmer von
einer längeren Reise zurück und möchte nun eine Abrechnung sehen. Was haben seine Angestellten mit dem Geld gemacht. Der erste Angestellte hat die fünf Talente zu zehn verdoppelt, ebenso der zweite,
der immerhin zwei Talente zu vieren verdoppelte. Nur der Angestellte mit nur einem Talent hat ihn aus Angst nur vergraben und nicht vermehrt. Auf diesen Nichtsnutz ist der Unternehmer stinksauer und
entlässt ihn, schlimmer noch. Im Text heißt es wörtlich: Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat! Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben;
wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.
Für einige Interpreten gilt diese Bibelstelle als Beleg für die Christlichkeit des Kapitalismus. Man soll seine Begabung, seine Fähigkeiten, sein Hab und Gut möglichst vermehren. Das Eigenschaftswort
„talentiert“ hat sich tatsächlich im Mittelalter über dieses Bibelgleichnis in die deutsche Sprache eingeschlichen. Und das Wort „Begabung“ geht auf die indogermanische Wurzel „ghab“ zurück, was
„ergreifen, fassen“ bedeutet. Wer seine Talente nicht nutzt, faul in der Sonne liegt und dabei das väterliche Erbe verprasst – man sieht sie vor sich die rich kids mit Sonnenbrille im schicken Cabrio
– nun, der kommt sicher nicht in den Genuss, einst an der Seite seiner Herrlichkeit zu sitzen und nach seinem Tode auf Wolke sieben zu schweben. Nein. Solche Faulpelze schweben schon jetzt auf Wolke
sieben und benötigen keine Herrlichkeit. Sie verschwenden ihre Talente und beleidigen den Herrn. Solche Nichtsnutze werden vor allem vom deutschen Streber allzu gerne verurteilt, ja geradezu
gehasst.
Im Jahr 2015 hat man das eben von mir geschilderte Gleichnis von den anvertrauten Talenten auf wissenschaftliche Füße gestellt. In einem Experiment an der Universität Bonn
(Wirtschaftswissenschaftler Armin Falk führte das durch und es ist inzwischen berühmt) gab man Teilnehmern zehn Euro in die Hand. Sie hatten nun die Gelegenheit mit diesem Geld einer ausrangierten
Labormaus einen friedlichen Lebensabend zu ermöglichen. 40 Prozent entschieden sich gegen die Labormaus und behielten die zehn Euro. Immerhin die Mehrheit hatte Mitleid mit der armen Maus. In einem
weiteren Experiment gab man den Teilnehmern sogar 20 Euro. Ein Verkäufer trat nun mit ihnen in Verbindung, um den Preis für das Überleben der Maus zu verhandeln. In diesem Fall ließen über 70 Prozent
der Teilnehmer die Maus für zehn oder sogar noch weniger Euro sterben. Das Mäuseleben war einer großen Mehrheit in einer marktähnlichen Situation sogar noch weniger wert. Die Wissenschaftler
interpretierten dieses Experiment dahingehend, dass moralische Werte durch die Markt-Situation erodierten. Der beim Feilschen, also in einer Tauschsituation, entstehende Charakter des Wettbewerbs
führt zum Homo oeconomicus, dem Menschen, der rational denkt und die Nutzenmaximierung über moralische Werte stellt. Nicht Mitleid mit der Maus, sondern ihr Preis wurde verhandelt.
Doch wer seine Fähigkeiten, seine Begabung nicht nutzt, handelt nicht marktkonform. Jeder Mensch hat seinen Preis, ist etwas wert. Würde hat jeder, doch nicht jeder ist das Gleiche wert. Wer seine
Talente nicht nutzt, handelt unmoralisch, ist weniger wert. Die Moral ist in diesem Vergleich von Gleichnis und wissenschaftlichem Experiment nicht eindeutig. Es erscheint wie ein Paradoxon, dem wir
modernen, in kapitalistischen Wettbewerbsgesellschaften erzogenen Menschen tagtäglich ausgesetzt sind. Empathie und Nutzenmaximierung erscheinen uns als Widerspruch. Da ökonomische Werte inzwischen
tief in unsere privaten Beziehungen eingedrungen sind (wir investieren in eine Beziehung), wirkt sich diese Paradoxie als kognitive Dissonanz auf unsere zwischenmenschlichen Kontakte aus. Geben –
heißt es in der Bibel, in der Apostelgeschichte – ist seliger denn nehmen. Doch wer immer nur gibt, wird hierzulande nicht wirklich selig, sondern geht pleite. Ja, am Ende gilt es als Schande, da man
dann selbst vom „Nehmen“ abhängig wird, zum Nichtsnutz verkommt. Der moderne Sozialstaat organisiert heute die Verteilung. Der Staat nimmt von den Talenten der Fleißigen und gibt sie den Bedürftigen.
Regelmäßig wird dieses System nach ihrem Nutzen abgeklopft und regelmäßig empfinden die Fleißigen diese Verteilung als ungerecht. Den armen Tropf, der sein Talent aus Angst es zu verlieren, vergräbt
(wie im Bibelgleichnis) animiert der Sozialstaat nun, die Schaufel in die Hand zu nehmen, sein Talent auszugraben und – ja was? – die Maus zu töten.
Iwan Alexandrowitsch Gontscharow (1812-1891) war ein rich kid, Sohn eines sehr reichen Getreidehändlers. Aber er nutzte sein Talent und schrieb den inzwischen berühmten Roman Oblomow. Dieser handelt
von einem begabten und gebildeten, aber ziemlich faulen russischen Adligen, Ilja Iljitsch Oblomow. Oblomow ist materiell weitestgehend abgesichert. Doch er bekommt gleich zu Beginn des Romans zwei
Herausforderungen. Einmal droht ihm der Hausbesitzer zu kündigen, wegen Eigenbedarfs. Oblomow soll umziehen. Und sein Dorfschulze (Gemeindevorsteher, vom Grundherrn eingesetzt) schreibt ihm von
Ernteausfällen und Verlusten. Zwar macht sich Oblomow Sorgen, bleibt aber dennoch untätig im Bett liegen, kann sich zu nichts durchringen. Er hat zarte, kleine weiße Hände, zieht sich weder an, noch
wäscht er sich. Sein Haus ist bereits unordentlich, voller Staub und sein Diener ist alt und mürrisch. Alle Versuche seiner Freunde, ihn aus dieser erstickenden Ruhe, Trägheit und Schläfrigkeit
herauszuholen, scheitern. Oblomow bleibt ihnen gegenüber freundlich aber reserviert und verliert sich in den Traum eines geborgenen, sicheren, von aller Verantwortung freien Lebens, in dem der
Mittagsschlaf Zentrum und Schwerpunkt der täglichen Verrichtungen ist. Pläne, das väterliche Gut Oblomowka zu pflegen, werden von einem auf den nächsten Tag verschoben, weshalb es mehr und mehr in
Verfall gerät. Schließlich wird Oblomow krank und stirbt an einem Schlaganfall, ohne noch einmal versucht zu haben, sein Leben zu gestalten. Das Paradebeispiel eines dekadenten Landadligen, der von
der Leibeigenschaft lebt und keine weitere gesellschaftliche Funktion übernimmt, noch vor hat diese zu übernehmen, wurde weitestgehend als Kritik daran gelesen und als Oblomowtum bezeichnet. Ja der
Name Oblomow ging sogar in die Psychiatriegeschichte ein als Beleg für den Neurotiker, der apathisch, faul und parasitär lebt, obwohl er über andere Fähigkeiten verfügt, diese aber nicht einsetzt und
in Muße lebt ohne diese auch genießen zu können.
Mit diesem Oblomow hatte ich immer tiefstes Mitgefühl und hege bis heute eine Sympathie, die ich gar nicht erklären kann. Vielleicht ist es auch ein wenig Neid auf die, denen die Lebenswurstigkeit
zur Realität wurde. Doch im Vordergrund steht mein freundschaftliches Mitgefühl mit allen Nichtsnutzen dieser Welt. Während mich die Nutzenmaximierer und die Fleißigen, die Streber unangenehm
aufrütteln, mich gegen meinen Willen antreiben, indem sie mir ständig Gewissensbisse machen, Gewissensbisse die ich schon derart internalisiert habe, dass ich sie kaum noch verdrängen kann. Es sind
diese Fleißigen, diese Streber, die beständig die Welt umgraben und aufwühlen, für Unruhe sorgen und uns antreiben mit dem Argument, Faulheit führe in den Niedergang.
Der Angestellte, der sein Talent vergräbt, der Teilnehmer am Experiment, der ein Mäuseleben rettet und Oblomow, sind sich sehr ähnlich, denn ich bin mir sicher, dass Oblomow die Maus gerettet hätte und der Mann aus der Bibel ebenfalls. Warum aber alle am Ende in die Hölle fahren, in die Finsternis? Das muss man mir tagtäglich neu erklären, damit ich so tue, als würde ich es begreifen. Ist es wirklich so schlimm, die arme Labormaus zu retten und ihr einen gemütlichen Oblomow-Lebensabend zu ermöglichen? Ich glaube nicht. So. Aber jetzt muss ich wirklich was arbeiten gehen. Nutzt ja nichts.
Rufen Sie einfach an unter
Arwed Vogel
++49 ( )8762 726121
oder
Bernhard Horwatitsch
017646130019
horwatitsch[at]gmx.at
...
oder
nutzen Sie unser






