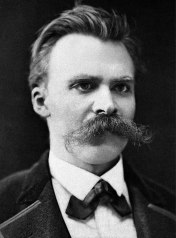Texte über Literatur
Im ersten Buch schildert Lion Feuchtwanger (LF) die Hochzeit von Herzog
Heinrich mit Beatrice von Savoyen 1328, danach die Hochzeit seiner Tochter Margarete 1330. Beide Hochzeiten finden in Innsbruck St. Wilten statt. Feuchtwanger schildert die Kinderhochzeit einer
12jährigen mit einem neunjährigen (Prinz Johann von Böhmen), er zeigt die Verstrickung der großen Dynastien, der Luxemburger, Wittelsbacher und Habsburger. Nach dem Tod von Herzog Heinrich 1335
kommen sich die Wittelsbacher und Habsburger näher, weil sie sich gegen die Macht und den Einfluss der Luxemburger auf Tirol gegenüber verschwören.
Weiter zeigt er die Macht der Barone in Tirol, die schließlich Margarete zu einem Aufstand überreden (wobei sie bereit war, weil Johann ein Arsch war), der zunächst scheitert. Ihre weibliche
Gegenspielerin ist Agnes von Flavon. Das Opfer, das Margarete hier gibt ist der junge Ritter Chretien de Laferte (eine fiktive Figur), von dem sie sich verraten fühlt.
Aber als Margarete einwilligt, Ludwig von Brandenburg, den Sohn von Kaiser Ludwig den Baier, zu heiraten, gelingt ihr die Befreiung von den Luxemburger, sie verwehrt Johann den Zugang auf die Burg. Diese Jahre gehen von 1328 bis 1341.
Der Antagonismus den LF aufbaut ist eine historische Kompilation, wenn man so will. Es gab wohl eine Sippe von Faun (Flavon) und es gab tatsächlich von der Burg Haag stammend den Konrad von Frauenburg (der im zweiten Buch auftaucht), der mit Margarete ein Verhältnis hatte und von da kommt wohl die Zuspitzung mit Maultasch. Doch hier ist der Roman fiktiv und nicht historisch. LF nutzt so einen legendären Ruf um eine These aufzustellen und die Figuren so zu literarisieren und zu charakterisieren, dass sie als Individuen greifbar werden und nicht nur historische Emblematik sind.
Ausführlich
Zwischen der Stdat Innsbruck und dem Kloster Wilten auf weitem, freiem Blachfeld hoben sich Gezelte, Fahnenstangen; Tribünen waren aufgerichtet, eine Art Rennbahn abgestekct für Turniere und andere sportliche Spiele des Adels.
Dies ist der der erste Satz im Roman von Feuchtwanger, Der Roman beginnt im Jahr 1328. Und das ist programmatisch. Es ist nicht nur die Hochzeit von Herzog Heinrich VI von Kärnten und Krain, sowie Graf von Tirol mit Beatrice von Savoyen, seiner dritten Ehefrau (nach Anna Premyslova, seinem böhmischen Abenteuer, und Adelheid von Braunschweig, aus dieser Ehe ging Margarete hervor). Nein, es ist auch das Jahr, in dem sich Ludwig IV, der Baier nicht vom Papst sondern von Vertretern des römischen Volkes zum Kaiser krönen ließ und München die erste kaiserliche Residenzstadt wurde, in der sich der Kaiser auch aufhielt. Es ist das Jahr in dem Robert Bruce für die Schotten und Königin Isabella den Unabhängigkeitsvertrag von Schottland gegenüber England unterschrieb, es ist das Jahr, in dem in München die Augustinerbrauerei gegründet wurde!!
Es findet ein Rittertournier statt. Dies war deshalb wichtig, weil solche Veranstaltungen mehrere soziale Funktionen erfüllten. Es ging den Teilnehmern um sozialen Status und Prestige. Ritter waren niederer Adel mit eher wenig Landbesitz, wenig Lehen. In Tournieren konnte man so Lehen vom Gastgeber (in dem Fall Herzog Heinrich VI) gewinnen, aber auch einen Platz am Hof, wenn man wollte. Zugleich waren solche Veranstaltungen auch ein medialer Träger für Vernetzungen, Informationsaustausch, Allianzen und Ehepläne. Und nicht zuletzt zogen diese Tourniere auch Händler, Handwerker und Schausteller an, das führte daher stets auch zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Auch die Verbreitung der höfischen Kultur unter den normalen Menschen (meist Bauern) als Ideal und Lebensstil war nicht ohne Bedeutung.
LT schildert das Lehenswesen ausführlich.
„Die fünf Herren des engsten Gefolges hatten, die weitläufige Zeltstadt durchreitend, halbe, andeutende, lächelnde
Sätze über die verzögerte Hochzeit des Königs getauscht. Sie waren alle fünf weit begabter als ihr Herr, sie quetschten ihn, vor allem der brutale Burggraf Volkmar, nach Kräften aus, preßten ihm
immer neue Belehnungen, Herrschaften, Steuerverpachtungen ab.“
Das Lehenswesen war eine Pyramide, aber doch komplizierter, als meist dargestellt. Ganz oben
der König, dann die Herzöge und dann die Grafen, danch die Barone und dann der niedere Adel (Ritter, Edle, Junker, Vögte, Knappen). Ganz unten und meist unfrei waren die Bauern.
Sowohl deskriptiv wie normativ galt der Sachsenspiegel von Eike von Repgau im 13. Jahrhundert verfasst als das Standardwerk an das man sich juristisch beim Lehenswesen orientierte. Aber natürlich
waren Macht und Einfluss wie in allen Zeiten komplizierter Geflechte aus sozialen Normen und Geld.
„Am Hebel der Geschicke des Römischen Reichs saßen drei Fürsten. Der rasche, glänzende, schillernde Johann von Luxemburg-Böhmen, der schwere, schwankende Ludwig von Wittelsbach, der zähe, weitsichtige Albrecht von Habsburg.“
Alle drei streiten sich um:
„Das Land in den Bergen, das reiche, schöne, fruchtbare berühmte Land, dehnte sich von den burgundischen Grenzen bis zur Adria, von der Bayerischen Hochebene in die Lonbardei. War die Brücke von den österreichischen Besitzungen der Habsburger zu ihren schwäbischen, von Deutschland nach Italien, der Schlüssel zum Imperium.“
Zwei Verträge kreuzen sich. Einmal eine vertragliche Zusicherung des Kaisers Ludwig für die Erbfolge Margaretes und der Vertrag mit dem Luxemburger und 40.000 Silberlinge Mitgift.
Da Heinrich keine männlichen Nachkommen hat, würde wohl Margarete die Länder erben. Doch:
„Durch das Versprechen einer noch weit reicheren Mitgift hatte er (Johann von Luxemburg, König von Böhmen) Heinrich einen Vertrag abgelistet, dem zufolge Heinrichs kleine Tochter Margarete einen von Johanns kleinen Söhnen heiraten und, falls Heinrich ohne männliche Nachkommen mit dem Tod abginge, seine Länder erben sollte.“
So kommt es zu der folgenschweren Hochzeit von Margarete mit Prinz Johann. Johann und Margarete bekommen nach Heinrichs Tod 1335 die Grafschaft Tirol und Kärnten geht an die Habsburger.
„Sie sah älter aus als ihre zwölf Jahre. Über einem dicklichen Körper mit kurzen Gliedmaßen saß ein großer, unförmiger Kopf. Wohl war die Stirne klar und rein, und die Augen schauten klug, rasch, urteilend, spürend; aber unter einer kleinen, breiten, platten Nase sprang der Mund äffisch vor mit ungeheuren Kiefern, wulstiger Unterlippe. Das kupferfarbene Haar war hart, spröde, stumpf, ohne Glanz, die Haut kalkig grau, bläßlich, unrein, lappig.“
Es ist nicht die einzige gruslige Darstellung der Herzogin. Ob sie wirklich so hässlich war, ist schwer anzuzweifeln. Die Herzogin von Tirol war vermutlich nicht hässlich, vielmehr ist der Name abgeleitet von „Hure, liederliches Weib“. Der Name könnte auch von der Burg Neuhaus kommen, ihre Lieblingsburg, die im Volksmund Mäusefalle / Maultasch genannt worden ist. Margarethe löste einen Skandal aus, weil sie aus eigenen Stücken die Ehe mit Johann löste. Sie wurde im Nachhinein verunglimpft.
„Der zehnjährige Prinz Johann erwartete die Braut, die ihm vermählt werden sollte. Mager, knochig, sehr groß für seine Jahre, stand der Prinz, der dünne, lange Kopf leidlich hübsch, doch versteckten sich tief in den Höhlen bösartige, kleine Augen. Unbehaglich rieb er sich in seinen engen, modischen Kleidern, die schmale Brust peinlich zerstoßen in einer rein dekorativen Halbrüstung, die er bei diesem Anlaß zum erstenmal trug. So drückte er sich, schwitzend, sonderbar unsicher, zwischen den fünfzehn böhmischen und luxemburgischen Herren herum, die ihm das Geleite gegeben.“
Die Geschichte urteilte weniger hart über diesen Mann. Immerhin hat er nach der unfreiwilligen Scheidung von Margarete von Tirol im Jahr 1349 eine Margarete von Troppau geehelicht (ein Herzogtum in der Markgrafschaft Mähren) und er war von 1348 bis zu seinem Tod 1375 (in Brünn) Statthalter in Böhmen (vom älteren Bruder und späteren Kaiser Karl IV eingesetzt). In dieser Zeit führte seine – laut Wikipedia – „umsichtige Herrschaft zu einer Blütezeit in Mähren.
„Er konnte sich mit seinem Vater kaum verständigen; der sprach kein Böhmisch, er kein Französisch; sie mußten Deutsch miteinander reden, das sie beide nur schlecht beherrschten.“
Es ist wahrscheinlich, dass es wirklich so war. Es gab keine Nationen wie heute. Herrschaften waren nicht national, sondern dynastisch. So gab es innerhalb der Dynastien, der Familien eine Sprachvielfalt.
„Chretien war ihm (Johann Heinrich) seit etwa einem Jahr vom Hof seines Vaters beigegeben worden als älterer Spielgefährte und Kamerad, der ihm höfische Dienste leisten und vornehmlich französische und burgundische Sitte beibringen sollte.“
Dieser Chretien de Laferte ist eine Fiktion von LF. Dagegen sind die erwähnten Tiroler Barone und Bischöfe alle historisch belegt. Das auf Seite 69 geschilderte Geheimtreffen auf der Burgstall des Landeshauptmann Volkmar gab es. Natürlich ist der Ablauf hier fiktiv. Aber allein die Schilderung „In der klobigen, altväterlichen Burg…war der Raum nicht zu durchwärmen; die Herren rückten unbehaglich hin und her; man briet auf der einen Seite, fror auf der andern.“
Sie zeigt eines, dass die Bauweisen sich schon unterschieden haben und im Gegensatz dazu war Schloss Zenoburg ein Viersternehotel.
„Es waren Messer Artese aus Florenz, der Pächter der Münze von Meran, und seine beiden Brüder. Die Herren waren auch diesmal gern bereit, einem so gütigen christlichen König mit ihrem Bißchen Kapital beispringen zu dürfen. Sie hatten eine einzige kleine Bedingnis: die Majestät sollte ihnen die Einkünfte des Salzwerks von Hall überlassen. Das nette, kleine Salzbergwerk.“
Tatsächlich wer die ursprüngliche Münzprägestätte in Meran, erst 1477 wurde sie nach Hall verlegt. Die Brüder Messer Artese sind vermutlich Fiktion. „Artese“ ist eine übliche Anrede für Herren gewesen in der Zeit in Italien. Also die Herren Artese. Artese ist ein üblicher Name.
Was aber hier von LF gezeigt wird, das ist sicher ein Hinweis auch auf die Weimarer Epoche und die Dramatik der Verschuldung.
„Dringt warnte der Abt den Bischof, er solle sich ja nicht im geringsten mit dem Luxemburger einlassen. Seine Politik sei letzten Endes sinnloses Spiel. … Nicht der Erfolf locke, ihn locke die gefährliche Freude an der Wirrung, am Getriebe. Wo immer in dem wirrseligen Europa ein Zwist sei, wo Kaiser und Papst swich stritten, König und Gegenkönig, Frankreich und England, lombardische Städte, maure und kastileir, überall müsse der Luxemburger seine gepflegte, spielerische Hand drinhaben. Verträge, Bündnisse stiften, Ehen kuppeln, fäden anknüpfen, zerreißen, Krieg führen, Frieden schließen, Schalchten schlagen, verhndern, immer im dicksten Getümmel stehen, Freunde, Feinde machen, Soldaten, Länder nehmen, geben. Nur kein Geld, seufzte der Bischof.“
Während der Papst in Avignon sitzt, Johannes der XXII, und seinen Goldschatz hortet und nichts davon ausgibt. „Der Papst hing an dem Geld, er brachte es nicht über sich, es weiterzuverwerten.“ So auf Seite 43.
„Das Kind Margarete wuchs heran auf den Schlössern zenoberg, Gries, Tirol. Lernte gern und viel. …Sie sprach und schrieb fließend Latein und Welsch. Interessierte sich brennend für politische und nationalökonomische Dinge… Verächtlich schnupperte sie, als sie hörte, Ludwig von Wittelsbach, der Baier, erwählter Römischer Kaiser, der vierte seines Namens, spreche nicht Latein.“
Dagegen – und das ist wieder der Antagonismus mit dem LF arbeitet:
„Der gutmütige König Heinrich kümmerte sich wenig um sie. …Er ging ganz auf in Kleidersorgen, Stiftungen für Klöster, Festlichkeiten, Gastereien, Turnieren, Frauen.“
Dass Margarete ohne Vater und Mutter aufwuchs, von Baronen und Äbtissinnen (Kloster Stams, Sonnenberg) unterrichtet und aufgezogen wurde, wird hier klar ersichtlich.
Während ihr Gemahl Johann Heinrich meist nur jagen geht.
„Er haßte die Bücher, lernte nur notdürftig schreiben. Gern trieb er körperliche Übungen. Schlug sich mit den Jungen herum, mit denen der Bedienten leiber als mit seinen adeligen Kameraden, jagte, ritt.“
Sie stapelt hier ihre Verachtung. Wie gesagt, das ist nicht historisch gesichert. Aber Legenden bilden sich aus dem Stoff, der vorliegt. So kann es auch eine Form der Propaganda der mächtigen Tiroler Barone gewesen sein, den ungeliebte Luxemburger zu schmähen. LF greift die Legenden auf. Historisch ließe sich dazu einfach zu wenig sagen. Aber die Gegensätze die LF schafft, machen das Geschehen verständlich.
„Seine (von Schenna) Burgen, vor allem seine Lieblingssitze Schenna und Runkelstein, waren hell und voll Sonne.
Italienische Architekten hatten sie gebaut…Ja selbst die äußere Südwand einer Lieblingsschlösser trug solche Malerei. Bunt und hell schritt der Ritter mit dem Löwen, Tristan führ auf seinem Schiff,
Garel vom blühenden Tal erlebte seine Abenteuer. Herr von Schenne leibte sehr die Verse, die diese Geschichten erzählten. Margarete wußte nichts damit anzufangen. Sie begriff die lateinischen Verse,
die der redselige Abt von Viktring so gern zitierte, verstand Horaz, die Äneis. Das war Sinn, Gesetz, Würde, strenge Bindung. Aber diese deutschen Verse schienen ihr Tollheit, nicht besser als die
wüsten Einfälle ihrer Hofnarren und Hofzwerge.“
Der Gegensatz von Klassik und Romantik ist hier bestimmt mehr ein moderner Gedanke, in dem LF die Deutschtümelei der Weimarer Zeit karikiert. Tatsächlich waren die Heldenlieder der jüngeren Vergangenheit sehr beliebt, vom Hildebrandlied, Rolandslied und Tristan (durch Gottfried von Straßburg verbreitet). Dagegen dürfte Margarete nicht Vergil gelesen haben, sondern die Eneis, eine Adaption von Heinrich von Veldeke (12-13. Jahrhundert).
„Starb nun ein Bischof, so ward nicht etwa ein neuer Prälat an seine Stelle gesetzt, nein, der Papst berief den Inhaber eines andern Bistums in das erledigte, so daß mit dem Tod jedes Bischofs eine ganze Reihe päpstlicher Lehen frei ward. So war ein ewiger Wechsel in der hohen Hierarchie, ein Kommen und Gehen wie in einer Herberge, und der Heilige Stuhl bezog die fettesten Annaten.“
LF schildert das raffinierte Geldsystem der Päpste. Die Annalen (annus, Jahr) waren Gebühren, die der Bischof bei Ernennung und dann regelmäßig an den Papst zahlte. Durch das ständige Neubesetzen in der von LF geschilderten Form gab es permanent Gebühren für den Papst. Das führte ja dann zur Reformation.
„Im Bistum Chur war ein gewisser Peter von Flavon gegütert“ (Seite 48)
Wie schon gesagt, es gibt keinen historischen Hintergrund für diese Figur. Aber es ist ein wichtiger Antagonist zu Margarete. Die Frau des verstorbenen von Flavon wird im Roman zur Geliebten von Margaretes Vater. Damit sind zumindest die Beziehungen zum Bistum Chur geklärt.
Von den drei Töchtern
„Die drei Mädchen wuchsen ohne viel Erziehung heran, wild und sehr verwöhnt. … Sie waren alle drei sehr hübsch, weiß, glatt, rosig, fleischig, blond. Die schönste war die mittlere, Agnes von Flavon.“
wird dann Agnes zur Gegenspielerin der Herzogin Margarete.
Das Bistum gab es natürlich und es dehnte sich im Spätmittelalter bis Italien und Österreich aus. So war auch der Besitz von Taufers in Münstertal umstritten und das Bistum Chur und die Grafschaft Tirol stritten darum. Wohl war es zu der Zeit in Lehen der Tiroler. Daher konnte Margarete es an Chretien de Laferte belehen.
„König Heinrich alterte sehr früh, verfiel zusehends….Nun wird er also sterben. Er ließ sich in die Kapelle des heiligen Pankratius bringen. …So ereilte ihn ein letzter Blutsturz, erstickte ihn.“
Die Folge ist, dass sowohl Wittelsbacher wie Habsburger erneut und stärker ihr Interesse an Tirol anmelden.
„Unterdes wurde Kärnten und Krain ohne Widerstnd von den Habsburgern besetzt.“
Dort wird Herzog Otto von Österreich als Statthalter eingesetzt.
Tirol kann gehalten werden.
„und die drei Kinder (Johann Heinrich, Markgraf Karl und Margarete sind gemeint) konnten in einem kurzen Krieg, der äußerst sachlich, gründlich und grausam geführt wurde, Tirol halten.“
Auf Burgstall von Volkmar kommt es nun zur Verschwörung der Barone.
„In der klobigen, altväterlichen Burg des Tiroler Landeshauptmann Volkmar von Burgstall saßen sieben, acht von den einflußreichsten tirolischen Baronen beim Wein.“
Margarete wird informiert. Sie setzt Chretien als Anführer ein. Doch der Bischof von Brünn verrät die Verschwörung und sie wird niedergeschlagen.
Nun kommt es zu dem Vorschlag von Schenna, den ältesten Sohn von Kaiser Ludwig von Baiern zu heiraten, Ludwig von Brandenburg. Damit hat sich die Fürsprache der mächtigen Wittelsbacher und kann Johann Heinrich vertreiben.
So endet das erste Buch.
Die Geburt der Tragödie
Einleitung
Die Tragödie endet mit dem Scheitern des Helden. Ihre Wirkung erzielt sie durch den hohen Fall. Dadurch löst sie beim Zuschauer zwei Emotionen aus, die von Bedeutung sind. Mitleid und Angst. Für den Philosophen Aristoteles bedeutete dies, dass die Zuschauer einer Tragödie sich von diesen Gefühlen reinigen können. Ein simples psychologisches Rezept liegt dem zugrunde. Von außen kommen die Emotionen in mich, also muss ich mich ihrer entledigen. Einverleiben und ausscheiden. Andererseits wird die Intensivierung von Mitleid und Angst auch zeigen, dass sie gegenüber anderen Leidenschaften überlegen sind, tiefer, kräftiger und bedeutender. Drei gute Erziehungsmaßnahmen verursachen diese Evokation von Mitleid und Angst durch die Tragödie. Einmal Abhärtung, dann schaffen sie ein Mittelmaß, und zu guter Letzt lustvolle Erleichterung. Ich härte mich ab, pendle mich ein und erleichtere mich. Die Tragödie erfuhr im Laufe der Geschichte mehrere Metamorphosen von der römischen Tragödie zur französischen Klassik (Racine, Corneille) bis zum bürgerlichen Trauerspiel (Hebbel, Schiller, Goethe).
Heute im 21. Jahrhundert ist von der Tragödie nur noch der darstellende Effekt übrig geblieben.
Nummer Eins
Es gibt drei große antike Tragödiendichter, die man mit der griechischen Tragödie, dem Bocksgesang zusammenbringt. Aischylos, Sophokles und Euripides. Einer ihrer unmittelbaren Vorläufer, den die Geschichtsschreibung gerne unterschlägt, ohne den aber die drei Väter der attischen Tragödie so nicht denkbar wären, war Thespis, der unter dem Tyrann Peisistratos im Jahr 534 v. Chr. erstmals einen Schauspieler auftreten ließ zusätzlich zum sonst nur vorhandenen Chor. Der Schauspieler bei Thespis war in ein Dionysos-Kostüm gekleidet und trat in einen Dialog mit dem Chor. Die Tragödie war geboren. Anfangs noch der Monolog und der Chor als überdimensionaler Kommentator. Aber dieser innovative Schachzug von Thespis ist noch heute in Spuren erhalten, im so genannten Thespiswagen. Der römische Dichter Quintus Horatius Flaccus – bekannt unter seinem Spitznamen Horaz – behauptete 500 Jahre später, Thespis sei immer mit einer Wanderbühne auf einem Karren herumgezogen. Die Tradition der wandernden Schausteller mit ihren Wohnwägen bildeten bis ins 19. Jahrhundert die Grundlagen des Volkstheaters.
Nummer zwei
Aischylos stellt dem Chor zwei Schauspieler gegenüber und schafft damit die Voraussetzung jedes Dramas, den Dialog – Grundwissen deutsche Literatur, Ernst Klett 1981
Sein großer Nachfolger Aischylos jedenfalls hatte es nicht mehr so schwer, als er die Tragödie um noch einen Schauspieler erweiterte und so das klassische Drama endgültig erschuf, das wesentlich auf dem Dialog ruht.
Aischylos wurde 525 vor Christus in Eleusis geboren. In dem Wikipedia-Artikel über ihn
heißt es, er sei der Sohn des Euphorion. Wäre er der Sohn des Euphorion, stammte er unmittelbar von Achilles und Helena ab, die ja bekanntermaßen auf Elysion einen Sohn zeugten, den sie Euphorion
nannten (und auf den sich auch Goethe in seinem Faust bezieht, als Faust und Helena in Arkadien einen Sohn haben, nennen sie ihn auch Euphorion). Doch Zeus hat ihn schon als Jüngling mit seinem Blitz
erschlagen, weil er seine Liebe nicht erwiderte. Und die Nymphen, die Euphorion dann bestatten wollten, verwandelte Zeus in Frösche. Diese Arschgeige von Gott. Goethe hat Euphorion dann in seinem
Faust jung sterben lassen, weil er enthusiastisch die Griechen von den Türken befreien wollte (wie das zur Zeit Goethes alle wollten, auch Goethes britischer Kumpel Lord Byron), dabei kam der Junge
ums Leben (wie Goethes Kumpel Lord Byron). Die Nymphen gehen quasi auf natürliche Weise wieder in die Quelle zurück, der sie entsprungen waren, verwandeln sich in Pflanzen und Wasserschlangen. Goethe
erwähnt Zeus nicht einmal.
Wie auch immer und abgesehen davon, dass die schriftliche Quelle dieses Euphorion-Mythos deutlich jünger ist, als Aischylos selbst (sie stammt nämlich von Ptolemaios von Chennos, aus der Schrift
Kaine Hystoria aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert) - . Auf einer weiteren Internetseite „Philosophie der Stoa“, heißt es in einem Artikel von Bernhard Zimmermann, er sei der Sohn
des Euphonion. Ein „n“ statt eines „r“. Wer auch immer von wem abgeschrieben hat, hat sich vertippt. Es erscheint mir immerhin logischer, dass Aischylos der Sohn eines Gutsbesitzers war, als der Sohn
eines mythischen Kindes. Aischylos stammt aus einem Adelsgeschlecht. Das Gut von Euphonion stand in Eleusis in der Region Attika, die Athen umgibt. In Eleusis wurden die Mysterien zu Ehren von
Demeter abgehalten. Der Tyrann Peisistratos herrschte von 546 bis 527 vor Christus in Athen und er förderte dieses Fest, verehrte Athene und Dionysos. Danach herrschten seine Söhne Hippias und
Hipparchos. Aischylos erlebte als Junge von vielleicht 10 Jahren, wie Harmodios und Aristogeiton den Hipparchos töteten und anschließend von seinem Bruder Hippias getötet und gefoltert wurden.
Der berühmte Tyrannenmord geschah während der großen Panathenäen zu Ehren Athene. 510 vor Christus wurde dann der im Exil lebende berühmte Kleisthenes mit Hilfe von Sparta Herrscher. Es kam zu den
kleisthenischen Reformen, der Basis der attischen Demokratie, die dann Mitte des fünften Jahrhunderts unter Perikles seine Blütezeit hatte. Die Dionysien führte man weiter in Eleusis durch.
Aischylos ist also ganz ein Kind seiner Zeit, nimmt bei den Perserkriegen teil, bei der berühmten Schlacht bei Marathon (490 v.Chr.) und der Schlacht bei Salamis (480 v. Chr.). Er gewinnt den
Siegespreis der Dionysien 472 v. Chr. mit seiner Tragödie „Die Perser“, wo er seine Erlebnisse als Soldat dramatisierte.
Ein typischer Fünfakter mit Chor, Chorführer und einer Hauptdarstellerin, der Königin Mutter
Atossa vom zweiten bis zum vierten Akt. Der erste Akt (Exposition) wird in einem Monolog des Chorführers dargestellt. Er erzählt darüber, wie sich das gewaltige Heer von Xerxes I. auf den Weg nach
Griechenland macht, eine Brücke bauen lässt über den Hellespont (die Dardanellen, einer Meerenge zwischen ägäischem Meer und Mittelmeer). Xerxes I. will seinen Vater Darius I. rächen, der in der
Schlacht bei Marathon zehn Jahr zuvor eine Niederlage gegen die Griechen kassierte, auch die Sorgen der persischen Frauen um ihre Männer die in den Krieg ziehen, wird erwähnt. Dann tritt Atossa
auf, die Mutter von Xerxes I.. Sie hatte einen sonderbaren Traum. Sie sieht zwei Schwestern gleichen Stammes, die eine in persischem, die andere in griechischem Gewand. Die beiden streiten. Xerxes
spannt beide in ein Joch vor den Wagen, um so den Streit zu schlichten. Eine der Schwestern akzeptiert dies, aber die andere reißt sich los und der Wagen bricht zügellos davon, Xerxes fällt runter
vor den Augen seines Papis, schämt sich, zerreißt seine Kleider. Atossa will den Göttern opfern, um Leid von ihrem Sohn abzuwenden, da sieht sie einen Adler zum Altar fliegen, wohl auf der Flucht vor
einem Habicht. Der Adler gibt sich dann dem Habicht willenlos preis.
Der dritte Akt ist ein Zwiegespräch zwischen Atossa und dem Chor. Sie befragt den Chor ausführlich nach den Sitten und Gebräuchen der Athener. Als sie erfährt, dass die Athener keinen Gebieter haben,
reagiert Atossa mit Unverständnis. Hier kann man noch besser erkennen, dass „Die Perser“ von Aischylos ein Stück Propagandaliteratur sind.
Nun erscheint ein Bote auf der Bühne, der vom Untergang der Flotte erzählt. Xerxes ist geradeso entkommen. Überall, auch in Asien verweigert man dem König von Persien die Tribute. Wir haben
hier den Beginn des dritten Aktes und das bringt nun den so genannten Umschwung, die Peripetie. Klassisch vermittelt durch einen Boten. Eines der kleinen Indizien, die den amerikanischen
Mythen-Forscher Joseph Campbell zu seiner Heldenreise-Idee (Heros in tausend Gestalten von 1949) anregten, die bis heute zum Lehrstoff des Creative Writing an amerikanischen Colleges
zählt.
Der vierte Akt ist nun wichtig als Spannungsaufbau durch Handlungsverzögerung, als retardierendes Moment. Atossa beschwört mit Hilfe des Chors ihren verstorbenen Gatten Darius I. aus dem Totenreich.
Dieser kommt auch als Geist und verflucht seinen Sohn, der so hochmütig war, eine Brücke über den Hellespont bauen zu wollen und dass er die Götter beleidigt habe, weil er ihre Bilder und Heiligtümer
zerstören ließ. Er bittet noch darum, dass man seinen Sohn trotzdem wie einen König empfangen möge. Und dann versinkt der Geist Darius I. wieder ins Reich der Toten. Es ist durchaus typisch, dass das
retardierende Moment mit Geistern aus dem Totenreich dargestellt wird. Dann kommt es zum fünften Akt, der Katastrophe. Man könnte das altgriechische Wort mit herab (kata) wenden (strephein)
übersetzen. Xerxes erscheint, mit zerrissenen Kleidern und einem leeren Köcher. Der Chor wirft ihm nun bitter vor, dass er die Blüte seines Volkes in den Hades schickte. Xerxes fühlt sich von einem
Gott besiegt und in gemeinsamen Wehklagen zwischen Xerxes und dem Chor endet das Stück.
Aischylos wird den ersten Preis der Dionysien insgesamt dreizehnmal gewinnen. Einmal verliert er gegen seinen Schüler und Nachfolger Sophokles, das war 463 v. Chr.
Aischylos stirbt auf Sizilien (Gela) im Jahr 456 v. Chr. Einer Legende nach hatte ein Orakel Aischylos gewarnt, dass sein Haus einstürzen würde und er dabei ums Leben käme. Daher zog er sich auf die Felder zurück. Klar, mit Orakelsprüchen sollte man sich nicht anlegen. Da kreiste über Aischylos ein Adler, der hatte eine Schildkröte in seinen Klauen und suchte nach einem passenden Stück Felsen, auf dem er die Schildkröte knacken könnte, um an ihr inneres Fleisch zu kommen. Der Adler sah einen glänzenden Felsen, der ihm perfekt erschien. Dieser Felsen war die in der Mittagssonne glitzernde Glatze von Aischylos. So starb er, erschlagen von einer Schildkröte. Das ist dann nicht mehr tragisch, sondern für uns klingt das eher komisch.
Nummer drei
Sophokles führt den dritten Schauspieler ein - Grundwissen deutsche Literatur, Ernst Klett 1981
Sophokles kommt 497 v. Chr. auf dem Hügel Kolonos zur Welt, einem heutigen Stadtteil von Athen. Er war der Sohn des recht wohlhabenden Waffenfabrikanten Sophillos. Sophokles war 480 v. Chr. der Vorsänger bei der Siegesfeier über Xerxes I. nach der Schlacht bei Salamis. Er erlernte sein Handwerk bei Aischylos selbst und besiegte den Meister 468 v. Chr. bei den dionysischen Festen mit einem vierteiligen Kunstwerk, das unter anderem eine Geschichte über Triptolemos enthielt und über Nausikaa (das ist das Mäderl, dem Odysseus am Strand von Scheria begegnete und dann seine Irrfahrten erzählte). Triptolemos ist noch ein ganz Archaischer, ein bisserl an Gilgamesch erinnerter Held. Triptolemos führte den Ackerbau ein auf Eleusis, er war einer der ersten, die von Demeter in die Mysterien eingeführt wurde. Bei Ovid können wir es nachlesen. Dort ist Triptolemos ein sehr krankes Kind, wird wohl sterben. Sein Vater Keleos stößt zufällig bei einem Verdauungsspaziergang auf ein altes Weib, das zusammengekauert auf der Straße liegt. Er nimmt es mitleidig zu sich und versorgt das alte Weib. Dieses sieht nun den kranken Jungen Tritpolemos und küsst ihn, spricht drei geheime Sprüche über ihn und will ihn gerade mit der Glut des Kaminfeuers bedecken, da reißt die Mutter ihr Kind aus den Armen des alten Weibes.
„Unversehns hast Du gesündigt: Mutterfurcht wendet die Gabe ab und der Knabe bleibt dem Tode verfallen, doch zuvor wird er ackern und säen und ernten.“ Heißt es dann bei Ovid (Fasti 4) Das alte Weib ist Demeter und sie wollte gerade den Jungen unsterblich machen. Das hat die Mutter verhindert. Dafür ackern, säen und ernten wir bis heute. Shit happens. Daraus machte Sophokles ein Drama, in dem er selbst als Lyraspieler auftrat. Sophokles wurde 443 zum Verwalter der Schatzkasse des attischen Seebundes und war zusammen mit Perikles (einem der größten griechischen Staatsmänner) Stratege im Krieg gegen Samos (441-439). Aber er war auch einer der Befürworter der Tyrannei der 400, die 411 in Athen an die Macht kamen und 399 v. Chr. Sokrates ermordeten. Sophokles war Priester für den Gott Asklepios, betätigte sich als Medium für die Götter, war zweimal verheiratet und angeblich bisexuell. Sophokles wurde 90 Jahre alt und überlebte damit seinen jüngeren Kollegen Euripides. Gestorben ist Sophokles 406 v. Chr. vermutlich friedlich. Aber es gibt das Gerücht, er sei an einer Weinbeere erstickt, dem Bolustod (da reizt ein Fremdkörper den am Kehlkopf gelegenen Vagusnerv und das Herz bleibt stehen) erlegen.
Seine thebanische Trilogie ist bis heute ein Meisterwerk, bestehend aus Antigone, König Ödipus
und Ödipus auf Kolonos.
Antigone ist die Tochter von Ödipus und wird von dem thebanischen König Kreon lebendig eingemauert, weil sie ihren Bruder Polyneikes gegen Kreons Erlass bestatten wollte. Das ganze Drama führt zu
einer Reihe Suiziden. So bringt sich Haimon um. Er ist der Sohn von Kreon und der Ehemann von Antigone. Er versucht seinen Vater davon abzubringen, Antigone zu bestrafen. Aber er scheitert. Als er
von ihrem Tod erfährt, bringt Haimon sich um. Als schließlich Eurydike vom Tod ihres Sohnes Haimon erfährt, bringt sie sich auch um.
Es dürfte dies der Grund sein, warum Nietzsche die Griechen nicht für ein glückliches, heiteres Volk hielt, wie Goethe und Konsorten. Sei’s drum. Auch die beiden Ödipus-Stücke von Sophokles sind
nicht gerade mit Heiterkeit und Spaß am Leben ausgezeichnet. Dem eigenen Sohn, einem Baby, die Füße durchstechen, zusammenbinden und das Kind dann im Gebirge bei irgendwelchen Hirten aussetzen, und
das nur wegen eines Orakelspruchs. Also das ist nicht heiter. Laios, einer der häufig auftretenden bisexuellen Herrscher, verliebte sich in Chrysippos, den Sohn seines Gastes Pelops, lässt diesen
entführen und bekommt daher beim Orakel die Weissagung, dass er vom eigenen Sohn abgemurkst wird, aber nicht nur das, der eigene Sohn würde dann auch noch seine Frau, also die Mutter, koitieren. So
ein Kind kann man nicht lieben. Der Hirte, bei dem Laios das üble Kind abliefert, hat ja keine Ahnung. Er hat Mitleid mit dem verstümmelten Baby und bringt es zu einem befreundeten Hirten in Korinth.
Dort kommt das Baby irgendwie in die Hände von dem Königspaar Polybos und Merope, die es adoptieren und ihm seinen mittlerweile berühmten Namen geben. Ödipus, wegen seiner geschwollenen Füße. In
Korinth wächst der Junge auf, wird zum Mann und hat keine Ahnung, wo er herkommt. Auf einem Fest macht dann ein Betrunkener eine Andeutung.
Ich persönlich finde diese Stelle bedeutsam. Es ist ein Betrunkener, ein Vertreter von Dionysos, der die Geschichte zum Laufen bringt! Nietzsche hatte also nicht ganz unrecht, wenn er es als einen schweren Verlust an Wirklichkeit beklagte, dass uns das Dionysische verloren ging.
Ödipus befragt das Orakel und das sagt ihm die Wahrheit, er werde seinen Papi meucheln und seine Mami heiraten. Das war nicht lustig. Ödipus beschließt, weit, weit weg zu gehen. Der Klassiker. Immer wenn das Orakel eine Äußerung über die Zukunft macht, versuchen die Protagonisten alles, dass das nicht geschieht und gerade deshalb geschieht es. So auch bei Ödipus, der auf seiner Reise, seiner Flucht vor dem Schicksal, an einer Kreuzung auf eine Kutsche trifft. Der Fahrer der Kutsche benimmt sich voll mies gegen Ödipus und Ödipus, ein junger, zorniger Mann, wird wütend und tötet den Fahrer. Er weiß nicht, dass der Fahrer der Kutsche sein Papi war, Laios. So wurde Laois von seinem eigenen Kind doch noch erschlagen, nur dass Laios es gar nicht wusste, als es passierte. Vor den Toren Thebens begegnet Ödipus einer Sphinx. Klar, die stehen da oft so rum, um irgendwelche Touristen zu foppen. Egal. Jedenfalls, die Sphinx stellt ihre Frage, - wahrscheinlich schon ein wenig gelangweilt, weil es Nachmittag ist und schon mehrere von ihr getötete Touristen herumliegen. Niemand hat das blöde Rätsel bisher gelöst. Was geht morgens auf vier Beinen, mittags auf zwei und abends auf drei Beinen? Na wer? Der Mensch, am Anfang krabbelt er blöd auf allen vieren rum, dann rafft er sich auf zwei Beine, hat zwei Arme frei und erschlägt eine Zeitlang seine Mitmenschen damit, dann wird er alt und schwach und braucht einen Stock. Super gelöst. Bravo Ödipus! Die Sphinx schreit auf. Verflucht! Stürzt sich suizidal vom Felsen und stirbt. Theben ist befreit. Ödipus hat das Monster erledigt und wird zum König von Theben erhoben. Die Königinmutter bekommt er gratis dazu. Und das ist Iokaste. Mit seiner Mutter zeugt Ödipus dann vier Kinder. In Unwissenheit, dass sie verwandt sind. Poyneikes und Eteokles, Antigone und Ismene.
Nach Jahren der Verbannung kommt der greise Ödipus mit seiner Tochter Antigone auf den Hügel Kolonos in Athen, legt sich dort gemütlich in einen Eumenidenhain, der immerhin heilig ist. Der Chor bittet den alten Mann freundlich, sich zu verpissen. Ist hier heilig, kein Altenheim. Als der Chor auch noch erfährt, wer der Alte ist, nämlich ein Vatermörder und Mutterficker, fordert der Chor den alten Ödipus auf, sofort zu gehen. Ödipus jammert rum. Theseus kommt, der König von Athen, und behält den alten Mann erst mal als Gast. Weil er selber mal verbannt war und weiß wie man sich da fühlt.
Nebenbei: Theseus war lange bei den Griechen so gut wie nicht beachtet worden. Er wurde unter der Tyrannenherrschaft von Peisistratos und seiner Söhne im 6.ten vorchristlichen Jahrhundert zum Nationalhelden erst aufgebaut. Dazu bediente man sich einer anonymen Dichtung, die schlicht zum Epos ausgebaut wurde. Das zeigt ein weiteres Mal genau an, wie stark Dichtung in die sozialen und historischen Zwänge eingebunden ist. Dabei ist es wiederum anachronistisch faszinierend, dass die Muster dieser Dichtungen tiefer liegen und dadurch auch in sozial und historisch unterschiedlichen Epochen überleben bzw. ihre je eigene Rolle spielen.
Dann kommt Kreon, der König von Theben und meint, Ödipus könne wieder nach Theben zurück. Aber Ödipus bleibt lieber in Athen, weil es eine schlechte Weissagung gibt, sollte er nach Theben zurückkehren. Wie gesagt, Ödipus hat ja immer noch keine Ahnung und glaubt das Orakel verhindern zu können, das längst eingetreten ist. Es kommen nun auch die Söhne von Ödipus, und meinen sie könnten für ihn Theben erobern. Aber Ödipus verflucht die beiden und sagt ihnen, sie würden sich gegenseitig meucheln. Seine Söhne waren nie für ihn da, im Gegensatz zu seinen Töchtern. Auch ein interessanter Zug bei Ödipus, dass er seine Töchter viel, viel lieber hat, als seine Söhne. Die beiden Söhne von Ödipus machen sich aus dem Staub. Der alte Ödipus sucht sich nun ein Versteck wo er dann in Ruhe sterben wird, so dass seine Töchter ihn nicht finden und am Ende aus Gram ihm nachfolgen. Tja und dann kommt ja das Drama um Antigone. Ödipus auf Kolonos - dieses Mittelstück der Trilogie von Sophokles -wurde erst posthum aufgeführt. Aber man kann mit jedem Recht sagen, dass diese Trilogie einen enormen Einfluss auf die gesamte europäische Literatur hatte. Immerhin hatte man schon zurzeit von Aischylos und Sophokles den thebanischen Sagenkreis in schriftlicher Form vorliegen. Vermutlich hat ihn der Dichter Antimachos aus Theos um 750 v. Chr. aufgeschrieben und damit in Grundzügen festgelegt. Wir halten uns natürlich an die Ausformulierungen von Sophokles und lange an die Interpretationen von Aristoteles.
Der Tod der Tragödie
Euripides ist von der Sophistik und vom Zweifel an allem Götterglauben erfaßt - Grundwissen deutsche Literatur, Ernst Klett 1981
Euripides, der jüngste der drei großen Tragödiendichter, ist 480 v. Chr. auf der Insel Salamis geboren worden. Seine Eltern mussten wohl im Rahmen der Perserkriege 480 aus Athen fliehen. Angeblich ist Euripides immer wieder nach Salamis gefahren und hat sich dort in seiner Höhle zurückgezogen. Diese Höhle des Euripides wurde 1997 von Archäologen entdeckt. Sie liegt im Süden der Insel. Die Archäologen fanden eine Trinkschale aus dem Jahr 430 mit dem Namen des Dichters. So ist es naheliegend, dass Euripides dort seine Dramen schrieb, oder einen Teil von ihnen. Euripides war zudem Fackelträger bei den Riten um den Gott Apollon Zoster (das hat ihm Nietzsche angekreidet). Und er soll Anaxagoras und Protagoras gekannt haben. Im Jahr 441 hat er erstmals die Dionysien gewonnen mit dem Stück „Der bekränzte Hippolytos“. Hippolytos ist der Sohn von Theseus und verehrt Artemis, die Göttin der Jagd. Das macht Aphrodite eifersüchtig und neidisch. Sie übt fiese Rache indem sie Phaidra, die Stiefmutter von Hippolytos verzaubert. Diese verliebt sich in ihren Stiefsohn. Der weist ihr Liebeswerben schockiert ab, worauf sich Phaidra umbringt. Aber – typisch Stiefmutter – sie hinterlässt einen Abschiedsbrief, indem sie behauptet Hippolytos habe ihr nachgestellt. Das macht Theseus super wütend und er verflucht seinen eigenen Sohn bei Poseidon. Der Meeresgott schickt ein Ungeheuer und das erschrickt das Pferd von Hippolytes, der beinahe zu Tode getrampelt wird. Während dieser Ereignisse taucht Artemis auf und klärt Theseus auf, wie es wirklich war mit seiner Frau und seinem Sohn. Theseus verzeiht seinem Sohn Hippolytos, der aber kurz darauf verstirbt. Hier sieht man schon die ambivalente Rolle des attischen Nationalhelden Theseus aufblitzen. Eine Art Verfall, eine Art Dekadenz zeigt sich darin.
Euripides war übrigens auch mit Sokrates befreundet. Und Sokrates ging immer zu den
Veranstaltungen des Euripides, obwohl er kein Freund von solchen Aufführungen war. Sokrates ist auch bei vielen anderen Denkern eine zentrale Schnittstelle. Zum Beispiel Karl Jaspers sah in
Sokrates einen Protagonisten seiner Achsenzeit und den Beginn der eigentlichen Philosophie. Euripides starb 406 in Pella, der damaligen Hauptstadt von Makedonien. Der Sage nach wurde er irgendwo bei
Thessaloniki von wilden Hunden zerrissen, womit man wohl liebevoll umschreiben wollte, dass in seinen Stücken die dionysische Ekstase eine Rolle spielte.
Berühmt ist sicher sein letztes Stück, die Iphigenie in Aulis, das er 406 noch vor seinem Tode verfasste und von seinem Sohn Euripides dem Jüngeren 405 v. Chr. an den Dionysien aufgeführt
wurde.
Agamemnon ist gerade mit seinen Soldaten auf den Weg nach Troja, als eine Windflaute ihn in Aulis festhält. Aulis in Böotien ist ein Kultort für Artemis. So kann es nur weitergehen mit der fröhlichen Schifferlfahrt der griechischen Soldateska, wenn Agamemnon seine eigene Tochter Iphigenie an die Götter opfert. Iphigenie ist ohnehin grade unterwegs nach Aulis, um dort Achilles zu heiraten. Agamemnon schickt ihr einen Brief um sie zu warnen, den fängt nun sein Bruder Menelaos ab und stellt Agamemnon zur Rede. „Du Hund, wegen eines Weibes willst du die Ehre Griechenlands gefährden?“ Ein Bote meldet nun, dass Iphigenie grade mit ihrer Mama (Klytemnestra) und ihrem Bruder (Orestes) in Aulis eingetroffen ist. Plötzlich hat nun Menelaos Mitleid und will das Opfer verhindern, aber Agamemnon ist nun entschlossen, das Opfer durchzuführen. Brüder! Es wundert einen gar nicht, wo Kain und Abel diese Scheiße herhaben. Iphigenie freut sich derweil total, ihren Papa wieder zu sehen. Agamemnon und Iphigenie umarmen sich herzlich. Die Mama von Iphigenie, die Klytemnestra ist mit dem Bräutigam Achilles allein und erzählt dem Helden, dass sie von einem Diener erfahren hat, dass die ganze Hochzeit ein Fake ist, nur eine List, um Iphigenie nach Aulis zu locken, wo sie eben geopfert werden soll. Das macht den jungen Helden Achilles stinksauer und er will Iphigenie retten. Jetzt streiten sich Achilles und Agamemnon. Iphigenie beschließt dann – ganz treudoofe Frau – sich für Griechenland zu opfern. Sie wird als Opfer geschmückt und geweiht. Ganz zum Schluss kommt die Überraschung. Ein Bote bringt die Nachricht, dass Artemis das Opfer persönlich verhindert hat und stattdessen eine Hirschkuh geschlachtet wurde. Dieses Happy-End mit Hilfe deus ex machina hat noch Friedrich Nietzsche zornig gemacht und er dachte, das sei eine elende Verschwörung zwischen Sokrates und Euripides wider dem tragischen Geist der Griechen. Wie? Die Götter richten nur und belohnen nie? Und so setzte er an dieser Stelle eine Zäsur in der Zeit. Mit Euripides und Sokrates wurde Dionysos verraten zugunsten des vernünftelnden und herzensguten Hirtengott Apollon. So macht es durchaus auch Sinn, wenn man weiß, dass Euripides der Fackelträger der Feste für Apollon war. Dass er von Hunden zerrissen wurde ist dann eher als Rache des Weingottes zu sehen.
Goethe machte aus Aulis Tauris, also aus dem Land in Böotien wurde die Krim. Und aus der glücklich geretteten opferbereiten Iphigenie machte Goethe ein Ideal aus Pflicht und Neigung. Und Iphigenie löst bei Goethe den Konflikt selbstständig, braucht also kein deus ex machina. Aber allein ist es zu erwähnen, dass an der Schwelle zum bürgerlichen Drama Goethe die Antike noch einmal hochkarätig beschwor.
Aischylos, Sophokles und Euripides haben das Drama 2000 Jahre lang bestimmt. Erst mit dem bürgerlichen Drama im 18. Jahrhundert, mit den Dramentheorien des Diderot, oder Lessing, hat sich alles geändert.
Übrig blieb im Grunde nur noch die Idee der Darstellung.
Über Nietzsche in Assoziationen mit Nietzsche denken
Nietzsche, dieser Mann mit dem beeindruckenden Schnauzer kam 1844 in Röcken zur Welt. Dieser kleine Stadtteil der Stadt Lützen liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Der heutigen Hochburg der neuen Rechten. Nietzsche war ein berühmter Philologe und Philosoph und starb relativ früh zwei Monate vor seinem 56. Geburtstag im August in Weimar. Er war da schon ein seit über zwanzig Jahren pensionierter Professor. Dieser kränkliche und an einer degenerativen Erbkrankheit (CADASIL, eine Häufung von Schlaganfällen in bereits jungen Jahren) leidende Mann schuf die Lehre vom Übermenschen.
In Friedrich Nietzsche haben wir einen Vertreter jener spätbürgerlichen Pseudodominanz, die Thomas Mann in seinen Buddenbrooks untergehen ließ. Einerseits Leidensgröße und Todessehnsucht, andererseits Leistungsstärke und Unempfindlichkeit im Leiden. Diese Gegensätze beschrieb Thomas Mann in seinen Literaturen und sein Vorbild in der Hinsicht war - neben Wagners Leitmotivik und Schopenhauers Wille - Friedrich Nietzsches Gegensatzpaar Apollo und Dionysos. Apollo, der gute Hirtengott des goldenen Zeitalters, die schöne, strenge Form einer geordneten und geruhsamen immer gleichen Welt. Dionysos dagegen, immer wieder gebiert er sich neu aus seiner Asche, ist wild, rauschhaft und nicht zu bändigen, bis er wieder in Form gepresst wird und zugrunde geht, weil er eben nur in seiner formlosen Wildheit ganz existieren kann. Und immer wieder wird Apollo selbst diesen wilden Dionysos erschaffen, immer wieder wird die Form selbst sich zerstören, weil sie erstarrt und brüchig wird.
Nietzsche forderte einerseits das erfolgreiche und starke frühbürgerliche Prinzip der
unbedingten Autorität zurück. Eine Art natürlicher Aristokratie, nicht wie im Barock blutleer und verweiblicht, sondern erstarkt wie sie sich Machiavelli wünschte und schon nicht mehr hatte. Doch
andererseits waren Nietzsches Helden (Alkibiades, Napoleon, Friedrich II.) Leidende in ihrer Größe, wurden sie doch alle vom Kleinen besiegt. Die Eroberer die dann im 20. Jahrhundert kamen und den
ganzen Mist wegbombten, waren schon Parodie auf diese Leistungs- und Leidensgrößen. Übrig blieben nach zwei verheerenden und kurz aufeinander folgenden Weltkriegen nur noch die „Mißratenen“, die
kleinen Würschtel wie wir übrig. Heute lässt sich mit Nietzsche eine traurige Feststellung machen. Selbst die größten Herrscher sind nur kleine Würschtel. Den ersten und den zweiten Weltkrieg haben
nur die Würschtel überlebt. Und wir werden noch einige Generationen brauchen, damit es wieder einen Herrscher gibt, der in seiner Leidens- und Leistungsgröße dem Ideal Nietzsches nahekommt.
Vielleicht aber hat es diesen Herrscher noch nie gegeben! Das halte ich sogar für wahrscheinlicher. Doch wenn alle Menschen Würschtel sind, was dann? Sollen die Tiere herrschen? Oder kommen die
Außerirdischen?
Unsere aktuellen Herrscher sind Imitate, Witzfiguren. Aber sie sind so sehr von ihrer eigenen Größe überzeugt, dass sie die nietzscheanischen Tugenden scheinbar verkörpern. Stolz, Pathos der
Distanz, große Verantwortung, Übermut, prachtvolle Animalität, kriegerische und eroberungslustige Instinkte, Vergöttlichung der Leidenschaft, der Rache, der List, des Zorns, der Wollust, des
Abenteuers, der Erkenntnis. All diese Tugenden werden von den Putins und Trumps dieser Welt imitiert und parodiert und sogar pervertiert.
Nietzsches Anliegen wird wohl erst verständlich, wenn man sich auch mit kleineren Details der Geschichte beschäftigt und sie beispielhaft in Anschauung nimmt. So werden die philologischen Kernelemente der nietzscheanischen Hypertrophie ein wenig schärfer und weniger monströs.
In der Querelle des Anciens et des Modernes begegnen wir einer Auseinandersetzung Ende des 17. Jahrhunderts in Frankreich, noch unter Ludwig XIV.. Dort dichtete der französische Märchenonkel Charles Perrault ein Lobgedicht auf die Genesung von seinem König Ludwig XIV..
Doch nie, glaubte ich, Anbetung. / Ich sehe die Menschen der Antike, ohne die Knie zu beugen, / Sie sind groß, das ist wahr, doch Menschen wie wir; / Und man kann den Vergleich anstellen, ohne ungerecht zu sein, / Zwischen dem Zeitalter von LOUIS und dem schönen des Augustus
Diese Parallele von Kunst und Wissenschaft zwischen der Moderne und der Antike gipfelte darin, dass Perrault den französischen König über Augustus stellte, weil die moderne Welt leistungsfähiger sei. Ein König, der sich schon damals von seiner Mätresse (Marquise de Maintenon) an der Nase herumführen ließ, sollte größer sein als der römische Kaiser Augustus? Lächerlich. Dagegen erhoben sich einige Stimmen. Nun, Perrault war Jurist, Sohn eines Juristen als Beamter eingesetzt, er war ein Rotüre, ein Bürger und kein Adeliger. Es war aber eine sehr wohlhabende Familie der Perrault entsprang. Schon früh machte sich Perrault über antike Vorbilder respektlos lustig. Sein Gegenspieler war Nicolas Boileau, ebenfalls gelernter Jurist, aber sein Vater war noch stolz auf seine adlige Herkunft. Boileau verehrte die antiken Klassiker wie Horaz oder Pseudo-Longinus, den er selbst übersetzte. Diese beiden durchaus dem König treuen Literaten gerieten in Streit, weil Perrault mit seinem Lob der Moderne die formale Verwilderung der Literatur lobte (also Dionysos), die Boileau wiederum kritisierte. Der Streit schuf dann zwei Lager, die Alten und die Neuen. Die Alten waren für Nachahmung, dem aristotelischen Grundprinzip der Mimesis. Nur durch Nachahmung kann man sich überhaupt literarisch entwickeln, indem man eben seine Vorgänger studiert und sich am Ideal der Antike orientiert.
Die Neuen, die Modernen bevorzugten das Genie, also eine Art Literatur, die sich von den antiken Vorbildern befreien kann, weil eben die Moderne besser, reicher, vielfältiger als die Alten ist. Wirklich beendet wurde der Konflikt nicht. Er erschöpfte sich nur an der von Kardinal Richelieu begründeten französischen Akademie, wo der Streit ausgetragen wurde und am 30. August 1694 mit einer öffentlichen Umarmung von Boileau und Perrault vorläufig endete.
Ein paar Jahrzehnte später flammte der Konflikt wieder auf mit einer anstößigen Übersetzung der Ilias von Homer durch de La Motte (Querelle Homer genannt), einem der Günstlinge am Privathof von Madame du Maine. Fenelon, der Autor der Abenteuer des Telemach, mischte sich ein und auch dieser Konflikt ebbte wieder ab. Aber die Auseinandersetzung ging tief in die DNA der französischen Literatur ein, begleitete die Aufklärung und hatte auch international Auswirkungen, bis zu Deutschlands Sprachenstreit zwischen Gottsched und Bodmer. Dort vertrat Gottsched den klassischen Ansatz, einer grammatischen Festlegung, während Bodmer den natürlichen Ansatz verfolgte, dass Sprache frei sich aus dem Dialekt entwickeln solle. Der siebenjährige Krieg beendete den Streit mehr oder weniger und es setzte sich Gottscheds Grammatik durch. Doch ist das so? Die Regulierung von Sprache ist ja auch heute wieder ein großer Streitpunkt unter den Politiker:Innen.
Nun was hat das mit Nietzsche zu tun? Nietzsche hat sich nie direkt zu diesen berühmten
Querelen aus der Zeit des Ancien Regime geäußert. Aber Nietzsche war ein Philologe, und das war er in seiner Gelehrtenstube mit Haut und Haaren. Er geriet in fremdes Gewässer, weil die
Philologie einmal eine Kardinalswissenschaft war. Heute ist es das nicht mehr. Zu Nietzsches Zeiten schaffte es ein Streit zweier Philologen um die Vergabe einer Professur in die Hohe Politik und es
musste sich seinerzeit sogar Otto Bismark darum kümmern. Bekannt ist das historisch als der Bonner Philologenstreit zwischen Friedrich Ritschl (dem Mentor von Nietzsche) und Otto Jahn. Also
Nietzsches Philosophie ist nicht ohne Philologie zu haben. Das übersteigt viele Rezipientin der heutigen Zeit, da sie weder fähig noch willens sind, die antiken Originale zu lesen, wie das Friedrich
Nietzsche noch machte. Und nur so kann ein Alkibiades am Horizont der klassischen Moderne auftauchen, kann altes, antikes Gehölz wie Schwemmgut, Treibholz in den Jahrhundertwechsel hinein poltern und
Heraklits Vater aller Dinge das Kriegs- und Literaturgebrüll für mehrere Jahrzehnte bestimmen. Denn um 1890 begann Nietzsche Kult zu werden. Er selbst war bereits umnachtet in dieser Zeit,
als die Kunstwarte eine überästhetische, formal zugespitzte geistige Schönheitshöhe verlangte. Nietzsches Vermächtnis waren die Werte und Gedanken der Alten in eine Zeit zu transformieren, wo
das Neue und die Neuen wie eine Horde wildgewordener Verrückter explodierten, also die Industrialisierung Telefone, Eisenbahnen, Autos und Flugzeuge schuf, Geschwindigkeiten erreichte, die jedem
Alten davonliefen. Da saß der einsame Philologe ängstlich in seiner Gelehrtenstube und beschwor den antiken Geist wie eine Katharsis herauf. Nicht immer ganz zu Unrecht geißelte Nietzsche die
Sklavenmoral des platonisch-christlichen Wertekanons, die demütige Unterwürfigkeit gegenüber einem rein erfundenen Gott und seinen Elogen. Alle diese verlogenen Religionen im Grunde, legten es darauf
an, den Menschen zu unterdrücken, zu disziplinieren und damit zu verkrüppeln, ihn am Fortschreiten zu hindern, klein zu halten. Nietzsche ist ein Vorläufer von Michel Foucault, der feststellte, wie
sehr die Aufklärung durch Schule und Militär Körper und Geist der Menschen trainierte und durch Folter gefügig machte, bis jeder selbst daran glaubte, so müsse es sein. Und nur noch Massenmenschen
wie traurige Lemuren halb durchsichtig durch die Straßen geistern. Heute ist das nicht mehr verständlich, was Nietzsche dachte, weil die Stoffe aus denen sein Geist sich nährte kaum noch gelesen
respektive wirklich verstanden werden – es gibt nur noch wenige Philologen im Sinne einer Kardinalwissenschaft, nur noch Teilphilogien die sich zu Orchideenfächern zerstückelt haben. Das zeigt
sich auch in der Bildungskrise. Die moderne Bildung des 21. Jahrhunderts leugnet den Fortschritt, hat kein Ziel vor Augen und bildet Lakaien aus für eine degenerierte geistlose und weitestgehend
unfähige Demokratie. Die Schüler und Studenten passen sich ein in die Horde der Zombies, die so weitermachen wie die Zombies vor ihnen.
Das Natürliche, das wilde, schöne Tier, einen Tiger zum Beispiel, einzusperren in ein formales Konzept heißt auch, die Wahrheit, die Wirklichkeit, das eigentlich Echte zu zerstören. Sowohl Nietzsche
als auch die "Modernes" der Querelle kritisierten traditionelle Werte und Normen. Während die "Modernes" die Idee unterstützten, dass die moderne Kultur und Literatur genauso wertvoll sei wie die
Antike, kritisierte Nietzsche die christliche Ethik und die metaphysischen Annahmen des Abendlandes. Nietzsche verabscheute John Stuart Mills: „Ich perhorresziere seine Gemeinheit, welche sagt:
`was dem einen recht ist, ist dem andern billig; was du nicht willst usw., das füg auch keinem andern zu‘, welche den ganzen menschlichen Verkehr auf Gegenseitigkeit der Leistung begründen will, so
daß jede Handlung als eine Art Abzahlung erscheint für etwas, das uns erwiesen ist. Hier ist die Voraussetzung unvornehm im untersten sinne: hier wird die Äquivalenz der Werte von Handlungen
vorausgesetzt bei mir und dir.“
Nietzsche sieht äußerst hellsichtig einen Zusammenhang zwischen der goldenen Regel der Christenheit und dem kaufmännischen Kleingeist des englischen Libertins. Heute haben wir nur noch Heilige,
die nicht stehlen und morden, weil sie die Polizei fürchten.
Die "Modernes" betonten den Fortschritt und die Entwicklung der Kultur über die Zeit. Ähnlich betonte Nietzsche die Idee des "Übermenschen" und den Fortschritt der Menschheit jenseits traditioneller
moralischer und metaphysischer Konzepte.
Sowohl Nietzsche als auch die "Modernes" akzentuierten die Bedeutung der individuellen Freiheit und Kreativität in Kunst, Literatur und Philosophie. Nietzsche setzte sich stark für die
Selbstverwirklichung des Einzelnen ein und unterstrich die Rolle des Schöpfers und Künstlers in der Kultur.
Sowohl Nietzsche als auch die "Modernes" schätzten die griechische Kultur und Philosophie hoch ein. Die "Anciens" der Querelle betrachteten die Antike als Maßstab für kulturelle und intellektuelle
Exzellenz, während Nietzsche die griechische Philosophie als eine Quelle der Inspiration für seine eigenen Ideen betrachtete.
Damit gab es einen sehr nachhaltigen Zusammenhang zwischen diesem Kulturstreit am Rande des
Zusammenbruchs des französischen Feudalsystems und Nietzsches aristokratischen Anarchismus.
Nietzsche in seiner verstaubten Gelehrtenbude sitzend, tief eingegraben in alten Büchern, und über ihn hinweg rast die Zeit, donnert der große Krieg mit seinen eisernen Panzern und seinem Giftgas
voraus, so dass Nietzsches Schmiss über seiner Nase jucken musste. Vieles ist so eingetroffen, wie es Nietzsche sah. Und vieles was so eintraf hätten wir gerne nie erlebt. Dieser Machiavelli der
klassischen Moderne ist der Renaissance seines Vorgängers längst entflohen und ist mit seiner Prätention insofern ein Ungeheuer, weil er uns immer wieder aufs Neue darlegt, dass wir politisch und
soziologisch ein oder zwei Jahrhunderte hinter der technischen Entwicklung her laufen. Der Mensch wird so zum Monster, weil er nicht mehr versteht, was er tut. Das ist Nietzsches Warnung im
Zarathustra und hier bedarf es immer wieder der dionysischen Reinigung, einer Art moralischer Barbarei, um uns wieder an die Technik heranzuführen.
Wovon können wir sprechen?
Dass wir mehr wissen können, als wir sagen wollen, diese Tatsache scheint offensichtlich genug. Aber es ist nicht einfach, genau zu sagen, was es bedeutet. Nehmen Sie ein Beispiel. Wir kennen das Gesicht eines Menschen und können es unter Tausenden, ja sogar unter einer Million erkennen. Dennoch können wir normalerweise nicht sagen, woran wir ein uns bekanntes Gesicht erkennen. Der größte Teil dieses Wissens lässt sich also nicht in Worte fassen.
So schrieb es der österreichisch-ungarische Chemiker und Philosoph Michael Polanyi (1891-1976) in seinem Buch The Tacit Dimension. Unsere Sprache scheint also oft unzureichend für die Repräsentation der sinnlich erfahrbaren Welt. Die alten Griechen nannten das egestas verborum. Diese „Armut der Sprache“, ein Stoßseufzer Ciceros, hat als Gegengewicht einen Exzess von Sprache der jenseits allen sinnlich wahrnehmbaren Erscheinens im Wesentlichen aber unsere Welt durchformt.
Durchsucht man kulturelle Symbolsysteme, kommt man aktuell kaum an der Erzähltheorie des 1922
in St. Petersburg geborenen und 1993 in Estland verstorbenen Literaturtheoretikers Juri Lotmann vorbei. Denn Lotmanns Theorie kann uns erklären, warum wir einerseits mit der Ausdruckskraft von
Sprache hadern, weil sie uns ungenügend erscheint und andererseits geradezu explosiv mit Sprache umgehen, dass sie uns inflationär erscheint und in ihrer Vielfalt nicht mehr oder fast nicht mehr zu
organisieren.
Man kann Lotmanns Erzähltheorie in vier wichtige Grundideen einteilen und sich auf diese Art in Lotmanns semiotischen Kosmos orientieren.
Lotmanns Semiosphäre
Nach dem Schweizer Sprachwissenschaftler Ferdinand Saussure (1857-1913) ist Sprache ein System von Zeichen, die sich aufeinander beziehen, während aber das Sprechen sich zum System verhält wie der Inhalt zum Trinkglas, wobei das Trinkglas das System ist (die Form) und der Inhalt eben im Sprechen (von Saussure parole genannt, während er das System langue nannte) sich zeigt. Die Semiosphäre ist bei Juri Lotmann eine Art umfassender Zeichenkörper, der mehrere solcher Sprachsysteme umfasst und jeweils einen Kern und eine Peripherie aufweist. Lotmann entfernte sich von den eher klassischen Raumkonzepten eines Behältnisraumes (Strömungen, Wellen, Ladungen) hin zu einer Schwellentheorie der Falten, Kerben, Furchen oder Raster. Am Rand dieses von Lotmann konzipierten Zeichenkörpers lösen sich die im Kern hegemonialen Deutungen und Bedeutungen der Zeichen mehr und mehr auf und transformieren in die nächste Sphäre. Die Schnittmengen in den sich kreuzenden Sphären liegen daher in der Peripherie und bilden im Grunde die eigentliche Sprache und Sprachtransformation ab, die den Kern füttert, der dann seinerseits verhärtet und sich hegemonial gebärdet.
Doppelcodes
Lotmann geht von einem anderen Kommunikationsmodell aus, das nicht auf der üblichen Ansicht beruht, dass ein Sender seine Nachricht codiert und der Empfänger diese wiederum decodiert. Denn hier könnte man tatsächlich von einer bloßen Illusion identischer Codes für Sender und Empfänger sprechen. Moderne Gesellschaften haben Individuen ausgebildet deren sprechender Zugang zu den Sprachsystemen von existenzieller Einzigartigkeit geprägt ist. Man könnte – etwas plakativ – sagen, niemand spricht so, wie es das Sprachsystem vorgibt. Diejenigen, die Informationen austauschen, verwenden – nach Lotmann – daher keinen gemeinsamen Code, sondern zwei verschiedene Codes, die sich teilweise überschneiden. Der kommunikative Akt ist so keine passive Übermittlung von Informationen, sondern eine Übersetzung, eine Neukodierung der Nachricht. Es gibt damit keine klaren Grenzen mehr. Es gibt auch keine Sicherheit, ob man den Sender überhaupt verstanden hat, oder die in seinem Sinne codierte Nachricht vom Empfänger auf einer völlig anderen Sinnebene decodiert wird und ein damit völlig anderer Sinn herauskommt. Diese Idee von Kommunikation – die tatsächlich der Wahrheit sehr nahe kommt – macht unsere Welt der Zeichen zu einer kafkaesken Kuriosität. Eine sinnlose Nachricht für den Empfänger bedeutet nicht, dass sie für den Sender sinnlos war. Andererseits kann eine Nachricht für einen Empfänger plötzlich Sinn ergeben, obwohl der Sender sie ausdrücklich sinnlos codierte. Es ist also mehr als nur eine Unsicherheit zwischen Information und Rauschen – wie das Albrecht Koschorke in seinem Buch Wahrheit und Erfindung einordnete -, sondern viel dramatischer und kurioser. Nun haben wir diese Semiosphären an der Peripherie und dort treffen unterschiedliche Codes aufeinander und es kommt zu ständigen, neuen Transformationen. Diese Wirbel, sprachliche Wirbelwinde, füttern den Kern von Kulturen die sich dann in festen Institutionen wie zum Beispiel Verlagen, Fernsehsendern, Zeitungen, sozialen Medien (Tik-Tok, Youtube, etc.) Infrastrukturen der Macht aufbauen, deren Zweck gar nicht Literatur bzw. Informationsvermittlung, Wissensvermittlung etc. ist, sondern ökonomischer Erfolg. Innerhalb dieser sprachsystematisch als Ökonomie bezeichneten gemeinsamen Klammer gibt es wiederum die Spaltung von Kern und Peripherie. Nicht jeder Beitrag in youtube ist kommerziell orientiert (nur die Plattform ist es), ebenso sind Autoren, die Bücher in kommerziell orientierten Verlagen veröffentlichen nicht automatisch selbst kommerziell orientiert. Nur gestalten diese Institutionen im Kern das Sprachsystem innerhalb dessen sich das Sprechen individuell transformieren will.
Es ist unter diesen grausigen Bedingungen ein regelrechtes Wunder, dass es überhaupt tolle Bücher, Romane, Gedichte gibt. Wenn es nicht am Ende sogar ein Missverständnis ist.
Bildung und Zerfall von Kodes
Nach Lotmanns Erzähltheorie bauen sich permanent Kodierungen auf und ab. Bildung und Zerfall von Deutung und Bedeutung machen die Kommunikation aus. Es wäre unmöglich zu kommunizieren, wenn diese beiden miteinander opponierenden Zustände nicht mehr wären. Für die Kommunikation zwischen Menschen in ihren Zeichensphären ist es zwingend, dass Bildung und Zerfall dieser Kodes gleichzeitig existieren. Das heißt, dass nur dann Verstehen entsteht, wenn gleichzeitig Unverständnis koexistiert. Individuelle Abweichungen innerhalb des großen Zeichenkörpers in dem wir Menschen leben sind für eine semiotische Varietät nötig und diese Vielfalt wiederum ist nötig um die- ganz am Anfang erwähnte- egestas verborum (Armut der Sprache) auszugleichen. Ohne die Vielfalt durch Sinnverwirrung und so erforderliche Sinngestaltung, wäre unsere Welt völlig unzureichend beschrieben und völlig lächerlich in den Semiosphären repräsentiert. Unsere Welt wäre als sinnliche Repräsentation nicht über ein paar grobe Striche hinausgekommen.
Resümee
Differenz von Kern und Peripherie, zwei unterschiedliche Codes von Sender und Empfänger, sowie Stimmengewirr und Unordnung die daraus resultiert, ergeben zusammen den vierten Punkt, der Lotmanns Erzähltheorie so spannend und aktuell macht. Denn Ideologien operieren vom Kern aus, als ein dichtes Medium das die Zeichen nicht einfach durchleitet, sondern auf die Übermittlung einwirkt, sie nach den eigenen Ansprüchen von Macht verändert. Vereinfacht gesagt: Zeitungen haben eine Redaktion, Verlage ein Lektorat, Fernsehsender ein Programm und so weiter.
Diese Machtgebilde sind anisotrope Räume. Damit meint Lotmann, dass ihre Ausbreitung nicht gleichförmig und wie die Sonne auf alle strahlt. Ideologische Machtzentren die sich über die dichten Medien als eigener Code verbreiten, verbreiten sich eben uneindeutig und keineswegs immer so steuerbar, wie die Ideologen selbst gerne glauben bzw. sich einbilden. Schon allein durch die Medienvielfalt entstehen kulturelle Räume und permanente Transformationen des Sprechens, dass aufgrund des Stimmengewirrs an der Peripherie Nachrichten vom Kern auf eine Art und Weise decodiert werden, die nie so beabsichtigt waren und strahlen dann zurück auf den Kern. In diesem Chaos entwickeln sich Erzählungen ohne Sinn zu höchster Sinnhaftigkeit und andersrum. Beziehungsweis ist der Sinn jeder Erzählung auf eine Art fragil, dass man sich wundert, dass sie formal nicht völlig enthauptet werden. So würde ich mit Lotmann weiter denken: Selbst das Sinnlose hat einen semiosphärischen Kern des Sinns und jeder Sinn kann sich in der semiosphärischen Peripherie auflösen oder zu einem ganz neuen Sinn transformieren oder völlig sinnlos werden. Dass sich Sprechen zu einem Sprachsystem verhärtet, das dann das weitere Sprechen dominiert, steht immer in Konkurrenz zu einem Sprechen, das sich vom dominanten Sprachsystem emanzipieren will. Die Grenzen verlaufen also nicht zwischen konservativ und progressiv, oder rechts und links, oder identisch versus alternativ. Diese politische Landkarte, die wir heute immer noch vorfinden, ist ein kurioser Anachronismus und längst hat sich das Sprechen der Meisten aus diesen alten Systemen gelöst. Es ist, wie Günter Anders es schon sagte, der Mensch ein antiquiertes Wesen. Und es geht sogar so weit, dass wir oft schon modern sprechen während wir noch altmodisch denken. Tatsächlich ist unser eigenes Sprechen (parole) in dauernder Spannung zwischen Anpassung an das Sprachsystem (langue) und Emanzipation bzw. inneren Widerspruch zum Sprachsystem. Denn wir unterscheiden uns als Menschen so sehr, wie wir uns ähneln.
Vier Texte zum Geburtstagskind des Jahres Immanuel Kant
Urteile nicht!
(Das Bild von Friedrich Hagemann zeigt den Philosophen Kant beim Anrühren von Senf)
Was man so alles bedenken sollte, wenn man denkt, damit man sich nicht alles nur ausgedacht hat was man dachte.
Bei Kant – der Ursache vieler Kopfgeschwüre – ist ein analytisches Urteil a priori zum Beispiel der Satz: Der Schimmel ist weiß. Da die Qualität „weiß“ eben schon im Wort „Schimmel“ enthalten ist. Dem Schimmel wird so nichts hinzugefügt und es ist pure Anschauung – also a priori – da ich – so meine Augen funktionieren – dieses weiß unmittelbar sehe. Ein synthetisches Urteil ist dagegen was anderes. Der Schimmel ist drei Jahre alt. Dies setzt eine Bekanntschaft mit einem bestimmten Schimmel voraus und damit ist es nicht mehr a priori, sondern a posteriori, also im Nachhinein (nach der besonderen Bekanntschaft mit dem Schimmel) als zusätzliches Prädikat erkannt worden. Kant ist der Meinung, dass nur solche Urteile den Namen Wissenschaft verdienen. Was ist nun ein synthetisches Urteil a priori? Also eine unmittelbare Erkenntnis von einem zusätzlichen Prädikat? Die Rechenoperation 5+7= 12. Sowohl die 5, als auch die 7 sind analytisch in der Anschauung der Zeit. Also ich sehe unmittelbar 5 Äpfel in der Schale liegen. Das ist bei klarem Verstand nicht zu bezweifeln und aus der unmittelbaren Anschauung gewonnen. Ebenso bei 7 Äpfeln. Aber wenn ich nun 5 Äpfel aus der Schale nehme und sie in die Schale mit den 7 Äpfeln lege, werden daraus 12 Äpfel. Diese 12 Äpfel sehe ich nun und damit ist das ein analytisches Urteil. Aber da ich zuvor eine Operation durchführte und die 5 zur 7 hinzuaddierte, wird die 12 eben synthetisch und das aufgrund meiner Anschauung. Damit habe ich Wissen geschafft. Das ist das Experiment mit dessen Hilfe ich reine Anschauung hervorgerufen habe, durch Synthese. Zucker ist süß. Kaffee ist bitter. Das sind analytische Erkenntnisse a priori. Wenn ich nun den Zucker mit dem Kaffee verrühre, wird der Kaffee süß und das ist eine analytische Erkenntnis a priori. Aber da ich Zucker und Kaffee durch eine Operation zusammenfügte, ist es ein synthetisches Urteil a priori. Die gewonnene Erkenntnis ist nun qua Vernunft die, dass der Zucker den Kaffee süß macht. Kant stellt die Bedingung auf, dass die Metaphysik (Wissen über die letzten Gründe des Seins) nur dann zu sicheren neuen Erkenntnissen gelangen könne, wenn sich auch hier synthetische Urteile a priori fänden. Erst dann haben sie den Status einer Wissenschaft. Wenn ich eine Gotteserscheinung habe, dann liegt entweder ein analytisches Urteil a priori vor oder ich habe eine Augenkrankheit. Mit welchem Experiment könnte man eine Gotteserscheinung hervorrufen?
Ganz einfach. LSD verändert die Sinneswahrnehmung. Gott kann man nur mit veränderten
(verbesserten?) Sinnen sehen. Nimmt man LSD sieht man Gott. Das Problem ist nicht die Synthese. Das Problem ist die Analyse. Kants transzendentale Dialektik zeigt auf, dass die Gotteserscheinung
selbst nur Schein ist und kein Sein. Und zwar aus der Logik heraus. Jemand mag eine Erscheinung haben und spricht dieser dann den Begriff Gott zu. Kant beweist, dass hier bereits die Existenz Gottes
vorausgesetzt wird. Schließlich könnte diese Erscheinung unter Einfluss von LSD alles Mögliche sein. Wer sagt denn, dass es Gott ist. Es könnte auch der Teufel sein, oder ein Außerirdischer, oder
eine Luftzirkulation? Kaffee existiert physikalisch und Zucker auch. Die neue Qualität des Kaffees durch Hinzufügen von Zucker ist a priori physikalisch. Die neue Qualität meiner Sinneswahrnehmung
durch LSD ist ebenfalls physikalisch. Aber nicht die Interpretation der Qualität. Gesüßter Kaffee schmeckt mir nicht. Dies ist kein analytisches Urteil, sondern ein ästhetisches Urteil.
Ästhetische Urteile beurteilen den Wert und nicht die Qualität und sind damit ein Vorurteil das ich im Bezug meines Selbst auf ein Ganzes stelle. Die Qualität wird durch den relationalen (eine
Beziehung darstellenden) Bezug auf mich zu einem Wert. Denn anderen schmeckt gesüßter Kaffee. Wer also apodiktisch behaupten wolle gesüßter Kaffee schmeckt nicht, der verwechselt Anschauung mit
Meinung. Im Falle eines Gottesurteils liegt noch nicht einmal ein ästhetisches Urteil geschweige denn ein analytisches Urteil vor. Gott kann man weder anschauen, noch eine Meinung davon haben. Denn
reine Begriffe sind nicht empirisch. Gott ist ein reiner Verstandesbegriff, der nicht mehr abgeleitet werden kann von einem übergeordneten Begriff. Wenn Gott erscheint, kann es dafür keine
physikalische Grundlage geben. Das gilt aber auch für den Begriff Natur. Denn auch dies ist ein reiner Begriff der nicht mehr aus einem übergeordneten Begriff abgeleitet werden kann. Wenn ich
also etwas als natürlich bezeichne, liegt keine Erkenntnis vor, denn Natur ist weder anschaulich noch analytisch. Wenn wir also die Natur retten wollen, dann wollen wir etwas retten von deren
physikalischen Existenz keinerlei Erkenntnis vorliegt. Was wir retten wollen ist der Planet Erde, seine Wälder, Meere und Tiere Wir wollen die klimatischen Bedingungen der Erde erhalten. Klimaleugner
negieren nicht die Existenz von Klima auf dem Planeten, sondern die Existenz von Natur und ziehen aus dieser eigentlich korrekten Annahme den logisch falschen Schluss, dass Kohlendioxid keinen
Einfluss haben könne auf die Natur. Das Problem liegt im Mittelbegriff. Es ist der gleiche Fehlschluss wie bei einem Gottesbeweis. Aus der korrekten Annahme, dass LSD die Sinneswahrnehmung verändert,
wird der falsche Schluss gezogen, es handele sich bei der LSD-Erscheinung um Gott. Es sind ästhetische Urteile, die der Erscheinung einen Wert beimessen in Relation zu meinem Selbst als Ganzes. Für
den einen handelt es sich bei der LSD-Erscheinung um Gott, bei dem anderen nicht. Was für den einen Natur ist, ist es für den anderen ganz und gar nicht. Denn Natur ist ein werthaltiger und damit
ästhetischer und normativer Begriff. Es ist ein rein ästhetisches Werturteil und keine wissenschaftliche Erkenntnis. Dass viele Menschen Qualität und Wert verwechseln ist das eine, dass sie aber
reinen Verstandesbegriffen sowohl Qualität als auch Wert zufügen, ist nichts weiter als Idiotie.
Womit bewiesen wäre, dass die meisten Politiker Idioten sind. Und jetzt beweisen Sie bitte, ob das ein analytisches oder ein ästhetisches Urteil ist. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Hegel auf Kant
Das Wahre ist das Ganze (Hegel)
Es gibt eine alte Nebenschrift von Immanuel Kant, die Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Schon im Titel offenbart sich der kosmopolitische Ansatz des Aufklärers Kant. Kant benutzt hier den Begriff der „Idee“, was für ihn ein Terminus technicus ist. Kant versteht unter der Idee ein regulatives Ordnungsprinzip. Während unsere sinnliche Anschauung die Phänomene in Zeit und Raum feststellen kann und man sich darauf verlassen kann, dass alles was erscheint sich in Zeit und Raum befindet und das in festen Kategorien des Verstandes, nach Prinzipien der Kausalität oder als einzelnes oder vieles, notwendig oder zufällig, ist das mit den Ideen anders.
Ideen sind regulativ. Das heißt, dass sie eine Norm bilden. Bei Immanuel Kant gibt es drei
regulative Prinzipien, bestehend aus der Homogenität, Spezifikation und der Kontinuität. Hunde und Pferde sind Tiere. Das heißt das Einzelne ordnet sich dem Allgemeinen unter und umgekehrt findet
sich immer noch eine Einteilung des Einzelnen. Dackel und Pinscher sind zwar Hunde, aber sie unterscheiden sich eben auch wieder spezifisch voneinander. Aber sie sind miteinander auch verwandt, das
ist die Kontinuität. Diese Ordnung der Dinge ist nicht transzendental (transzendental ist eine Erkenntnis an sich, wie zum Beispiel „ich denke also bin ich“) gerechtfertigt, sondern subjektiv.
Man kann alles auch anders einteilen.
Wenn Kant in diesem oben erwähnten Aufsatz von einer Idee der allgemeinen Geschichte spricht, dann möchte er den historischen Fortschritt als ordnende Idee verstanden wissen. Mehr nicht.
Gott, Willensfreiheit und Unsterblichkeit der Seele werden in seiner praktischen Vernunft als Ideen gesehen, die man sinnvoll annehmen sollte. Man kann weder die Existenz Gottes beweisen, noch die
Freiheit unseres Willens und genau so wenig die Unsterblichkeit der Seele. Doch Gott ist als höchstes Gut und sittliche Vollendung eine leitende Idee. Die Willensfreiheit ist eine Voraussetzung für
Moralität. Beweisen kann man es nicht, aber ohne die Freiheit des Willens würde man kein Gesetz gestalten können. Wozu? Die Unsterblichkeit der Seele ist eine Idee, die uns antreibt, immer weiter
voran zu schreiten und unser individuelles Ende nicht nach dem Motto „nach mir die Sintflut“ zu leben. Ohne die Idee von der Unsterblichkeit der Seele fehlt uns ein gewaltiges Stück generativer
Verantwortung.
Hegels Weltgeschichte erhebt dagegen den Anspruch einer transzendenten, also über das Subjekt hinausgehenden Erkenntnis. Hegel operiert hier mit einer durchgehenden Dreierregel. Es gibt den subjektiven Geist, den objektiven Geist und den absoluten Geist. Diese Dreischritte haben Sie bei Hegel immer. Daher kann man Hegel gut lesen, wenn man daran denkt, dass alles bei ihm gedrittelt wird. Aber Hegel denkt sich diese Drittel nicht als Linie, sondern als eine Art Kreis. Denn jedes Drittel ist immer mit vorhanden. Fortschritt ist für Hegel daher kein Hinauf, sondern ein Streben nach Vollendung. Und das Unvollendete ist ein Teil des Vollendeten geworden.
Der subjektive Geist ist ebenfalls in drei Teile zerlegt in die Seele (Sinne),
das Bewusstsein (Selbstreflexion) und den Geist (Selbstbestimmung).
Der objektive Geist ist in die normative Ordnung von Recht, Moral und Sitte gedrittelt. Hegel unterscheidet also Moral und Sitte. Das macht Kant nicht. Für Kant sind Moral und Sitte
gleichbedeutend. Bei Hegel beginnt es mit dem abstrakten Recht, das einfach Regeln zum Eigentum, Vertrag etc. aufstellt und klärt was Recht und Unrecht ist. Das beginnt im Grunde mit den Vieh
züchtenden und Ackerbau treibenden Barbaren. Er nennt hier explizit die Ehe und den Ackerbau als maßgebend. Für ihn war die Ehe ein sittliches Verhältnis in dreierlei Hinsicht. Das hat der Alte (wie
man ihn im Tübinger Stift nannte) auch mit dem Wort „Aufheben“ gemacht. Einerseits kann man etwas aufheben im Sinne der Negation, dann kann man es aufheben um es zu bewahren und zugleich aufheben im
Sinne des Emporhebens. So sah Hegel die Ehe als Aufheben der Romanze und Überführung, Emporheben und Bewahren als eheliche Verbindung. Ein schöner Gedanke.
Die Moral ist dann die normative Verinnerlichung dieser Regeln in Form des Empfindens von Schuld und Vorsatz, Absicht und Wohl, das Gute und das Gewissen. Hier bestimmen der Wille und die Reflexion
des Willens, indem sich das Subjekt selbst bestimmt. Doch die Sittlichkeit ist bei Hegel als dritte Stufe überindividuell in drei Weisen vorhanden. Die Familie in Form von Liebe, da die
Familie unmittelbare Substantialität des Geistes darstellt und somit die Grundlage jedes Individuum ist. Dabei ist auch die Auflösung der Familie wichtig, da sie zu weiteren Familiengründungen führt.
Wenn man sich nicht löst von seinen Eltern, dann steht die Entwicklung still in irgendwelchen Sippen.
Aus all diesen Familien bildet sich naturgemäß die bürgerliche Gesellschaft, die eine Form der Kooperation der familiären Eigeninteressen darstellt. Und aus dieser bürgerlichen Gesellschaft formt sich der Staat als wahre Vereinigung aller Individuen und Wirklichkeit der Sitten.
Der Staat ist bei Hegel nicht das Volk. Vielmehr ist der Staat die formelle Verallgemeinerung des Geistes, der Völkergeister.
Der objektive Geist drückt sich bei Hegel in den Grundlinien der Philosophie des Rechts aus. Ein Volk ist für ihn noch lange kein Staat. Dazu bedarf es der
Realisierung der Form des Rechts. Das vollziehen seine Völkergeister. Und bei Hegel ist der Krieg die Triebfeder zur Bildung von Recht. Was er das Heroenrecht zur Stiftung von Staaten
nennt.
Der absolute Geist ist als Kultur in Kunst (Anschauung und Bild), Religion (Gefühl und Vorstellung) und Philosophie (reiner, freier Gedanke) gedrittelt.
Während Kants Weltgeschichte eine kosmopolitische Idee vom Fortschritt ist, nur als regulatives Ordnungsprinzip gedacht und keineswegs gewährleistet, ist Hegels Weltgeschichte eine Art Gerichtsgebäude, das die Verwirklichung des allgemeinen Geistes auslegt. Hegels Ordnungsprinzip erhebt den Anspruch einer transzendentalen Erkenntnis, gipfelnd in Hegels berühmten Satz: Was wirklich ist, ist vernünftig und was vernünftig ist, ist wirklich. In diesem hegelschen Sinn haben wir noch keine Wirklichkeit vorliegen, da sie sich noch nicht voll verwirklicht hat. Und wir haben auch keine vollständige Vernunft vorliegen, da die Wirklichkeit noch wirkt.
Viele verstehen nicht, dass dieser Dreischritt kreisförmig verläuft. Sie halten Hegels
Philosophie daher für brisant und behaupten, Hegel würde so auch eine Diktatur als sittlich ansehen. Das stimmt aber nicht. Der Staat als höchste sittliche Wirklichkeit bürgt für das abstrakte Recht
und dieses abstrakte Recht schafft die Moralität des Subjekts, indem das Subjekt dieses abstrakte Recht verinnerlicht und daraus entsteht die Sittlichkeit des Staates, der wiederum das abstrakte
Recht verbürgt. Da im Kern die Familie das Zentrum der bürgerlichen Gesellschaft ausmacht und die Kooperation der Familien Grundlage der Sittlichkeit sind, und in Folge dessen, dass auch die
Auflösung der Familie in Form von Neugründungen der Familie für einen konsequenten historischen Fortschritt sorgt, erfüllt sich die Sittlichkeit des Staates als wahrer Vereinigung aller
Individuen.
Es ist schon aus diesem Blickwinkel klar, dass die aktuellen nationalen Politiken als spektakuläre postlibertäre Demokratien nicht den allgemeinen Geist spiegeln, sondern als Auflösungstendenz der
nationalen Einheiten die Weltgeschichte vorantreiben. Die globalen Machtverhältnisse spiegeln sich nicht im Entferntesten in den nationalen Politiken. Während der Absolutismus sich in Hegels
Zeitalter auflöste, löst sich nun die nationalliberale Demokratie auf. Der Verlauf: Theokratie – Aristokratie – Absolutismus – Demokratie – und wieder zur aufgehobenen, emporgehobenen Theokratie. Die
Auflösung der römischen Demokratie mündete in den Absolutismus. Der Kaiser geht einher mit substantiellen theokratischen Ambivalenzen. Die gesamte Geschichte ist in jedem einzelnen
Geschichtsabschnitt vorhanden. Es ist immer die Summe der Weltgeschichte da und das Einzelne kann sich nicht unabhängig von der Summe verwirklichen. Das Endliche und das Unendliche war einst eine
Einheit, wurde in der Verwirklichung des Subjekts gespalten und hat sich dann erneuert im Recht. Gegen diese Wucht von Hegels Philosophie des Geistes ist Kant nur ein holzköpfiger Beamter, ein
Kategorien sabbernder, Normen hustender Pfeifenraucher. Aber Kant ist der ältere von beiden und Hegel blamierte sich, als er Napoleon für den personifizierten Weltgeist hielt.
Das Recht der Menschen muß heilig gehalten werden
Immanuel Kant Kap. VIII, Zum Ewigen Frieden, 1795
In den letzten zehn Jahren ist die Opferzahl durch weltweit stattfindende bewaffnete Konflikte
wieder stark angestiegen. Vom äthiopischen Bürgerkrieg, dem Ukraine-Krieg, Drogenkrieg in Mexiko, Rohingya-Konflikt in Myanmar, Krieg im Sudan bis zum Israel-Palästina-Krieg, der jüngst wieder
aufflammte. Über 100 Kriege in der Welt einerseits. Und doch hat sich andererseits der Friedensindex in vielen Ländern der Welt deutlich verbessert. Beinahe natürlich richten wir unsere
Aufmerksamkeit viel mehr auf die Weltgegenden, in denen es Krieg gibt, bewaffnete Konflikte und weniger auf die Gegenden in denen internationale Bemühungen deutliche Friedensfortschritte machen. In
über 80 Ländern wurde es in diesem Jahr 2023 deutlich friedlicher, wie zum Beispiel an der Elfenbeinküste, in Oman, aber auch im Nahen Osten und in Nordafrika ist es insgesamt eher friedlicher
geworden. Und dann gibt es auch noch Island, das friedlichste Land der Welt laut dem Global Peace Index, gefolgt von Neuseeland, Portugal, Österreich, Dänemark, Kanada, Singapur, Slowenien, Japan und
die Tschechische Republik. Deutschland steht dort auf Platz 22. Es gibt also nicht nur Grund zur Sorge (den es gibt, zweifelsfrei), sondern auch Grund zu hoffen. Historiker sind allzu oft viel zu
sehr an der Militärgeschichte interessiert, in den Schulen lernen wir die Daten von Kriegen auswendig, 30jähriger Krieg, 100jähriger Krieg, siebenjähriger Krieg, erster und Zweiter Weltkrieg.
Aber lernen wir auch die Friedensdaten? Die Welt war nie ganz im Krieg. Immer gab es neben Kriegsschauplätzen auch Friedensplätze in denen die Menschen sich einigten, und ein gutes Leben
anstrebten.
Ein Alterswerk des großen deutschen Philosophen Immanuel Kant setzte sich mit der Idee eines Friedens und deren grundsätzlichen Voraussetzungen intensiv auseinander. Seine Schrift „Zum ewigen
Frieden“, wurde zur Grundlage der UN-Charta der Vereinten Nationen, an der nach dem Zweiten Weltkrieg auch der Neurobiologe und Medizinnobelpreisträger Julian Huxley (älterer Bruder von Aldous
Huxley, der ja die Schöne Neue Welt schrieb, eine Weltstaats-Utopie/Dystopie) mitschrieb. Kants Schrift „Zum Ewigen Frieden“ wurde zuletzt 2001 im Zusammenhang mit dem Irakkrieg heiß
diskutiert, unter anderem zwischen den Philosophen Jacque Derrida, Jürgen Habermas und dem US-Sicherheitsberater Robert Kagan. Während Habermas und Derrida an den Ideen der Aufklärung festhielten,
sah Kagan eine Kluft zwischen Europa und Amerika. Sein Spruch erlangte Berühmtheit. Die Europäer sind Bewohner der Venus und die Amerikaner sind Bewohner des Mars.
Der 11. September 2001 wurde für viele Intellektuelle und Schriftsteller zu einem historischen Wendepunkt. Es war angeblich das Ende der Postmoderne bzw. das Ende der hedonistischen
Spaßgesellschaft.
Immanuel Kant – weit weg von jeder Postmoderne - kam 1724 als Sohn eines Sattelmachers in Königsberg zur Welt. Er lernte am berühmten königlichen Friedrichskollegium alte Sprachen und stieg in der
früheren preußischen Stadt Königsberg (heute heißt die Stadt Kaliningrad und liegt in russischem Staatsgebiet) zu einem weltweit berühmten Professor auf. Im Jahr 1795 – Kant war da schon über 60
Jahre alt und hatte seine Kritik der reinen, der praktischen Vernunft schon fertig – erschien in erster Auflage die Friedensschrift „Zum ewigen Frieden“.
Für Kant ist Frieden kein natürlicher Zustand zwischen Menschen, er muss deshalb gestiftet und abgesichert werden. Dies ist Aufgabe der Politiken.
Kants Friedensschrift ist recht juristisch geraten und erschöpft sich am Ende in Details über die Differenz von Moral und Politik. So schreibt Kant: „Die Politik sagt: »Seid klug wie die Schlangen«; die Moral setzt (als einschränkende Bedingung) hinzu:
»und ohne Falsch wie die Tauben«. Wenn beides nicht in einem Gebote zusammen bestehen kann, so ist wirklich ein Streit der Politik mit der Moral; soll aber doch durchaus beides vereinigt
sein, so ist der Begriff vom Gegenteil absurd, und die Frage, wie jener Streit auszugleichen sei, läßt sich gar nicht einmal als Aufgabe hinstellen. Obgleich der Satz: Ehrlichkeit ist die beste
Politik, eine Theorie enthält, der die Praxis, leider! sehr häufig widerspricht: so ist doch der gleichfalls theoretische: Ehrlichkeit ist besser denn alle Politik, über allen Einwurf
unendlich erhaben, ja die unumgängliche Bedingung der letzteren.“
Interessant sind Kants Vorbedingungen (Präliminarien vom lateinischen prä limine „vor der Schwelle“). Kant postuliert sechs Vorbedingungen (Präliminarien) für einen echten Frieden zwischen
Staaten. Diese sechs Vorbedingungen stelle ich hier etwas genauer vor.
Es beginnt damit, dass ein Frieden nur dann ein echter Frieden sein kann, wenn alle Streitigkeiten beidseitig als erledigt gelten. Alle Kriegsgründe müssen vollständig als erledigt gelten. Ansonsten
wäre es nur ein Waffenstillstand und jederzeit könnte erneut der Konflikt aufbrechen. Schaut man sich die derzeitigen Konfliktherde an, dann erscheint das illusorisch. Aber es wurde schon einmal
erreicht, im berühmten Pax Westphalica von 1648. Fünf lange Jahre verhandelten die vom Krieg ausgelaugten Parteien des 30jährigen Krieges in Münster und Osnabrück. Am Ende schlossen sie einen
Kompromiss. Ein guter. Es entstand die Religionsfreiheit und die stehenden Heere wurden vielfach aufgelöst, die arbeitslos gewordenen Soldaten wurden zu Beamten umgeschult. Zum ersten Mal sollten in
Europa die territorialen und religiösen Rechte der einzelnen Staaten anerkannt werden, um eine Machtbalance zu schaffen. Zwar kam es noch immer zu Konflikten und Kriegen innerhalb Europas, allerdings
nicht in dem katastrophalen Ausmaß, das während des Dreißigjährigen Krieges so viele Leben forderte. Der Westfälische Friede schuf damit die Grundlage für einen Ausgleich von Ideologie und
Machtverhältnisse in der Mitte Europas. Somit ist er ein eindrucksvolles Symbol für das Bestreben zum friedlichen Zusammenleben.
Sicher hatte Kant diesen Frieden im Blick, als er seine zweite Vorbedingung formulierte. Kein Staat, egal wie groß oder klein, darf einen anderen Staat durch Kaufen, Verschenken oder Tauschen
erwerben. Die territoriale Eigenmächtigkeit jedes Staatsgebildes gilt es zu akzeptieren und auch die im 30jährigen Krieg üblichen Truppenverkäufe (Söldnerwesen) dürfen für einen echten Frieden nicht
mehr sein. Diese zweite Vorbedingung für einen ewigen Frieden wird gerade im Russland-Ukraine-Konflikt verletzt, und zwar von beiden Seiten.
Unter den Miles Perpetuus, den stehenden Heeren, versteht man Truppen (Flotten) die dauernd unter Waffen stehen und jederzeit einsatzbereit sind, sich oft auch in Milizen organisieren und eine aktive
Streitmacht und eine Reserve für die Kriegsführung bilden. In der dritten Vorbedingung von Kants Frieden sollen diese stehenden Heere abgeschafft werden und in eine Staatsbürgerarmee mit friedlichen
(Selbstverteidigung) Zielen umgewandelt. Heute haben wir vor allem die Weltmächte (USA, China, Russland) die permanent Truppen verschieben und diesen Grundsatz brechen. Es gibt aktuell wieder
eine Tendenz zum Wettrüsten. Denn das sah Immanuel Kant darin als Gefahr. Stehende Heere provozieren, fordern heraus und führen zu einer Reaktion, die mit dem Wettrüsten der Nachkriegsjahre im 20.
Jahrhundert vergleichbar sind. In den 1990ern und am Anfang unseres Jahrtausends erlebten wir weltweit Abrüstungsbemühungen, nicht zuletzt dank des bürgerlichen Engagements der weltweiten
Friedensbewegung. Diese Bewegung hat nur noch eine marginale Bedeutung und auch dies gilt es zu bedauern.
Kriegsanleihen und Kriegskredite prägten schon in der Antike die Konflikte. Sie haben vor allem durch die veränderten ökonomischen Bedingungen im 20. Jahrhundert die Eskalation im ersten und Zweiten
Weltkrieg gefördert. Kant sieht darin ein großes Problem, da wechselseitige Verschuldung den Druck erhöht den Krieg unbedingt zu gewinnen. Auch hier sehen wir aktuell wieder eine Tendenz zu
Kriegskrediten. Sie werden oft getarnt als Wiederaufbauhilfen. Internationale Handelsbeziehungen werden zur Kriegsfinanzierung missbraucht.
Sich in die Angelegenheiten eines souveränen Staates einzumischen gilt seit dem Westfälischen Frieden grundsätzlich als verpönt. Natürlich fand es immer statt. Aber der Einsatz von Truppen im
jugoslawischen Bürgerkrieg im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde auch als Bruch mit diesem Westfälischen Frieden diskutiert. Die Nichteinmischung, Kants fünfte Vorbedingung, ist eine schwer
zu ertragende Friedensbedingung. Wenn man zusehen muss, wie der eigene Nachbar einen Genozid verursacht, sagt uns schon der gesunde Menschenverstand, dass wir hier zur Not mit Waffengewalt die
Menschen schützen müssen, die zu Unrecht gefoltert, getötet, verschleppt werden.
Wenn es denn nötig wird zur Waffe zu greifen, liefert uns Kant noch eine sechste Vorbedingung, die eine Art Kriegsrecht in Grundzügen formuliert. Im Krieg dürfen keine unehrenhaften Mittel angewandt
werden. Kant versteht darunter zum Beispiel den Giftmord, Meuchelmord, Vernichtungskrieg, Brechen der Kapitulation, Anstiftung zum Verrat. Denn diese unehrenhaften Mittel würden einen späteren
Frieden deutlich erschweren, die Wunden die gerissen würden, die Traumata führten zu Hass über Generationen.
Diese sechs Vorbedingungen werden derzeit alle nicht eingehalten. Zu sehr konzentriert sich die Welt gegenwärtig auf die legalistischen Ausführungen Kants, die er als definitiv für den Frieden sieht,
wie eine republikanische Verfassung, Föderalismus freier Staaten und ein Weltbürgerrecht. So sind die sechs Vorbedingungen immer noch aktuell und müssten in den derzeitigen Friedensbemühungen
deutlicher, noch deutlicher zum Ausdruck kommen.
Abschließend zitiere ich noch einen der berühmtesten Sätze der letzten Jahrhunderte (aus dem
Jahr 1784). Dieser stammt ebenfalls von dem 1724 geborenen und 1804 verstorbenen Immanuel Kant, der ihn in einer kleinen Nebenschrift mit dem Titel „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in
weltbürgerlicher Absicht“ aufschrieb. Das ist ein Text mit neun längeren Sätzen – also kein allzu langer Text – in dem sich Immanuel Kant mit der Vorstellung beschäftigt, dass die menschlichen
Naturanlagen einem bestimmten Zweck dienten und diesem Zweck gemäß entwickelt werden sollten. Nach Immanuel Kant ist Der Mensch ein Tier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen
Herrn nötig hat. Doch Kant war zugleich überzeugter Republikaner. Es besteht also ein Widerspruch darin, dass wir Menschen nicht ohne Führung leben können, aber der Anführer auch nur ein
Mensch ist, der eigentlich geführt werden müsste. Diesen Widerspruch kann Kant nicht auflösen und daraus folgt jetzt dieser berühmte und gern zitierte Satz Kants: „Aus so krummem Holze, als
woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts Gerades gezimmert werden.“
Kant hatte also keine sehr hohe Meinung vom einzelnen Menschen, vom Individuum. Und doch lassen sich aus diesen krummen Holzstücken immer wieder höchst harmonische und friedliche Gesellschaften
zimmern. Auch wenn wir nicht von Natur aus friedlich sind (was ich bezweifle), so sind wir in der Lage, friedlich zusammen zu leben. Das haben wir Menschen oft bewiesen.
So. Habe ich doch ein super Essay geschrieben.
Maximale Quadratur
Dreihundert Jahre nach Kants Geburtstag gelten die vier Sätze seines kategorischen Imperativs immer noch als Grenzmarkierung zur Barbarei. Die Naturgesetzformel, dass die maxima propositio (oberste Regel) meiner Handlung durch meinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte, da sei wahrlich Gott vor. Schon in dieser Hinsicht bin ich persönlich froh drum, nicht in einer solchen Lebensposition zu sein, in der mein Handeln einem Naturgesetz gleichkäme. Aber es gibt natürlich Menschen, die können einen Knopf drücken und eine Maschine in Gang setzen, die wie ein Naturgesetz auf uns wirkt. Tagtäglich sind wir mit diesen Auswirkungen konfrontiert. Die technische Komplexität unseres Daseins auszuhalten, erfordert schon übermenschliche Kräfte. Dazu noch all die Anstrengungen halbwegs unbeschädigt und nicht traumatisiert durch dieses Leben zu kommen, sind kaum noch zu erreichen. Und das in einer Welt, in der die Naturgesetze mein geringstes Problem sind. Vielmehr verursachen mir gerade jene Gesetze schwerste Traumata, die von Menschen gestaltet wurden, deren Handlungen tatsächlich zum allgemeinen Naturgesetz wurden. Und das ist wahrlich nicht schön. In dieser Hinsicht leben wir in einer barbarischen Welt.
Die zweite kantische Formel betrifft nicht die Naturgesetze, sondern die allgemeinen Gesetze des Menschen, also Recht und Ordnung. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde. Wer dieses „Allgemeine“ nicht denken kann, wer also nur nach seinen eigenen Gesetzen und nicht nach den allgemeinen Gesetzen handelt, der ist ein Barbar. Da wir Menschen evolutionsbiologisch nicht über unsere kleine Horde hinausdenken können, liegt allein in dieser kantischen Formel ein ganz eigenes kulturelles Unbehagen begraben. Kants Begriff von der „faulen Vernunft“, die derjenige anwendet, der nur seine Gesetze kennt und gleichzeitig so tut, als wären seine Gesetze allgemeingültige Gesetze, diese „faule Vernunft“ ist weit verbreitet und bestimmt den Lebenslauf fast aller meiner Mitbürger. Schon dies macht mich unendlich traurig. Denn die Menschen sind nicht dumm. Sie sind nur nicht fähig aus ihrer evolutionsbiologischen Haut zu kriechen und sich eine Allgemeinheit vorzustellen, die so abstrakt ist wie die Vorstellung von einem schwarzen Loch im Universum. Allgemeine Gesetze werden hier durch die Demokratie ausgehandelt. Sie wechseln ständig und niemand versteht mehr, warum eigentlich. Das allgemeine Gesetz in dieser Formel von Kant ist zur Tagespolitik verkommen und bedient nicht die Allgemeinheit, sondern wechselnde Interessensgruppen. Das ist pure Barbarei.
Die dritte Formel von Kant ist die Menschheitszweckformel. Der Satz des kategorischen Imperativs von Kant lautet hier: „Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ Diese Formel ist immerhin umsetzbar. Doch für die Agenten des Kapitals bin ich nur ein Endverbraucher und nur Mittel zur Bereicherung. Es ist eher ein Wunder, dass die produzierten Waren in ihrer Praxis auch einem Zweck dienen für die Menschen, denen diese Waren am Ende zum Verbrauch zugewiesen werden. Denn die Praxis der Produktion von Waren hat diesen Zweck nicht vorgesehen. Die Produktion von Waren dient allein einer Erhöhung der Rendite. Würden wir Menschen Scheiße fressen, würde der Kapitalist auch Scheiße produzieren. Tatsächlich ist das sogar der Fall. Bei den großen Marktführern der Nahrungsproduktion (Nestle, Unilever) wird längst Scheiße produziert und verkauft. Für diese Firmen ist es nicht von Bedeutung, ob die produzierten Waren auch dem Endverbraucher Vorteile bringen. Sie produzieren diese Waren zur Vermehrung ihrer Rendite. Dazu kalkulieren sie lediglich, wie viel Geschmacksverstärker die produzierte Scheiße übertünchen und ob es sich lohnt, die Scheiße überhaupt noch zu parfümieren. Die kantische Formel so zu handeln, dass der Endverbraucher der parfümierten Scheiße aus den Supermärkten, auch etwas davon hat außer Diabetes zu bekommen oder ein metabolisches Syndrom, diese Formel erfüllen Nestle und Co nicht. Dezidiert nicht. Auch andere Globalplayer im kapitalistischen Produktionshimmel interessiert es nicht im Geringsten, ob ihre bezahlenden Endverbraucher den Konsum dieser Waren überleben. Sie sind am Überleben der Endverbraucher nur interessiert, weil diese Leben ihre Rendite garantieren. So leben wir auch in unserem kapitalistischen Verbraucher-Himmel in luxuriöser Barbarei. Jeder tägliche Discounter-Besuch bestätigt diese Perversion. Dennoch lieben wir alle unsere Waren und umgeben uns mit ihnen so sehr, dass unsere Wohnungen aus allen kapitalistischen Nähten platzen. Der einzige Mangel unserer Gesellschaft ist der Mangel an Bescheidenheit. Es ist pervers. Was unsere Welt der Waren und des Tauschens betrifft, leben wir in tiefster Barbarei. Und da Geld den Alltag bestimmt, darüber bestimmt, wer ich bin, was ich bin und ob ich überhaupt sein darf, haben wir eine Form der Barbarei entwickelt, die geradezu dem Gegenteil der Menschheitszweckformel entspricht. Hier ist alles für die Menschheit unzweckmäßig. Das ist keine Behauptung, sondern belegt durch die aktuelle Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Diese Zerstörung der Erde ist ein Ergebnis unseres Wirtschaftens. Simpel.
Daher sind wir von Kants Endformel, so zu handeln, als ob wir durch unsere Maximen jederzeit ein gesetzgebendes Glied im allgemeinen Reiche der Zwecke wären, so weit entfernt, wie ein Stern in einer anderen Galaxie.
Dieses von Immanuel Kant beschworene allgemeine Reich der Zwecke ist keine Utopie im Sinne des goldenen Zeitalters. In dieser von Hesiod beschworenen Vergangenheit, als wir in Arkadien lebten, mit den Göttern befreundet von Sorgen befreit das Gemüte, fern von Mühen und fern von Trübsal; entrückt von jeglichem Übel, in dieser Vergangenheit war der Mensch nicht mündig und auch gar nicht fähig ein sittliches Wesen zu sein. Bei Hesiod heißt es weiter: Wie vom Schlummer bezwungen verschieden sie; keines der Güter missten sie; Frucht gab ihnen das nahrungsspendende Saatland gern von selbst und in Hülle und Fülle; und ganz nach Belieben schafften sie ruhig das Werk im Besitze der reichlichsten Gaben, wohl mit Herden gesegnet. Also ein kapitalistisches Schlaraffenland. Das war Arkadien. Aber das Ideal von Immanuel Kant ist nicht der naive und glückliche Mensch der ohne Kummer und Sorgen in einem Garten wohlbehütet wie ein Kind lebt. Die Freiheit, die uns als Mensch vor allem auszeichnet, ist eine Freiheit von den kausalen Naturgesetzen. So frei zu sein bedeutet, sich sittlich selbst zu bestimmen. Aber wie lässt sich das ohne totales Chaos auszulösen für acht Milliarden Menschen (und es werden immer mehr, 2050 werden wir die 15 Milliarden-Grenze überschreiten) bewerkstelligen. Wie können wir ein Reich der Zwecke gestalten in der jeder einzelne Mensch die Option hat, sittlich frei zu handeln? Gelingt dies nur unter Berücksichtigung der vier Formeln von Immanuel Kant? Und sind wir dann noch frei? Und jetzt, spätestens jetzt, sprengt es mir den Schädel und ich will nicht ein Wort mehr hören von Philosophie.
Kafka und die Tiere
In ihrem Essay „Against Interpretation“, meinte Susan Sontag einmal, dass Kafkas Werke einer
„Massenvergewaltigung durch Interpretationen“ zum Opfer gefallen sei. Interpretationen innerhalb einer Kulturindustrie wird in der Tat zum Massenbetrug, da sich diese Interpretationen sich
fortschreiben und eine Hegemonialität zu Grunde liegt, deren Dominanz den eigentlichen Texten schadet, sie geradezu zugrunde richtet. Kafka zu lesen, ohne gleich daran denken zu müssen, dass er einen
Vater hatte, das ist schon fast eine revolutionäre Haltung der Dekonstruktion logozentrischer Positionen innerhalb der Massenkultur.
Die Zoopoetik bei Franz Kafka ist von einer seltenen Dichte an Tieren. Es wimmelt in seiner Prosa von Pferden, Hunden, Affen, Ratten, Mäusen und Ungeziefer. Wohl nach Aussage von Dora Diamant hat
sich Kafka vor allem in Brehms Tierleben umgesehen, um seine Tiere zu finden und hielt sich auch an die Beschreibungen. Kafka wandte also modernste Montagetechniken an bei seiner Tierprosa. Es sind
aber keine Fabeln im herkömmlichen Sinne, da sie ihre typisch surreale Motivik enthalten. Kafkas Leitmotive sind dabei die Einsamkeit, soziale Entfremdung, ein ambivalentes Verhältnis zu Hierarchien
(oft sind die Tiere subaltern angelegt), sinnlose Aufgaben oder sinnlose Existenz. Kafkas Tiere – ob sie von außen dargestellt werden oder von innen – sind scheue, forschende, isolierte Wesen. Nur
selten - wie in der Erinnerung an die Kaldabahn, sind sie Animetapher für die bedrohliche Gesellschaft. Dort sind es übergroße Ratten, die sich wie das Militär formieren, und den
isolierten Erzähler bedrohen. In einem Essay von Walter Benjamin aus dem Jahr 1934 (zehn Jahre nach Kafkas Tod) meinte Benjamin:
Unabsehbar wie die Welt der für ihn wichtigen Tatsachen aber war für Kafka auch die seiner
Ahnen und gewiß ist, daß sie, wie die Totembäume der Primitiven, zu den Tieren hinunterführte. übrigens sind die Tiere nicht allein bei Kafka Behältnisse des Vergessenen. Im tiefsinnigen »Blonden
Eckbert« Tiecks steht der vergessene Name eines Hündchens – Strohmianals Chiffre einer rätselhaften Schuld. So kann man verstehen, daß Kafka nicht müde wurde, den Tieren das Vergessene
abzulauschen.
Sie sind wohl nicht das Ziel; aber ohne sie geht es nicht.
Die bekannteste Tiergeschichte ist sicher die Verwandlung von Gregor Samsa in ein Insekt. Es ist eine so oft interpretierte Geschichte, dass ich sie hier nicht auch noch interpretieren muss. Aber klar ist, dass Gregor vom scheinbaren Versorger zum subalternen und unerwünschten, weil unbrauchbaren Subjekt absteigt. Alle sind am Ende erleichtert, als er stirbt. Weniger bekannt sind die Geschichten vom Variete-Affen Rotpeter, der die Menschen nachahmt in „Bericht für eine Akademie“, oder die Forschungen eines alten Hundes über grundsätzliche Fragen einer Hundeschaft, über das Hundeessen das er nicht ißt, um es zu erforschen, über Lufthunde (Juden in der Diaspora). Einer seiner letzten Texte war dann Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse, der in dem 1924 erschienenen Sammelband „Der Hungerkünstler“ erschien. Josefines leises Pfeifen ist unumstritten Kunst. Aber die Mäuse-Diva muss von aller Arbeit freigestellt werden, sonst verliert sie ihre fragile Kunstfähigkeit. Zwar hört man sie kaum, so leise ist das Pfeifen. Doch würde sie ganz verstummen, wenn man sie niedere Arbeiten ausführen ließe. So macht Kafka auch die Kunst selbst zum subalternen Projekt.
„Der Bau“ von 1923 ist das Selbstzeugnis eines Dachs ähnlichen Tieres, das ein verzweigtes Labyrinth erbaut, das zum Schutz vor Feinden dienen soll. Von außen betrachtet perfekt anzusehen. Im Inneren des Baus aber ist der Schutz nicht mehr wahrnehmbar. Ein gleichbleibendes Geräusch irritiert das Tier zusehends bis zur Paranoia.
Der Bau (1923-24)
Ich habe den Bau eingerichtet und er scheint wohlgelungen. Von außen ist eigentlich nur ein großes Loch sichtbar,
dieses führt aber in Wirklichkeit nirgends hin, schon nach ein paar Schritten stößt man auf natürliches festes Gestein. Ich will mich nicht dessen rühmen, diese List mit Absicht ausgeführt zu haben,
es war vielmehr der Rest eines der vielen vergeblichen Bauversuche, aber schließlich schien es mir vorteilhaft, dieses eine Loch unverschüttet zu lassen.
Es muß ja kein eigentlicher Feind sein, dem ich die Lust errege, mir zu folgen, es kann recht gut irgendeine beliebige kleine Unschuld, irgendein widerliches kleines Wesen sein, welches aus Neugier mir nachgeht und damit, ohne es zu wissen, zur Führerin der Welt gegen mich wird, es muß auch das nicht sein, vielleicht ist es – und das ist nicht weniger schlimm als das andere, in mancher Hinsicht ist es das schlimmste – vielleicht ist es jemand von meiner Art, ein Kenner und Schätzer von Bauten …“
Im Kübelreiter ist es nicht eigentlich ein Tier, sondern ein zum Tier umfunktionierter leerer Kohlenkübel mit dem der Icherzähler durch die kalten, winterlichen Gassen Prags schwebt, um sich beim Kohlenhändler Kohle zu leihen. Aber der Kohlenhändler nimmt ihn nicht wahr und seine Frau verhindert zusätzlich den Kontakt und vertreibt den frierenden Erzähler mit ihrer Schürze, so dass dieser in die kalte Nacht fliehen muss.
Der Kübelreiter (1917, harter
Winter)
ich darf doch nicht erfrieren; hinter mir der erbarmungslose Ofen, vor mir der Himmel ebenso; infolgedessen muß ich
scharf zwischendurch reiten und in der Mitte beim Kohlenhändler Hilfe suchen.
[…] unten aber steigt mein Kübel auf, prächtig, prächtig; Kameele, niedrig am Boden hingelagert, steigen, sich schüttelnd unter dem Stock des Führers, nicht schöner auf.
Alle Vorzüge eines guten Reittieres hat mein Kübel; Widerstandskraft hat er nicht; zu leicht ist er; eine Frauenschürze jagt ihm die Beine vom Boden.
Ein Riesenmaulwurf steht im Zentrum der Geschichte über einen Dorfschullehrer, der diesen Riesenmaulwurf gesehen hatte und darüber geschrieben. Nur wurde er nicht akzeptiert. Man machte sich über ihn lustig. Der Erzähler steht anfangs dem Dorfschullehrer nahe. Aber der Dorfschullehrer reagiert auf den Erzähler abweisend. Der Erzähler verfasst nun selbst einen Bericht über diesen Riesenmaulwurf und wird nicht ernst genommen. Am Ende wirft er den Dorfschullehrer hinaus, benimmt sich also so, wie der Dorfschullehrer selbst. Hier haben wir eine mys en abyme, einen Mops, der in die Küche kommt. Denn das ließe sich fortschreiben. Und es ist womöglich schon von Kafka eine Fortschreibung, denn es existiert eine kleine Geschichte über einen Maulwurf als dem Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes von Johann Peter Hebel (von 1811). Dort heißt es über die Maulwürfe:
„Nun, man sagt so: Wo die Wurzeln abgenagt sind und die Pflanzen sterben, wird man auch Maulwürfe finden; und wo keine Maulwürfe sind, geschieht das auch nicht. Folglich tuts der Maulwurf. – Der das sagt, ist vermutlich der nämliche, der einmal so behauptet hat: Wenn im Frühlinge die Frösche zeitlich quaken, so schlägt auch das Laub beizeiten aus. Wenn aber die Frösche lange nicht quaken wollen, so will auch das Laub nicht kommen. Folglich quaken die Frösche das Laub heraus.
So sind die Maulwürfe nicht Schuld am Pflanzensterben, sondern die Engerlinge, und der Maulwurf ist eigentlich der Schutz der Pflanzen, weil er die Engerlinge frißt. Aber die Menschen sind dumm und jagen den Maulwurf, weil sie falsche Analogie-Schlüsse ziehen. Der Anstieg der Geburtenrate korreliert mit dem erhöhten Aufkommen nistender Störche. So könnte man auch einen Aspekt des Antisemitismus erklären. Die vermeintlichen Mörder des Gottessohnes und die vermeintlichen Brunnenvergifter und vermeintlichen Finanz-Verschwörer entstehen als Analogie-Schlüsse. Immer dann, wenn es Krisen auf der Welt gibt, steigt auch der Antisemitismus an.
Der Dorfschullehrer (1914-15)
Nachdem der Lehrer große Schwierigkeiten überwunden hatte, überhaupt Einlaß zu erlangen, merkte er schon bei der
Begrüßung, daß der Gelehrte in einem unüberwindbaren Vorurteil in betreff seiner Sache befangen war. In welcher Zerstreutheit er dem langen Bericht des Lehrers zuhörte, den dieser an der Hand seiner
Schrift erstattete, zeigte sich in der Bemerkung, die er nach einiger scheinbarer Überlegung machte: »Die Erde ist doch in Ihrer Gegend besonders schwarz und schwer. Nun, sie gibt deshalb auch den
Maulwürfen besonders fette Nahrung und sie werden ungewöhnlich groß.« »Aber so groß doch nicht«, rief der Lehrer und maß, in seiner Wut ein wenig übertreibend, zwei Meter an der Wand ab. »O doch«,
antwortete der Gelehrte, dem das Ganze offenbar sehr spaßhaft vorkam. Mit diesem Bescheide fuhr der Lehrer nach Hause zurück. Er erzählt, wie ihn am Abend im Schneefall auf der Landstraße seine Frau
und seine sechs Kinder erwartet hätten und wie er ihnen das endgültige Mißlingen seiner Hoffnungen bekennen mußte.
Als ich später die Schrift des Lehrers las – sie hatte einen sehr umständlichen Titel: »Ein Maulwurf, so groß, wie ihn noch niemand gesehen hat« –, fand ich tatsächlich, daß wir in wesentlichen Punkten nicht übereinstimmten, wenn wir auch beide die Hauptsache, nämlich die Existenz des Maulwurfs, bewiesen zu haben glaubten. Immerhin verhinderten jene einzelnen Meinungsverschiedenheiten die Entstehung eines freundschaftlichen Verhältnisses zum Lehrer, das ich eigentlich trotz allem erwartet hatte.
In einer späten Schrift von 1922 erzählt ein Synagogenbesucher von einem Tier, ähnlich einem Marder, das in einer Synagoge lebt, wohl schon ziemlich lange, es ist ein altes Tier, sieht schrecklich aus, vor allem die Frauen haben Angst davor, locken es aber auch, um dann davor zu erschrecken, die Männer sind eher gleichgültig gegenüber dem Tier, das sich immer nur bei den Gebeten blicken lässt, weil der ungewöhnliche Lärm es aus seinem Bau herauslockt und es wohl Gefahr wittert. Einmal diskutierte man ernsthaft, ob man diesen scheuen, alten Marder fangen und aus der Synagoge schaffen solle. So ist der Marder in gewisser Art der Mythos, der sich in den rationalen Zeremonien noch aufhält. Denn der Erzähler betont ausdrücklich, dass es gar nicht möglich ist, diesen Marder zu fangen und aus der Synagoge zu schaffen. Ganz im Sinne der kritischen Theorie Adornos wird hier der Mythos Teil der Aufklärung.
In unserer Synagoge (1922)
In unserer Synagoge lebt ein Tier in der Größe etwa eines Marders. Es ist oft sehr gut zu sehn, bis auf eine Entfernung
von etwa zwei Metern duldet es das Herankommen der Menschen. Seine Farbe ist ein helles Blaugrün. Sein Fell hat noch niemand berührt, es läßt sich also darüber nichts sagen, fast möchte man
behaupten, daß auch die wirkliche Farbe des Felles unbekannt ist, vielleicht stammt die sichtbare Farbe nur vom Staub und Mörtel, die sich im Fell verfangen haben, die Farbe ähnelt ja auch dem
Verputz des Synagogeninnern, nur ist sie ein wenig heller.
Es ist, von seiner Furchtsamkeit abgesehen, ein ungemein ruhiges, seßhaftes Tier; würde es nicht so oft aufgescheucht werden, es würde wohl den Ort kaum wechseln, sein Lieblingsaufenthalt ist das Gitter der Frauenabteilung, mit sichtbarem Behagen krallt es sich in die Maschen des Gitters, streckt sich und blickt hinab in den Betraum, diese kühne Stellung scheint es zu freuen, aber der Tempeldiener hat den Auftrag, das Tier niemals am Gitter zu dulden, es würde sich an diesen Platz gewöhnen und das kann man wegen der Frauen, die das Tier fürchten, nicht zulassen.
Es sieht allerdings beim ersten Anblick erschrekkend aus, besonders der lange Hals, das dreikantige Gesicht, die fast waagrecht vorstehenden Oberzähne, über der Oberlippe eine Reihe langer, die Zähne überragender, offenbar ganz harter, heller Borstenhaare, das alles kann erschrecken, aber bald muß man erkennen, wie ungefährlich dieser ganze scheinbare Schrecken ist
Vor vielen Jahren, so erzählt man, soll man wirklich versucht haben, das Tier zu vertreiben. Es ist ja möglich, daß es wahr ist, wahrscheinlicher aber ist es, daß es sich nur um erfundene Geschichten handelt. Nachweibar allerdings ist, daß man damals vom religionsgesetzlichen Standpunkt aus die Frage untersucht hat, ob man ein solches tier im Gotteshause dulden darf. Man holte die Gutachten verschiedener berühmter Rabbiner ein, die Ansichten waren geteilt, die Mehrheit war für die Vertreibung und Neueinweihung des Gotteshauses. Aber es war leicht, von der Ferne zu dekretieren,. In Wirklichkeit war es ja unmöglich, das Tier zu fangen, und deshalb auch unmöglich, es zu vertreiben.
Der letzte Versuch des Impressionismus
Ich wollte die Natur kopieren, aber ich konnte es nicht (Claude Monet)
Die Wiener Moderne war geprägt vom Impressionismus, also von stimmungsvoller Darstellung
flüchtiger Momente. Diese kurze Epoche lässt sich um die Zeit 1890 bis 1910 ansiedeln und war mehr von der Kunst (Klimt), der Musik (Schönberg) und dem Drama (Burgtheater) bestimmt, als von der
Literatur. Wiener Autoren hatten kaum Veröffentlichungsmöglichkeiten in Wien. Die meisten schrieben ihre Texte daher für Berliner Verlage. Von den rund 52 Millionen Einwohnern der
österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie lebten gerade einmal 11 Millionen Menschen in industrialisierten Gebieten (hauptsächlich in Wien und in Prag), der Rest der Monarchie war Agrarland. Wien
war daher zentralistisch und aristokratisch geprägt, eine Art orientalisches Paris.
Verfeinerte Sensibilität, gesteigerte Wahrnehmungs- und Reizempfindlichkeit, als Resultat einer gewissen Sorglosigkeit und Unbefangenheit. So konnten ästhetische Reize als von der unmittelbaren
Lebenspraxis losgelöste Werte erlebt werden, als intime Stimmungswerte. Ausgedehnte literarische Lektüre, Noblesse, Geschmack, Nervosität.
Größter Wortführer des Impressionismus war Hermann Bahr. Er kam 1863 als Sohn des Rechtsanwaltes und liberalen Landtagsabgeordneten Alois Bahr in Linz zur Welt. Er wurde zum Propheten der
Moderne in Jung-Wien und propagierte den Impressionismus als Überwindung des Naturalismus. 1922 übersiedelte er nach München, wurde in die Sektion Dichtkunst der preußischen Akademie der Künste
berufen und starb 1934 an einer fortschreitenden Demenz.
Hermann Bahr schrieb in einem Glückwunsch an Arthur Schnitzler: Durch unsere Geburt gehören wir ihr an (der ökonomischen Klasse), deshalb wird sie aus unserer Empfindung niemals auszutilgen sein. Die bürgerliche Klasse wird als „sinkende Klasse“ (Bahr) empfunden – das Dekadenz-Gefühl, Sinnlichkeitsluxus, Wahrnehmung um der Wahrnehmung willen. Die österreichische Moderne hat dem Naturalismus (vor allem geprägt durch die französische Literatur von Emilie Zola, oder auch Balzac) kein tieferes Interesse entgegengebracht. Der Naturalismus (exakte Wissenschaften, Schnörkellosigkeit, exakte Beobachtung, umfassende Darstellung) war ein aus der Aufklärung gewachsenes Interesse, das dem noch aristokratisch gesinnten Wiener suspekt war. Ein schönes und ironisches Beispiel für diese Diskrepanz liefert der erste Satz in Robert Musils Mann ohne Eigenschaften.
Woraus bemerkenswerter Weise nichts hervorgeht
Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum; es wanderte ostwärts, einem über Rußland lagernden Maximum
zu, und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren
Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, der Lichtwechsel des
Mondes, der Venus, des Saturnringes und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den astronomischen Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste
Spannkraft, und die Feuchtigkeit der Luft war gering. Mit einem Wort, das das Tatsächliche recht gut bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist: Es war ein schöner Augusttag des Jahres
1913.
So löst auch der Szientismus unser natürliches Empfinden in sperrige, abstrakte Daten auf.
Robert Musils Roman „Mann ohne Eigenschaften“ dokumentiert vor allem diesen Widerspruch zwischen Szientismus und Romantik, wobei sich Musil über Beides lustig macht und sich die Frage stellt, wie in
dieser fortgeschrittenen Industrie noch ein mystisches Erleben möglich sein könnte. Er sprach dabei von dem Entwurf einer „taghellen Mystik“.
Die Eindruckskunst hatte es im Wien um die Jahrhundertwende leichter, als im bürgerlichen Berlin. Den Anstoß dazu gab ein erst in Prag und dann in Wien lehrender Physiker: Ernst Mach. Seine
„Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen“ von 1885 hatte ab der zweiten Auflage von 1900 eine große Breitenwirkung. Auch Robert Musil promovierte über Ernst Mach.
Hermann Bahr berichtet in seinem Essay „Das unrettbare Ich (Dialog vom Tragischen)“ von 1904 über seine Reaktion auf Ernst Mach, es handele sich um die „Philosophie des
Impressionismus“.
Erklärend: Mach definiert Körper (Gegenstände) als relativ beständige Komplexe von Farben, Tönen, Drücken usw., wobei dem Wort „relativ“ entscheidende Bedeutung beizumessen ist.
„Mein Tisch ist bald heller, bald dunkler beleuchtet, kann wärmer und kälter sein… Mein Freund kann einen anderen Rock anziehen. Sei Gesicht kann ernst und heiter werden. Seine Gesichtsfarbe kann durch Beleuchtung oder Affecte sich ändern.“ (Ernst Mach).
So ist auch das menschliche Ich ein Komplex, dem nur relative Beständigkeit zukommt, ein Komplex aus Erinnerungen, Stimmungen, Gefühlen. Was man als Einheit der Persönlichkeit empfindet, ist nur eine scheinbare Einheit eine durch Kontinuität der langsamen Änderung hervorgerufene Täuschung. So kann das Ich auch, das Individuum ein Teil vieler (auch fremder) Bewusstseinsinhalte sein, es sind Spiegelungen dessen, was den Menschen umgibt, ihn füttert.
Warenhaftigkeit und der Eindruck der Industrialisierung, die Elektrifizierung der Stadt führten dann etwas später zu dem beeindruckenden Essay „Die Kunst im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ von Walter Benjamin (in den 1930ern verfasst). Darin wird unser ganzer Wahrnehmungsapparat historisch. Wir empfinden immer auch innerhalb unserer Zeit. Oder wie es Goethe in seinem Faust formulierte: „Was ihr den Geist der Zeiten nennt, ist der Herren eigener Geist in dem die Zeiten sich bespiegeln“. Durch die Möglichkeit der Reproduktion (vor allem durch den Film) verlor das Kunstwerk seine Aura, ihre Einmaligkeit und Besonderheit.
In den 1960er Jahren (1962) erschien dann das epochale und visionäre Buch „Die Gutenberg-Galaxis“ von Marshall Mc Luhan, in der die Kernthese lautet: Das Medium ist die Botschaft. Die Brille durch die wir blicken, a mist before our Eyes, nannte es einst John Locke (1632-1704), ist der Maßstab für alle Veränderung, das Tempo für den Menschen. Heute diskutieren wir intensiv über die neue Technik der KI und was diese mit uns machen wird.
Bei der ersten Filmaufführung der Brüder Lumiere am 28. Dezember 1895 im Grand Cafe in Paris kam es zu einer Panik. Die Lumières hatten Eintritt verlangt, ein paar Dutzend Besucher zahlten - und sahen zehn kurze Filme, die Angestellte der Lumière-Betriebe mit einem Kinematographen vorführten: offiziell die erste Kinovorführung. Den Apparat, Kamera und Projektor zugleich, hatten die Franzosen ein paar Monate zuvor patentieren lassen, am 13. Februar 1895. Nun staunten die Besucher der Vorstellung und starrten auf die bewegten Bilder vor sich. So etwas hatten sie noch nie gesehen.
Heute ist nicht mehr genau zu klären, ob sich die später vielfach kolportierte Geschichte einer Panik angesichts des Films "Die Ankunft des Zuges auf dem Bahnhof La Ciotat" tatsächlich so abgespielt hat. Der kurze Streifen zeigt einen Zug, der in den Bahnhof des Städtchens La Ciotat einfährt, aus Zuschauerperspektive immer größer wird, die Besucher zu überrollen scheint. Die sollen damals aufgeregt und voller Schrecken von ihren Sitzen aufgesprungen sein und das Café fluchtartig verlassen haben, hieß es später. Sie dachten, der Zug fährt tatsächlich ins Café ein. Die Kameraperspektive hatte das suggeriert.
War der Naturalismus noch mit dem Anspruch aufgetreten, die ursächlichen Zusammenhänge in
Natur und Gesellschaft in den Griff zu bekommen, verzichtete die sich vom naturalistischen Programm distanzierende Moderne auf einen solchen Anspruch.
Mimesis ohne Kausalität. Das beobachtende, empfindende, auf Reize reagierende Ich wurde zur Wahrnehmungsinstanz. Beim Impressionismus ist die Reizabhängigkeit und Unfertigkeit des Subjekts potentiell
eine Tugend. Die Fähigkeit, sich selbst unaufhörlich zu erneuern, das Fertige, Geordnete, war zum Beispiel für Peter Altenberg (1859-1919, lebte in Wien und war ein bekennender Pädophiler) ein
Merkmal philisterhaften Daseins.
„Menschen sind nicht, sie werden“ schrieb Peter Altenberg. Das punktuelle Daseinsgefühl entfaltet sich in Augenblicken besonderer sinnlicher Intensität, in denen der Mensch völlig in den Bann der flüchtigen Gleichzeitigkeit eines Bündels von Eindrücken gerät.
Hermann Bahr schrieb: „Es ist daher richtig bemerkt worden, der literarische Impressionismus stimme mit dem malerischen auch darin überein, daß er besondere Wirkungen aus einer im Text selbst enthaltenen Aufforderung an den Rezipienten beziehe, dem Appell, die Andeutung assoziativ zu ergänzen.“
Einerseits die Auslassung, die Ellipse, das Andeuten, andererseits das symbolische Korrelat. So beschreibt es Hermann Bahr in seinem literarischen Manifest „Die Überwindung des Naturalismus“:
Einem Vater stirbt sein Kind. Dieser wilde Schmerz, die rathlose Verzweiflung sei das Thema. Der rhetorische Dichter wird jammern und klagen und stöhnen: "Ach, wie elend und verlassen und ohne Trost ich bin! Nichts kann meinem Leide gleichen. Die Welt ist dunkel und verhüllt für mich," – kurz, einen genauen und deutlichen Bericht seiner innern Thatsachen. Der realistische Dichter wird einfach erzählen: "Es war ein kalter Morgen, mit Frost und Nebel. Den Pfarrer fror. Wir gingen hinter dem kleinen Sarg, die schluchzende Mutter und ich," – kurz einen genauen und deutlichen Bericht aller äußeren Thatsachen. Aber der symbolische Dichter wird von einer kleinen Tanne erzählen, wie sie gerade und stolz im Walde wuchs, die großen Bäume freuten sich, weil niemals eine den jungen Gipfel verwegener nach dem Himmel gestreckt: "Da kam ein hagerer, wilder Mann und hatte ein kaltes Beil und schnitt die kleine Tanne fort, weil es Weihnachten war" – er wird ganz andere und entfernte Thatsachen berichten, aber welche fähig sind, das gleiche Gefühl, die nämliche Stimmung, den gleichen Zustand, wie in dem Vater der Tod des Kindes, zu wecken. Das ist der Unterschied, das ist das Neue.
Der naturalistische Ansatz der Genauigkeit, das begriffliche und Generalisierende in der Sprache, tritt zugunsten des Besonderen und Einmaligen zurück. Arno Holz (1863-1929, Dichter des Naturalismus) bemerkte dazu: „Der Vogel sitzt auf einem Baum“, ist schlechter, als der Satz „Der Zeisig sitzt auf der Ulme“.
In dieser Stimmung schwindet auch der Unterschied zwischen Innen und Außen, so werden die Randzonen des Bewusstseins zur literarischen Maxime. Und der innere Monolog ist das Beispiel für die Errungenschaften impressionistischer Faktur in diesem Bereich!
Historisch beginnt der „innere Monolog“ in der Epoche der „Empfindsamkeit“ und des „Sturm und Drang“. Das Gedankenzitat (direkte Rede) wird im Grunde nur lang gezogen. Denn der innere Monolog bleibt in der 1. Person Präsens Indikativ. Sprachlich wird hier mit a-grammatischem, parataktischem Satzbau gearbeitet. Noch deutlicher wird der Gedanke, wenn Sie den Gedanken als elliptische Satzkonstruktion darstellen. Einleitende Verben fehlen dabei. Bei Franz Kafka werden wir einen weiteren großen Fortschritt erleben, wenn er die erlebte Rede einführt.
Die Moderne im Allgemeinen und die Wiener Moderne im Besonderen läuteten einen weiteren
Schritt der Literatur ein, der zuvor in den 1830er Jahren im Julikönigtum sich etablierte. So gesehen ist der Impressionismus nicht eigentlich ein Konkurrent zum Naturalismus, sondern ein weiterer
Schritt in der zunehmenden Arbitrarität der Literatur. Noch im 18. Jahrhundert bestand für den Schriftsteller keine Spannung zwischen dem wirklichen und dem sein sollenden Publikum. Erst mit der
Proteus-Gestalt der bürgerlich geprägten Finanz- Kapitalismus änderte sich das elementar. Das System machte sich von seinen Trägern unabhängig und verwandelte sich in einen Mechanismus, dessen Gang
keine menschliche Macht aufzuhalten vermag. In dieser Selbstbewegung des Apparats besteht das Unheimliche des modernen Kapitalismus. Eine Dämonie, die schon Balzac erschreckend schilderte.
Der Impressionismus ist ein letzter Versuch das Auseinanderfallen der Perspektive des Absoluten zu verhindern. Er scheiterte darin.
Heute sind wir alle Epigonen dieses Verlustes einer absoluten Perspektive. Wir können die Natur weder kopieren, noch begreifen ohne eine absolute Perspektive. Wir könnten aber wieder staunen lernen.
Ein traurige Ritter tritt auf und ertönt in der Wirklichkeit
Im Jahr 2002 wurde von Schriftsteller aus aller Welt der Roman El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha von Miguel de Cervantes, übersetzt Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha zum besten Buch aller Zeiten gewählt. Der Norwegische Buchclub forderte 100 Autoren aus 54 Ländern auf, ihre zehn persönlichen Favoriten zu wählen und erstellten daraus eine Liste mit den 100 größten Romanen. "Don Quijote" habe dabei rund 50 Prozent mehr Stimmen erhalten als jedes andere Buch, erklärte der Club.
Für die anderen Bücher auf der Liste gab der Club keine Platzierungen an. Erfolgreichster Schriftsteller war der Russe Fjodor Dostojewski, der gleich mit vier Werken vertreten war: "Schuld und Sühne", "Der Idiot", "Die Dämonen" und "Die Brüder Karamasow". Franz Kafka, William Shakespeare und Leo Tolstoi schafften es mit je drei Werken auf die Liste, Thomas Mann, William Faulkner und Virginia Woolf mit je zwei. Als bester deutscher Schriftsteller wurde Günter Grass gewählt.
Zu den befragten Autoren gehörten John Irving, Salman Rushdie, John Le Carre, Carlos Fuentes und Fay Weldon. Die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren gab noch vor ihrem Tod im Januar ihre Stimme ab. Ihre "Pippi Langstrumpf" war ebenfalls auf der Liste vertreten.
DIE WAHRHEIT ÜBER SANCHO PANSA
Von Franz Kafka (1931)
Sancho Pansa, der sich übrigens dessen nie gerühmt hat, gelang es im Laufe der Jahre, durch Beistellung einer Menge Ritter- und Räuberromane in den Abend- und Nachtstunden seinen Teufel, dem er später den Namen Don Quixote gab, derart von sich abzulenken, daß dieser dann haltlos die verrücktesten Taten aufführte, die aber mangels eines vorbestimmten Gegenstandes, der eben Sancho Pansa hätte sein sollen, niemandem schadeten. Sancho Pansa, ein freier Mann, folgte gleichmütig, vielleicht aus einem gewissen Verantwortlichkeitsgefühl dem Don Quixote auf seinen Zügen und hatte davon eine große und nützliche Unterhaltung bis an sein Ende.
So gelingt es Franz Kafka, erneut Verwirrung zu stiften, indem er die Rollen vertauscht und nicht nur das, sogar den Teufel selbst dabei bannt. Kafka greift auf seine meisterhafte Art den Selbstreferenz auf und bedient sich ihrer als weitere Wahrheit.
Es handelt sich bei Cervantes Rittersatire nicht nur um eine Mischung aus heroischem Roman und Schelmenroman (Guzman), sondern auch um den ersten modernen Roman der Weltgeschichte, 1605 erschien der erste Teil, 1615 der zweite Teil.
Zum zweiten Teil gibt es aber eine weitere Geschichte, mit der ich beginnen möchte:
Ein berühmtes Beispiel für so genannte Selbstreferenz (eine Idee, ein Bild, ein Modell nimmt auf sich selbst Bezug, wie in dem berühmten Satz auf der Whiteboard „dieser Satz ist falsch“) ist der große Roman „Der geistvolle Hidalgo Don Quijote von der Mancha“, von Miguel de Cervantes Saavedra aus dem Jahr 1605. In vielerlei Hinsicht zählt dieser Roman (aus dem goldenen Zeitalter der spanischen Literatur) zum ersten modernen Roman der Kulturgeschichte. Das liegt vor allem am zweiten Teil, den Cervantes 1615 herausbrachte. Denn ein Jahr zuvor hatte ein gewisser Avellaneda (Pseudonym) eine apokryphe Fortsetzung geschrieben, eher plump und einförmig. Cervantes reagierte darauf besonders raffiniert indem er nicht nur den Handlungsstrang der Fälschung aufgreift, sondern auch die Figuren aus der Fälschung mit dem originalen Don Quijote und Sancho Pansa konfrontiert. Während in der Fälschung von Avellaneda Don Quijote von dem Edelmann Don Alvaro Tarfe ins Irrenhaus eingesperrt wird, konfrontiert ihn Cervantes mit dem „wirklichen“ Don Quijote, Tarfe ist irritiert und muss bekennen, dass er nun dem tatsächlich wirklichen Ritter begegnete und er eine Fälschung ins Irrenhaus brachte. Und auch Sancho, muss Don Alvaro Tarfe bekennen, ist viel geistreicher, als in der Fälschung von Avellaneda.
So wurde der zweite Teil des Don Quijote nur deshalb so geschrieben, weil es eine Fälschung gab und die Figuren treten aus dem Roman in die Wirklichkeit. Im zweiten Teil begegnen dem komischen Paar viele Leute, die den ersten Teil schon gelesen haben. Die Figuren im Roman haben also ein heterodiegetisches Wissen über den ersten Teil des Romans. Und es wird so eindeutig, dass die Fortsetzung des Avallaneda unwahr war. Das ist in der Tat verwirrend.
Die Stimmen zu diesem Werk sind unendlich und man könnte mehrere Semester mit diesem Werk füllen. Was soll ich Ihnen also sagen zu diesem Roman, der sich nicht nur in die Literaturgeschichte, sondern überhaupt in unsere Geschichte so intensiv eingeschrieben hat?
Ist es der Humor darin, dass ein einfacher Hidalgo sich nach übermäßiger Ritterlektüre selbst zum Don erklärt? Alonso Quijano, ein Sohn von etwas (Hidalgo) nennt sich Don Quijote, was sich auf die ledernen Beinschienen bezieht, also Don Diechling, oder Don Kniebuckel. Sein Gehirn ist eingetrocknet von der Lektüre vieler Ritterromane, die zu dieser Zeit als Cervantes den Roman schrieb, bereits ihre Blütezeit weit überschritten hatten. Daher war es auch möglich, diese Parodie anzubringen. Der Text ist voll mit den Zitaten aus dem Sagenkreis des König Artus, den zwölf Paladinen des Roland oder des Ritter Cifar und vor allem Amadis de Gaula, einer Serie von Ritterromanen, eine Urfassung von Vasco de Lobeira ist nicht erhalten, die älteste Bearbeitung auf die sich auch Cervantes bezieht stammt von Garci Rodríguez de Montalvo der selbst Ritter der Reconquista war, lebte von 1440 bis 1504, stammt aus Zentralspanien und war im Dienste der katholischen Könige
Als Katholische Könige bezeichnet man die spanischen Monarchen Königin Isabella I. von Kastilien (1451–1504) und König Ferdinand II. von Aragón (1452–1516), der als Ferdinand V. auch König von Kastilien war. Der Herrschertitel Reyes Católicos wurde ihnen im Jahr 1496 von Papst Alexander VI. verliehen.
Selbst Goethe hatte den Amadis gelesen:
„Ich habe vor Langerweile allerley gelesen, z. B. den Amadis von Gallien. Es ist doch eine Schande, daß man so alt wird, ohne ein so vorzügliches Werk anders als aus dem Munde der Parodisten gekannt zu haben.“
Eine Bücherliste der Bibliothek von Alonso Quijano wird uns im 6. Kapitel des ersten Bandes vorgestellt, und dabei wird eine Auswahl getroffen, was verbrannt und was erhaltenswert ist. Auch hier kommt es zu einem Bruch mit der herkömmlichen Literatur, wird dort doch vom Autor selbst ein eigenes Buch erwähnt, die La Galatea, ein Hirtenroman von Cervantes.
Nach antikem Vorbild spielt die novela pastoril im verklärten Niemandsland Arkadiens. Sie gründet nicht auf einem Programm der Wunscherfüllung, sondern auf Verzicht. Die novela pastoril kultiviert Passivität und Leiden an Stelle heroischer Taten. Verantwortlich für das Leiden ist die unglückliche, weil unerwiderte Liebe zu einer adeligen Frau. In der ganz als idyllischer locus amoenus gestalteten Natur, in der sich die Schäfer versammeln, scheinen alle sozialen Konflikte völlig beseitigt und lediglich die unterschiedliche Verteilung von Affekten scheint für Ungleichheit zu sorgen.
Cervantes legte mit La Galatea im Jahre 1585 einen weiteren Meilenstein dieser Gattung. Gemäß
der Logik des Prinzips in Arcadia ego, haben Kritiker manifestiert, dass die Schäfererzählung nicht komplett frei von emotionalen Erschütterungen ist. Die Protagonisten, die sich anfangs nach dem
Schema des Arkadientypos richten, nehmen mit zunehmender Zeit durch einige Begebenheiten einen menschlichen Charakter an.
Insofern erwähnenswert, da der traurige Ritter am Ende des zweiten Teils seine Rüstung ablegt und zum Hirten wird, also in eine ganz andere Rolle schlüpft, ehe er zurückgezogen
stirbt.
Spaniens goldenes Zeitalter
Anfang des 16. Jahrhunderts hat Spanien den Höhepunkt seiner Macht erreicht. Der Titel Karls V, in dessen Reich nach Eroberung der amerikanischen Kolonien 1492 die Sonne niemals unterging, lautete: Römisch-deutscher König, Erwählter Römischer Kaiser, Mehrer des Reiches, König von Spanien, Sizilien, Jerusalem, der Balearen, der kanarischen und indianischen Inseln sowie des Festlandes jenseits des Ozeans, Steier, Kärnten, Krain, Luxemburg, Limburg, Athen und Nepatria, Graf von Habsburg, Flandern, Tirol, in Schwaben, Herr in Asien und Afrika.
Doch 1556 kommt mit Philipp II ein strenger Katholik an die Stelle eines weltoffenen Reisenden. In dieser Periode kommt es zu Vertreibungen, zu Inquisitionen. Philipp hat es mit den Gegenkräften der Reformation zu tun, mit den Niederlanden, mit der aufsteigenden Macht Englands, Doch 1580 kommt es zur bekannten Reunion, zur Annektierung des in der Zeitschiene des Elefanten Salomon (König Johann I schenkte dem Nachfolger Karls IV einen Elefanten zu dessen Hochzeit, dieser wurde 1552 nach Wien überführt) noch unabhängigen Portugals.
Zuvor, bereits 1568 kam es zu einem Aufstand der Morisken, Moslems die zum katholischen Glauben konvertiert waren, dieser wurde massiv unterbunden. Viele Morisken siedeln in die Weiten der Mancha (dem Ort des Don Quijote).
Sie bauen dieses Ackergebiet auf, es werden blühende Landschaften. Doch der katholische Dogmatismus und das türkische Schreckgespenst führen zu einem Klima der Intoleranz gegenüber der Morisken. Diese greifen zu einer List. 1588 findet man in den Ruinen der Hauptmoschee von Granada die so genannten Bleibücher von Sacramonte. In diesen Schriften wird bewiesen, dass es schon vor dem Einfall der Sarazenen im 8. Jahrhundert, arabische Christen auf der iberischen Halbinsel gegeben habe. In den Büchern ist in mehreren Sprachen (arabisch, lateinisch, griechisch) in großer Gelehrsamkeit auch über biblische Legenden die Rede. So käme die katholische Herrschaft in einen Konflikt, würde man weiter gegen die Morisken vorgehen. Außerdem „prophezeien“ die Schriften die Ankunft des Propheten Mohammed und auch Martin Luthers sowie ihre eigene Auffindung, womit sie dem Bischof von Granada schmeicheln wollen. Islam und Protestantismus wird hier einander angenähert. Erst im 17. Jahrhundert werden die Schriften vom Vatikan als Fälschung angesehen. Im Jahr 2000 wurden die Bleibücher unter Leitung von Kardinal Ratzinger an Granada zurückgegeben.
Cervantes trägt diesen Diskussionen um die Bleibücher augenzwinkernd Rechnung, indem er den Don Quijote einem arabischen Historiographen in den Mund legt und am Ende des ersten Teils Fragmente einer Fortsetzung in Bleischatullen zu Tage fördert. Auch dies ist ein Beleg für Modernität des Romans, da die Autoreferenzialität des Textes mehrere beglaubigte Autoren zu haben scheint.
Dennoch kommt es zur Vertreibung von über 300.000 Morisken, was für Spaniens Wirtschaft schon bedeutend war. Der Adel war nicht glücklich darüber, da sie in Zukunft auf die Steuereinnahmen und auf die wertvollen Arbeitskräfte verzichten mussten. Spanien verlor ein Viertel seiner Bevölkerung auf diese Weise.
Kardinal Richelieu bezeichnete diese Vertreibung als die tollkünste, barbarischste Maßnahme, die die Geschichte bisher erlebt habe. Cervantes wird dieses Vorgehen auf seine Weise im Don Quijote kommentieren. Da offene Kritik nicht gebilligt wurde, wählt er den entgegengesetzten Weg: die begeisterte Zustimmung. Doch indem er sie ausgerechnet dem braven christlichen Morisken Ricote in den Mund legt, wird die Kluft zwischen blindem Dogmatismus und individuellem Schicksal nur umso deutlicher. Thomas Mann sagt dazu in Meerfahrt mit Don Quijote (1934, Th. Mann hatte den Quijote als Reiselektüre bei seiner Überfahrt nach Amerika dabei): „Das Herz des Dichters, das im zweiten Teil von Ricotes Rede zum Ausdruck kommt, spricht eine überzeugendere Sprache als seine vorsichtig unterwürfige Zunge.“
Im Don Quijote von 1615 ziehen Ritter und Knappe durch ein Spanien im Verfall. Die Mancha ist entvölkert, die Adligen leben in Verschwendung und Faulheit und suchen nur das Vergnügen, wie das herzogspaar, das mit Don Quijote und Sancho seine Späße treibt, um der Langeweile zu entkommen, dem ennui der Dekadenten. Sie ergötzen sich an Ritterromanen, da die eigene ritterliche Vergangenheit bereits lange zurückliegt. Jetzt wird der Krieg nur noch gespielt, sei es bei Turnieren oder auf der Jagd, die der Herzog Sancho wärmstens empfiehlt, da sie so gut auf den Krieg vorbereite, den die Adligen doch längst an das Berufsheer abgetreten haben.
Cervantes selbst
„Den ihr hier seht, mit adlerartigem Gesicht, mit hellbraunen Haar, glatter, heiterer Stirn, fröhlichen Augen und gekrümmter, jedoch wohlgeformter Nase, silbernem Bart, der noch vor zwanzig Jahren golden war, großem Schnurrbart, kleinem Mund, mit weder winzig noch üppig gewachsenen Zähnen, denn er besitzt nur mehr sechs, schlecht beschaffen und noch schlechter verteilt, da zwischen ihnen Lücken klaffen; der Wuchs des Leibes in der goldenen Mitte, weder groß noch klein, von eher heller Haut als dunkler, ein wenig gebeugt und nicht sehr flink zu Fuß“
Dieses Selbstportrait ist zuverlässiger als mögliche Bilder. Denn es gibt von Cervantes keine beglaubigte Bilddarstellung. Cervantes wird 1547 in Alcala de henares geboren, einer ehemaligen maurischen Festung dreißig Kilometer von Madrid entfernt, die im 16. Jahrhundert eine Hochburg der Bildung war.
Mit 21 Jahren schreibt er Gedichte zum Tod der dritten Frau Philipps II. doch die Autorenkarriere wird wohl unterbrochen durch ein missglücktes Duell und Cervantes flieht nach Rom. Ein Jahr als Kammerdiener eines Kardinals, danach wird er mit seinem Bruder Rodrigo Soldat und nimmt auch an der berühmten Schlacht von Lepanto gegen die Türken teil. Dabei wird er schwer verletzt und verliert die Beweglichkeit seiner linken Hand: El Manco de Lepanto nennt man ihn zukünftig. Der Autor der Fälschung Avellaneda beschimpft Cervantes in seiner Vorrede als einhändigen, verbitterten alten Mann. Cervantes antwortet in seiner Vorrede darauf elegant, dass er ein Soldat war, ein Ritter, der noch an etwas glaubte.
Schließlich gerät Cervantes in eine fünfjährige Gefangenschaft in Algier, erst 1580 kommt er frei (seine Familie hatte lange nicht das Lösegeld dazu). In Madrid versucht er wieder Fuß zu fassen in der Literatur. Doch der fünfzehn Jahre jüngere Konkurrenz Lope de Vega ist dort schon so etabliert, dass Cervantes Mühe hat. Sein Schäferroman La Galatea erscheint 1585. Galatea soll an einen portugiesischen Schäfer verheiratet werden. Hier greift Cervantes bereits kritisch die Eroberung Portugals auf.
Cervantes bewirbt sich für ein Amt in den Kolonien, wird aber nicht genommen. Man macht ihn zum Steuereintreiber und dabei lernt er wohl die Gegend kennen, die später sein berühmter Ritter bereisen wird, die Mancha. Dabei gerät er einmal sogar in Schuldhaft. Doch er wird nach ein paar Monaten wieder frei gelassen. Es ist eine Legende, er habe dort den Don Quijote geschrieben. Aber die Idee mag hier wohl entstanden sein.
1603 spitzt sich die Feindschaft zwischen Cervantes und Lope de Vega zu. „Keiner ist so schlecht wie Cervantes oder so dumm, dass er den Don Quijote loben würde“ behauptete Lope de Vega später, und schickt ihm auch noch per Nachporto ein Sonett zu, indem er ihn beleidigt und beschimpft. Cervantes meinte daraufhin, dass er nie wieder für den Empfang eines Briefes bezahlen würde, seit dieser Erfahrung.
Am 23. April 1616 stirbt Cervantes verarmt in Madrid. Es ist das gleiche Todesdatum, das auch Shakespeare hatte. Doch der Wermutstropfen für diese schöne Koinzidenz: im Jahr 1582 veröffentlichte Papst Gregor XIII. eine Bulle, die alle verpflichten sollte, den korrigierten gregorianischen Kalender einzuführen um am 04. Oktober 1582 sollten zehn Tage übersprungen werden. Denn der julianische Kalender hinkte zehn Tage hinterher. Nur die anglikanischen Briten akzeptieren diese Reform nicht. Daher starb Shakespeare wohl zehn Tage früher als Cervantes.
Die spanische Regierung opferte 2014 über 12 Millionen Euro um seine Knochen in einem verwaisten Madrider Trinitarier-Kloster ausgraben zu lassen. Seine linke, gelähmte Hand wäre der schlagende Beweis, dass er dort beerdigt worden war.
Der Ritter von der traurigen Gestalt (wie er sich selbst nach seiner ersten Niederlage nannte) ist ein Held, ein Mann, der sein Ideal über die Realität stellte und für seine Moral riskierte, sich lächerlich zu machen. Es ist wahrlich traurig, dass wir über ihn und seinen hoffnungslosen Kampf gegen Windmühlen heute noch lachen. Cervantes schuf eine Figur die aus der Schrift, dem Text, dem Gedanken heraustrat und mit allem Risiko in die Wirklichkeit übertrat. Dafür gebührt dem Spanier alle Ehre und unser aller Respekt.
Eine verfahrene Situation
Wenn die Menschheit als Ganzes träumen könnte, müßte Moosbrugger entstehen.
(Robert Musil)
In Kapitel 74 Band I des berühmt-berüchtigten Romans „Mann ohne Eigenschaften“ von Robert
Musil bekommt die Hauptfigur Ulrich einen Brief von seinem Vater. Die Kapitelüberschrift Das 4. Jahrhundert v. Chris. Gegen das Jahr 1797 verweist auf zwei Moralkonzepte. Einerseits die
nikomachische Ethik von Aristoteles (aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert) und andererseits auf die Metaphysik der Sitten von Immanuel Kant aus dem Jahr 1797.
Ulrich erhält abermals einen Brief von seinem Vater ist der zweite Satz der Kapitelüberschrift. Dort bittet er Ulrich, ein Wort bei Graf Leinsdorf einzulegen, dass eine bestimmte Aufweichung
der Rechtsauffassung nicht in das Jubiläumsjahr (bezieht sich auf das 70jährige Dienstjubiläum von Kaiser Franz-Joseph I des Kaiserreichs Österreich-Ungarn – k.u.k genannt und von Musil scherzhaft
als „Kakanien“ tituliert) falle. Die Welt schreibt Ulrichs Vater in dem Brief zerrisse, wenn alles als wahr gelten dürfte, was dafür gehalten wird, und jeder Wille als erlaubt, der sich
selbst so vorkommt. Es ist darum unser aller Pflicht, die eine Wahrheit und den rechten Willen festzustellen und, soweit uns dies gelungen ist, mit unerbittlichem Pflichtbewußtsein darüber zu wachen,
daß es auch in der klaren Form wissenschaftlicher Anschauung niedergelegt werde.
Die Frage um die es dort geht bezieht sich natürlich auf den Fall Moosbrugger und der Frage der Zurechnungsfähigkeit. Moosbrugger war ein verurteilter Frauenmörder über dessen psychische
Zurechnungsfähigkeit und damit Verantwortlichkeit für seine Taten im Kaiserreich keine Einigung herrschte. Musil bezieht sich in seinem großen Werk auf die reale Figur des Zimmermanns Christian
Voigt, der zunächst zum Tode verurteilt und später vom Kaiser begnadigt wurde. Auch Karl Kraus widmete diesem Fall einen längeren Bericht aus dem Gerichtssaal (Die Polizei hierzulande. Aus:
Die Fackel, Nr. 334-335, 31. Oktober 1911).
Der Mörder Voigt bezeichnete sich dort selbst zunächst als zurechnungsfähig und vernünftig. Als man ihn aber zum Tode verurteilt, sagt er vor dem Gericht: „Ich bin damit zufrieden, wenn ich Ihnen auch gestehen muß, daß Sie einen Irrsinnigen verurteilt haben!“ So sieht sich der Mörder selbst als verrückt und zeigt zugleich eine Einsichtsfähigkeit, die seine Verrücktheit damit ausschließt, denn Kennzeichen einer Psychose ist meist die fehlende Krankheitseinsicht. Musil schreibt dazu: Das war eine Inkonsequenz; aber Ulrich saß atemlos. Das war deutlich Irrsinn, und ebenso deutlich bloß ein verzerrter Zusammenhang unsrer eignen Elemente des Seins.
Ulrichs Vater in Musils Roman hat einen Streit mit seinem Kollegen Professor Schwung.
Dort geht es um sehr feine Formulierungen der verminderten Straffähigkeit. Bis heute haben wir gerade im Umgang mit Sexualstraftätern keine abschließend befriedigende Rechtspraxis. Ulrichs Vater und
Professor Schwung streiten in dem Kapitel um ein einziges Adverb.
Die Version des Vaters lautet: Eine strafbare Handlung ist dann nicht vorhanden, wenn der Täter zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem Zustand von Bewußtlosigkeit oder krankhafter
Störung der Geistestätigkeit befand, so daß er nicht die Fähigkeit besaß, das Unrecht seiner Handlung einzusehn, und seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen
war.
Professor Schwung kritisiert hier das „und“ und will dafür ein „oder“ stehen haben. Und das ist sehr fein beobachtet. Ist unser Denken im Wollen bestimmt oder unser Wollen im Denken? Es war Kant in der „Metaphysik der Sitten“ (erschienen eben 1797) der letzteres behauptete und damit der seit zweieinhalbtausend Jahren geltenden Auffassung von Aristoteles widersprach, nach der unser Logos (unser Verstand) den Willen beherrscht. Und klar, wenn der Wille vom Logos beherrscht werden kann, ist er nicht frei. Ein freier Wille wäre somit sogar eine Form des Geisteszerfalls.
Daher ist Ulrichs Vater aufgebracht, denn er ist der Überzeugung, dass Willensentscheidungen auf logischer Grundlage gebildet werden und der Zerfall der Geistestätigkeit automatisch auch die Willensbestimmung ausschließt. Schwung amüsiert sich darüber. Denn dann wäre es so, dass jemand frei kommt, wenn er rein logisch richtig gehandelt hätte. Wenn die Wahnvorstellungen bestimmte Umstände annehmen mit der man die Handlung rein logisch rechtfertigen kann (man zwar einen Wahn hat, aber innerhalb der Wahnfiktion vernünftig denkt), dann hätte man ja – nach dieser Vorstellung - korrekt gehandelt, wenn man die Fähigkeit, das Unrecht einzusehn, zur Grundlage nimmt, eine Person, welche, wie es vorkommt, an besonders gearteten Wahnvorstellungen leidet, sonst aber gesund ist, nur dann wegen Geisteskrankheit freigesprochen werden dürfte, wenn sich nachweisen ließe, daß sie infolge ihrer besonderen Wahnvorstellungen das Vorhandensein von Umständen annahm, welche ihre Handlung rechtfertigen oder deren Strafbarkeit aufheben würden, so daß sie sich also in einer wenn auch falsch vorgestellten Welt doch korrekt benommen hätte.
Mehr intellektueller Witz ist mir kaum vorstellbar. Zumal damit noch nicht genug, antwortet Ulrichs Vater darauf, dass die Zustände der Zurechnungsfähigkeit und der Unzurechnungsfähigkeit nicht gleichzeitig bestehen können. Sie sind bei einem teilweise gesunden Menschen im schnellen Wechsel vorhanden. Nun muss man genau feststellen, in welchem Zustand sich der Mensch befand zur Tatzeit. Aber da müsste man ja nun die ganzen Ursachen ab der Geburt, ja sogar noch die Vorfahren mit einbeziehen. Das klingt unmöglich. Aber es ist genau das, was Immanuel Kant in seiner „Metaphysik der Sitten“ forderte. Kant postuliert das angeborene Recht jedes Menschen auf Freiheit. Nach seiner Auffassung ist es Aufgabe des Rechts, die Ausübung der individuellen Freiheit der Einzelnen mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz in Übereinstimmung zu bringen. Solange wir im Grunde frei sind, antwortet daher Professor Schwung in dem amüsanten Text von Robert Musil, solange wir im Grunde frei sind, sind wir es auch den einzelnen Gründen nach. Wir wüßten, …, mit weit mehr Deutlichkeit, daß unser Wille frei sei, als daß alles, was geschieht, eine Ursache habe, und solange wir im Grunde frei seien, seien wir es auch den einzelnen Gründen nach, weshalb man annehmen müsse, daß es in solchem Fall nur einer besonderen Anspannung der Willenskraft bedürfe, um den ursächlich bedingten verbrecherischen Antrieben zu widerstehn.
Aus diesem Dilemma kommt man nicht heraus. Nach Arthur Schopenhauer ist unser Wille begründend. Wir können nicht wollen, was wir wollen. Dann wäre die Wahl die wir treffen nicht mehr frei. Außer wir setzen diesem unsere Vernunft entgegen und kontrollieren diese Bestie. Auch dann ist unser Wille nicht frei, sondern vom Bildungsgrad, der Erziehung und der jeweiligen Sozialisation (Aristoteles nannte das Hexis, lateinisch Habitus) abhängig.
Es ist im Grunde das, worum es dem Vater von Ulrich in diesem Brief geht. Kontrolle ist jetzt aber so eine Sache. Denn sie ist ein weiteres Attribut unseres Willens. Denn wie sollte ich – ohne Willenskraft aufzuwenden – den Willen kontrollieren können? Das ist ein Widerspruch. In einer immer komplizierter werdenden Welt benötigt man eine geradezu heldenhafte Entscheidungskompetenz die auch noch einen kaum mehr zu bewältigenden Grad an Informiertheit impliziert. Und in Musils Roman geht es genau darum. Es ist ein Schlüsselroman der Industrialisierung die mit der Gründerzeit begann. Der andere Widerspruch liegt im Attribut der Urheberschaft. Um eine freie Willensentscheidung treffen zu können bin ich mir selbst mein Grund. Niemand sonst trifft für mich die Entscheidung. Doch das würde die Welt zerreißen, wie das Ulrichs Vater zu Beginn des Kapitels befürchtet. Denn wie sollen Gesetze aussehen, wenn jeder tun kann was er will? Das Staatsrecht bei Kant dient der Herausbildung einer staatlichen Ordnung, in der der Souverän – das Volk – Freiheit und Gleichheit aller Staatsbürger gewährleistet. Diese Form der Autonomie, des einzig Guten bei Kant (der gute Wille im Gegensatz zum Streben nach Glückseligkeit bei Aristoteles) spalten das auf.
So gilt der gute Wille mehr als der vernünftige Zweck. Und ein Irrer kann Gutes tun, wenn er Gutes tun will. Ein kluger Mensch würde immer Gutes tun, das verlangt seine Klugheit, so sieht es Aristoteles. Alles andere wäre schlicht unklug. Wenn er es nicht tut, dann bleibt ihm zwar noch der gute Wille, aber ihm fehlt das Verständnis zum Guten. Handeln wird zufällig. Für Kant gibt es keine letzte und allgemeingültige Bestimmung des Guten. Das Gute in seiner Bestimmung ist immer subjektiv. Das Subjekt erschließt sich dabei ein Wahrnehmungsfeld, das es als gut interpretiert. Dabei ist das Subjekt von den moralischen Normen der Gesellschaft beeinflusst und muss sich beständig von diesen Normen emanzipieren. Verweigert das Subjekt diese Arbeit, verfällt das Gute, verkommt das Gute. Das ist die eine Schwäche des Wahrnehmungsverweigerers. Die andere Schwäche ist es, dass das Wahrnehmungsfeld des Subjekts sich verkleinert, wenn die Arbeit nicht geleistet wird. Dann erkennt man das Gute nicht mehr, obwohl es deutlich vor den eigenen Augen steht. Nur noch die Phrase, die Banalität (um mit Hanna Ahrend zu reden) wird wahrgenommen. Das Gute ist daher ein Arbeitsprojekt. Und die Arbeitsmoral ist die Aufklärung. Dagegen haben Adorno und Horkheimer ihre „Dialektik der Aufklärung“ gerichtet, in der die Aufklärung selbst wieder ihre eigenen verdrehten Mythen erzeugt und man bräuchte eine Aufklärung der Aufklärung. Ad infinitum – ad nauseam.
In unserer Rechtsprechung StGB § 21 heißt es „Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der
Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das
Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln“
Damit hat sich Professor Schwung und Immanuel Kant durchgesetzt.
Die rechtliche Konstruktion der Willensfreiheit definiert dabei eine Person als willensfrei,
die eine Wahl hat zwischen zwei oder mehr Alternativen. Sie müsste also auch anders handeln können, als sie tatsächlich handelt. Die Bedingung des Anders-Handeln- oder Anders-Entscheiden-Könnens
seien hier mal zurückgestellt. Die getroffene Wahl muss ausdrücklich von der Person selbst abhängen. Dies nennt man die Urheberschaftsbedingung. Wie die Person handelt oder entscheidet, muss
ihrer Kontrolle unterliegen. Diese Kontrolle darf nicht durch Zwang ausgeschlossen sein. Das nennt man die Kontrollbedingung. Also muss für die Person die Handlung offen sein, und die Person
soll Urheberschaft sowie die Kontrolle über die Handlung inne haben. Das sind die drei Bedingungen der Willensfreiheit. Eine Person ist in ihrem Wollen frei, wenn sie die Fähigkeit hat, ihren
Willen zu bestimmen, zu bestimmen, welche Motive, Wünsche und Überzeugungen handlungswirksam werden sollen. Innerer Zwang (psychische Erkrankung) und äußerer Zwang (Androhung von Gewalt) unterliegen
äußerst fragilen Vorstellungen. Sollte eine langjährige durch Gewalt orientierte Erziehung meine Willensfreiheit einschränken, muss in einem enormen Aufwand geklärt werden und lässt sich vermutlich
nie klären, weil hier unterschiedliche normative Einstellungen von Gesellschaft und Subjekt ein höchst diverses Konglomerat bilden. Die eigene Urheberschaft seines Wollens hat der Fall Moosbrugger
(real Christian Voigt) ins Absurde geführt. Sie haben einen Irrsinnigen verurteilt. Und unsere Wahlfreiheit wird derart intensiv von äußeren und auch inneren Bedingungen mitgeprägt,
dass das eigene Wollen im Sinne Schopenhauers nicht mehr hinterfragbar ist ohne dabei in einen unendlichen Regress zu verfallen.
So oft ich über dieses kleine nur vier Seiten umfassende Kapitel aus Musils Roman auch nachdachte: ich kam und komme zu keinem endgültigen Schluss. Ebenso wenig wie es der Hauptfigur des Romans
Ulrich gelang.
Zwei Fiktionen bilden bis heute den Rahmen unserer Rechtspraxis: Die Fiktion von der ganzen Person und die Fiktion wir könnten die Komplexität eines Tathergangs vollständig entschlüsseln. So wird aus
dem Bedürfnis nach Gerechtigkeit eine legalistische Erzählung, deren Anspruch auf Ordnung größer ist, als der Anspruch auf Wahrheit.
Und so könnte man – wenn man einen Pitch wagen wollte für MoE – den Jahrhundertroman von Musil auf den Punkt bringen: Der Anspruch auf Ordnung ist größer als der Anspruch auf Wahrheit. Damit hat
Musil nicht nur einen Schlüsselroman der klassischen Moderne geschrieben, sondern damit bereits die Postmoderne eingeläutet. Daher scheiterte der Roman naturgemäß an sich selbst, weil er die große
Erzählung aus sich selbst gar nicht mehr stemmen konnte und die Vernunft sich auf manieriert barocke Weise als Curiositas entpuppte.
Rufen Sie einfach an unter
Arwed Vogel
++49 ( )8762 726121
oder
Bernhard Horwatitsch
017646130019
horwatitsch[at]gmx.at
...
oder
nutzen Sie unser